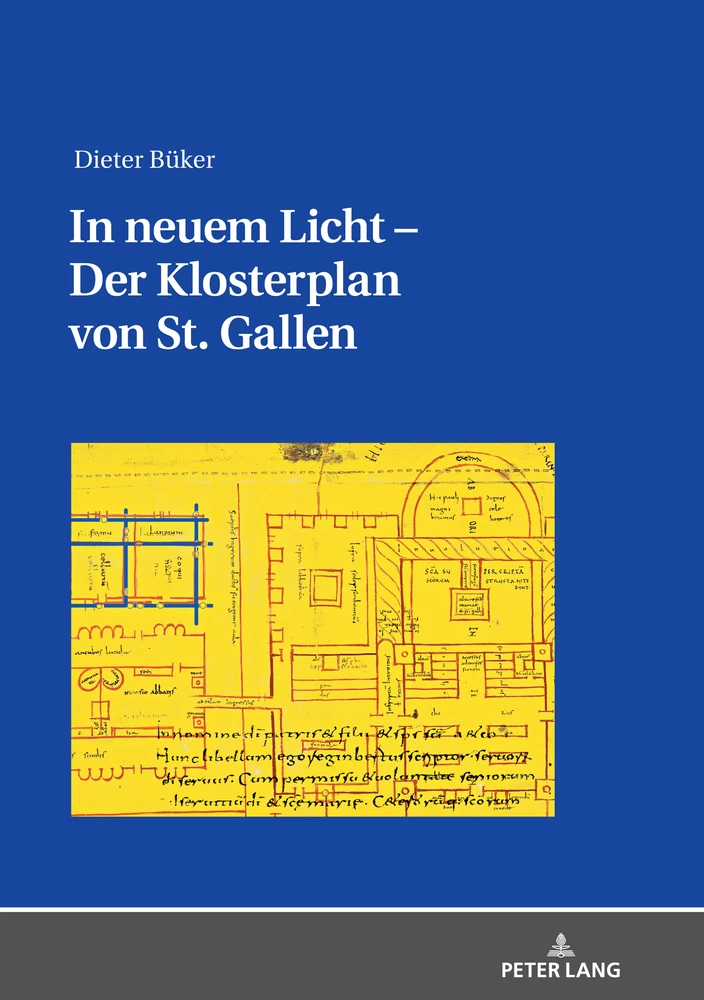In neuem Licht – Der Klosterplan von St. Gallen
Aspekte seiner Beschaffenheit und Erschaffung
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Statt eines Vorworts
- Inhalt
- Mit Zirkel und Lineal – Der Klosterplan und wie er konzipiert und konstruiert wurde (Dieter Büker)
- Stand der Forschung
- Zur Beschriftung der Rückseite des Klosterplans im 12. Jahrhundert
- Aus fünf einzelnen Pergamenten …
- Auf der Suche nach Vorzeichnungen
- Blindlinien und -risse
- Blindlinienvorzeichnung?
- Alte Bilder – neu betrachtet
- Robert Fuchs und Doris Oltrogge
- Norbert Stachura
- Rudolf Gschwind und Lukas Rosenthaler
- „Vorzeichnung“ und Konstruktion des Plans – Blindlinien oder Prickings?
- Die Jagd nach einem Phantom
- Prickings statt Blindrillen
- Prickings in älteren Zeichnungsanalysen
- Robert Branner über die Reimser Palimpseste
- Robert Bork über gotische Risse
- Die Klosterplanzeichnung
- Geraden und Orthogonale
- Abtspalast und Nebengebäude
- Gästehaus und Versorgungsgebäude
- Kreisfiguren
- Der Gabrielsturm
- Der Michaelsturm
- Ein nicht realisierter Gabrielsturm und die Planung zweier wuchtiger Westtürme
- Der Westabschluß der Abteikirche und die blinden Kreisbögen
- Der Ostabschluß der Abteikirche und die Deduktivkreise
- Das Prinzip der konzeptionellen Stiche
- Die Simulation der Planzeichnung am Computer
- Zusammenfassung
- ‚Mit ermüdeter Hand schematisch angefertigt …‘ – Das große Haus und die Stallungen (Dieter Büker)
- Das große Haus
- Zeichenfarben
- Rekonstruktion des großen Hauses
- Die Großviehställe
- Zusammenfassung
- Nachtrag
- Norbert Stachuras „Kiellinien“ auf dem Klosterplan (Dieter Büker)
- Das Interesse an den Vorzeichnungsspuren
- Stachuras Suche nach Blindlinien
- … in der Sakristei
- … im Dormitorium und Latrinenhaus der Mönche
- … im Gästehaus
- … am Sevenbaum
- Büge, Blindlinien und Ritzungen
- … im Zentrum
- … am Gästehaus
- … im Westabschluß der Abteikirche
- Kiellinien in Urkunden
- … in einer St. Galler Königsurkunde von 879
- … in einer St. Galler Privaturkunde von 852
- … in einer St. Galler Privaturkunde von 762
- Zusammenfassung
- Es war einmal … 130 Jahre ‚Planwiderspruch‘ – Die Auflösung eines vermeintlichen Dilemmas (Dieter Büker)
- Ein ‚Planwiderspruch‘?
- Plan- oder Maßkirche?
- Eine Frage sucht nach Antwort
- Warum lief die Forschung in die Irre?
- Die Maßinschriften als notwendige Ergänzung der Planzeichnung
- Ein höchst rätselhaftes „Wunder der Überlieferung“ – Bemerkungen zu den Schöpfern und Empfängern des Klosterplans (Alfons Zettler)
- Reginberts Widmung
- Zur Beziehungsgeschichte der Bodenseeklöster
- Über die Beziehungen Reginberts von der Reichenau zum Kloster St.Gallen
- Wano von St.Gallen und Reginbert von der Reichenau
- Reginbert, Wano, Ratheri und Hadapreht
- Netzwerke der Mönche
- Mönchsdynastien und ihre Bücher
- Reginberts Erbcodex und die Widmung des Klosterplans
- Reginbert ist Autor und Urheber des Klosterplans
- Reginberts St.Galler Gegenpart – Wer war der Empfänger des Klosterplans?
- Abkürzungen
- Literatur
- Zu den Abbildungen
Dieter Büker
Mit Zirkel und Lineal – Der Klosterplan und wie er konzipiert und konstruiert wurde
Der Klosterplan von St. Gallen dürfte nicht mehr vorgestellt werden müssen: Seit mehr als vierhundert Jahren wird diese einmalige Quelle aus dem frühen Mittelalter, seit Anfang des neunten Jahrhunderts in der Stiftsbibliothek des ehemaligen benediktinischen Klosters St. Gallen aufbewahrt und gehütet, erforscht, analysiert und beschrieben. Die umfangreiche Fachliteratur der letzten Jahrzehnte ist verbunden mit den Namen Berschin, Binding, Bischoff, Duft, Hecht, Horn und Born, Jacobsen, Oxenbein, Schmuki, Sennhauser, Stachura, Tremp, Zettler und anderen (Büker 2017, S. 21).
Dieser Einleitung soll hier nichts hinzugefügt werden3. Wie aber sahen die Forscher in ihren nicht immer übereinstimmenden Veröffentlichungen bislang den Klosterplan? Das aufgefächerte Forschungsspektrum sei hier schwerpunktmäßig kurz umrissen:
Laut Hecht zum Beispiel sei der Plan über Jahrhunderte hinweg altersbedingt um bis zu 6 % geschrumpft (vgl. 1983, S. 53). Er sowie auch andere Forscher vertraten die Ansicht, die Grundrißzeichnung sei maßstäblich über einem Gitternetz ausgeführt und enthalte einen Widerspruch zwischen den Maßen der gezeichneten und der mit Zahlen versehenen verbal beschriebenen Ausdehnung. Des Weiteren gibt es Aussagen, die Zeichnung sei durch Blindrillen vorgezeichnet, reflektiere die Anianischen Klosterreformen von 814/817, sei eine Visualisierung der Benediktsregel und des Hildemarkommentars, nehme die Gedanken antiker Autoren (Archimedes, Vitruv) auf, sei mehrfach radiert, geändert und umkonzeptioniert worden und anderes mehr.
Wie soll man sich nun diesen Forschungspositionen gegenüber verhalten? – Man kann sie übernehmen und auf ihnen aufbauen. Man kann sie auch aufgrund eigenen Vorwissens oder Vermögens bewerten. Weil sich zum Beispiel ←17 | 18→die Wendeltreppen in den westlichen Abteikirchentürmen bei genauem Hinsehen als nur partiell ineinander übergehende, ansonsten aber konzentrische Kreise, keineswegs jedoch als Spiralen entpuppen, ist Hubers Idee zu verwerfen, die Wendeltreppen seien als exakte Archimedische Spiralen konstruiert worden (vgl. 2002, S. 254; Abb. 44 auf Seite 82). Und weil es sich bei der Schrumpfung hygroskopischen Materials, wie es auch Pergament aus Tierhaut ist, um einen thermodynamischen Prozeß handelt, der sich durch Materialeigenschaften, Temperatur, Dampfdruck, allgemeine Gaskonstante und andere Parameter, keinesfalls aber durch den Faktor Zeit beschreiben läßt, ist die Vorstellung einer alterungsbedingten Schrumpfung physikalisch unmöglich und daher a priori zurückzuweisen. Wie aber will man sich den durch eigenes Wissen oder Können nicht aufklärbaren Interpretationen des Klosterplans von St. Gallen gegenüber verhalten?
Es gibt nur einen einzigen Weg, sich wissenschaftlich der Wahrheit zu nähern: Man muß die jeweiligen epochenrelevanten Wissenshorizonte sauber voneinander – und den heutigen streng von dem der damaligen Mönche – trennen und dann heutige Aussagen am damaligen monastischen Wissensstand überprüfen. Nur so können Anachronismen aufgefunden und durch abgesicherte Ergebnisse korrigiert werden. Dieser monastische Wissens- und Kenntnis- – oder allgemeiner ausgedrückt – Kulturhorizont, immer mit der speziellen Blickrichtung auf den Klosterplan, muß zunächst erkundet werden. Es ist zum Beispiel danach zu fragen, ob die Klosterplanhersteller des neunten Jahrhunderts das wußten und beabsichtigten, was wir glauben, daß sie es wußten und beabsichtigten. Oder unterstellen wir ihrer Zeit etwas, das nicht in sie hinein gehört? Zu fragen ist, wie sich die Geometrie bis hin zu ihnen entwickelt hat, wie die Darstellung von Architektur, welchen Stellenwert die Mathesis-Fächer des Quadriviums (Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik) zu ihrer Zeit hatten, was ihre Tätigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen waren und anderes mehr.
Auf diese und ähnliche Fragen ließen sich aus der einschlägigen Literatur Antworten erarbeiten und der monastische Horizont des frühen neunten Jahrhunderts, in welchem der Klosterplan erstellt wurde, relativ verläßlich nachzeichnen (vgl. Büker 2017). Demnach hatten sich im Weltbild der damaligen Mönche und Kleriker (als den wesentlichen Trägern und Tradenten von Wissen und Können) alle weltlichen Wissenschaften schon in der Antike vollständig ausgebildet und bedurften keiner Erweiterung mehr. Seit den griechischen Denkern war Philosophie, später auch die christliche Religion, eng verwoben mit Zahlen, Zahlenverhältnissen und der Geometrie. Röd beschrieb diese ←18 | 19→Verquickung in seiner Philosophiegeschichte als „Mathematisierung des Weltbildes“ (1994, S. 44). Und, ein ganz wesentlicher Aspekt zur Interpretation des Klosterplans: Das neunte Jahrhundert kannte noch keine Maßstäblichkeit im heutigen Sinne. Die Kulturleistung maßstäblicher Zeichnungen kam erst mit den gotischen Kathedralen im 13. Jahrhundert auf. Das haben Binding, Kimpel und andere Forscher beschrieben und ihre Gründe dafür erläutert (vgl. Binding 1999, Kimpel und Suckkale 1985 und Kimpel 2005), zuletzt auch ich selbst (vgl. Büker 2018).
Die Überprüfung des hier zuvor schwerpunktmäßig skizzierten heutigen Forschungsspektrums an diesem uns so vollständig zeitfremden monastischen Geistes- und Wissenshorizont ermöglichte die Identifizierung von Anachronismen und dadurch die Formulierung neuer Aussagen hinsichtlich der Interpretation des Klosterplans. Das Ergebnis ist, daß der Klosterplan weder mit Hilfe von Gitternetzen gezeichnet wurde (diese ägyptische Technik hat in Mitteleuropa erst ab der Renaissance Tradition – im Wesentlichen jedoch zur Proportionierung, nicht zur Konstruktion!), daß er auch keine Visualisierung der Regula Benedicti und noch weniger des Hildemarkommentars zur RB ist, welcher laut Hafner erst zwischen 845 und 850 in Civate entstand (vgl. 1959, S. 144–148), er sich weder auf Vitruv oder Archimedes und auch nicht auf andere antike Schriftsteller bezieht (vgl. Büker 2015, S. 347–349) und, ganz wichtig: Der Klosterplan ist auf keinen Fall maßstäblich gezeichnet, konnte gar nicht maßstäblich gezeichnet worden sein, weil es Maßstäblichkeit überhaupt noch nicht gab.
Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer Überprüfung des heutigen Forschungsspektrums mit geisteswissenschaftlichen Methoden. Aber: Die Frage nach den Blindlinien und den mehrfachen Planänderungen konnten mit geisteswissenschaftlicher Methodik nicht einmal aufgegriffen werden. Der Plan in seiner materiellen Existenz als Träger des Bildes auf seiner Vorderseite und der Martinslegende auf seiner Rückseite stand ja bislang noch gar nicht im Focus des forschenden Interesses. Reinhardt jedoch hatte schon früh angemahnt:
Jede Deutung des Plans hat aber in allererster Linie von ihm selbst auszugehen und von dem, was er aussagt. Deshalb ist es nötig, bevor man sich andere Fragen stellt, die Zeichnung selbst und ihre Beischriften zu studieren, ihre Angaben zu prüfen und zu versuchen, dieselben zu verstehen (1952a, S. 18).
Der originale Klosterplan selbst ist einer Untersuchung nicht zugänglich. Er wurde bis vor kurzem unter Hochsicherheitsglas wie in einem Tresor in der ←19 | 20→Stiftsbibliothek St. Gallen als ihr vielleicht kostbarster Schatz gehütet4. Aber es gibt Faksimiles von ihm, seit 1952 analoge, seit 2005 auch mehrere digitale. Seit 2007 sind einige von ihnen im Internet öffentlich verfügbar, auch ein Bild der Rückseite des Plans mit der Martinsvita. Dazu kommen einerseits nicht veröffentlichte Dateien sowie viele analoge und digitale Einzelaufnahmen verschiedener Forscher und Einrichtungen5. Dieser Quellenbestand und die entsprechende Adobe Photoshop-Software haben es mir ermöglicht, den Klosterplan genauestens zu untersuchen, obwohl das Original weiterhin unzugänglich bleibt. Im Folgenden geht es ausnahmslos um Methoden, Befunde und Ergebnisse einer systematischen technischen Analyse von Rück- und Vorderseite des Klosterplans (Bibliothekssignatur Cod. Sang. 1092).
Der Klosterplan ist aus fünf einzelnen Pergamenten aus Schafshaut (vgl. Fuchs 2002, S. 311) zusammengesetzt, die hier mit Horns 1979 eingeführter Nummerierung von 1 bis 5 benannt werden. Betrachtet man die Vorderseite mit der im frühen neunten Jahrhundert aufgebrachten Zeichnung des Klosterplans, dann ist das zentrale Pergament Teil 1 dem unteren Teil 2 überlappend aufgenäht, beide gemeinsam überdecken sie den rechts angenähten Teil 3, und die oberen und unteren Pergamente 4 und 5 wurden diesen drei zentralen Stücken ebenfalls überlappend angenäht. Das gesamte Pergament wurde nach der Beschriftung mit dem Text der Martinslegende auf der Rückseite im ausgehenden zwölften Jahrhundert (vgl. Duft 1962, S. 34) mehrfach gefaltet und wie ein Buch in der Stiftsbibliothek als „Buch unter Büchern“ (Berschin 1987, S. 7) eingereiht, ein Umstand, welchem diese einmalige Zimelie wahrscheinlich ihr Überleben verdankt.
Bei meiner Analyse werde ich mich dem Plan weiterhin behutsam von „außen nach innen“ annähern und deswegen die Untersuchung bei der Rückseite beginnen.
←20 | 21→Zur Beschriftung der Rückseite des Klosterplans im 12. Jahrhundert
Das erste Bild zeigt sie mit dem Text der Martinsvita (Abb. 1). Es ist das erste digitale Abbild des Cod. Sang. 1092, welches etwa im Jahre 2007 veröffentlicht wurde und aus je 30 im Jahre 2005 erstellten Einzelaufnahmen von Vorder- und ←21 | 22→Rückseite des Plans besteht, die in einem aufwendigen Verfahren zu den beiden Mosaikbildern von Zeichnung (FAKLA 2007r) und Legende (FAKLA 2007v) zusammengesetzt wurden. Auf dem Bild ist die Positionierung der fünf Einzelteile des Pergaments spiegelbildlich zur Vorderseite, und ihre soeben beschriebenen Über- bzw. Unterlappungen sind entsprechend umgekehrt. Die roten Linien deuten die Nähte an, die blauen die auf den Teilen 1 bis 3 noch erkennbaren Falz- oder Knicklinien (oder Buge), deutliche Zeichen dafür, daß diese Pergamente aus der Vorbereitung einer normalen Buchproduktion im Skriptorium der herstellenden Abtei auf der Insel Reichenau entnommen wurden (vgl. Schedl 2014, S. 61, 68). Die weißen Zahlen 1 bis 14 bezeichnen die Reihenfolge der Seiten, in welcher die Martinslegende aufgeschrieben wurde und zu lesen ist6. Man kann – vielleicht nicht besonders deutlich – erkennen: Auf der Seite 1 mit dem Beginn der Martinsvita und teilweise auch auf den Seiten 12 und 13 links darüber wurden die Zeilen, auf denen die Schrift steht, zum Teil mit dunkler Farbe vorgezeichnet. Das soll genauer betrachtet werden.
Für eine detaillierte Analyse greife ich auf das entsprechende Einzelbild (Abb. 2) zurück, weil durch das Zusammensetzen der 30 Einzelbilder zum Gesamtmosaik auf beiden Seiten des Pergaments Dopplungen, Auslassungen, Verschleifungen etc. aufgetreten sind, welche die Analyse verfälschen könnten. Das Bild zeigt den Anfang der mit Incipit vita beati Martini epi überschriebenen Martinsvita. Das von Gschwind (und Rosenthaler) im Jahr 2005 aufgenommene Bild wurde mit Hilfe des Adobe Photoshop-Programms bearbeitet, zunächst gedreht, sodaß die oberste, mit zeilenmarkierendem Federstrich gezeichnete Linie 2 mit der programmkreierten Waagerechten (W – W) parallel geführt wurde. Der blaue Bildhintergrund macht die Drehung deutlich. Alsdann wurden die originären dunklen Federstriche mit weiß punktierten Linien nachgezeichnet, um sie besser sichtbar zu machen, und zusätzlich durch Ziffern identifiziert (L1 bis L22). Danach wurden programmgenerierte, hier gelb gefärbte waagerechte Linien durch jeweils den linksseitigen Beginn der ursprünglichen Federstrichlinien gezogen. Es zeigt sich bei dieser Linienuntersuchung, daß die ursprünglich mit der Vogelfeder gezogenen, hier weiß punktiert nachgezeichneten Zeilenlinien zum Teil erheblich von den exakten gelben Waagerechten abweichen. Besonders auffallend scheinen diese Abweichungen bei den Linien L5, L12 und L15 bis L18 zu sein. Einige dieser Zeilen sollen nun weiter betrachtet werden (Abb. 3).

Abb. 1: Klosterplanrückseite – Struktur und Seitenfolge der Martinsvita
Quelle: FAKLA 2007v, bearb.

Abb. 2: Martinsvita – Folio 1.1
Details
- Seiten
- 236
- Jahr
- 2020
- ISBN (PDF)
- 9783631835937
- ISBN (ePUB)
- 9783631835944
- ISBN (MOBI)
- 9783631835951
- ISBN (Hardcover)
- 9783631814550
- DOI
- 10.3726/b17608
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (September)
- Schlagworte
- Klosterplan Konstruktionsweise Geometrie klösterliche Scriptorium Technische Analyse Frühmittelalter Computersimulation Prickings (Einstiche) monastische Technik
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 236 S., 83 farb. Abb., 19 s/w Abb.