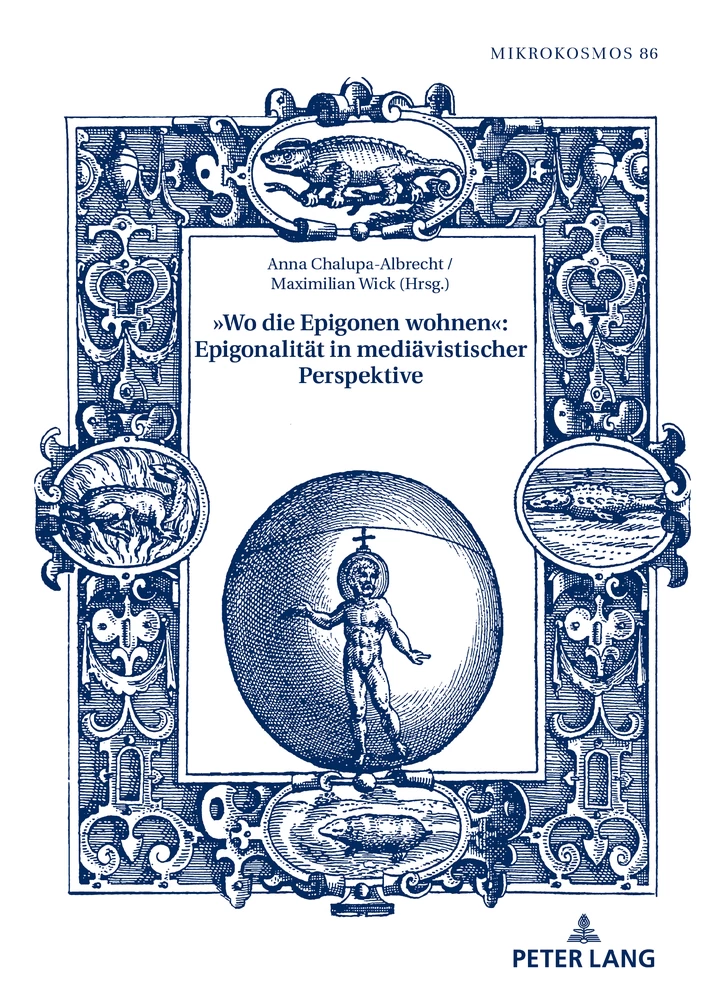»Wo die Epigonen wohnen«: Epigonalität in mediävistischer Perspektive
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Danksagung
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vor dem Epigonentum, 1819–1823 Jacob Grimm, Karl Lachmann und die Rangfolge der Dichter und Dichtung
- Heldentum in wechselnden Weltverhältnissen
- Wi(e)der die Tradition – Epigonales Erzählen im Wigalois Wirnts von Grafenberg
- daz niemen kunde ze ende komen
- Südtiroler Spätlinge
- Zu ‚vermeintlich‘ guten und schlechten Artusgeschichten – Epigonentum in Mittelalter und Moderne
- Vom Ende der Unterschiede. Oder: Eine Ästhetik der Angleichung. Angleichung als poetologisches und handlungsleitendes Prinzip im Engelhard Konrads von Würzburg
- Figura μετάλημψις a posterioribus ad priora
- Jason und Medea als epigonale Liebeserzählung? Die Argonautensage in Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
- (Re-)Produktiver Physiologus
Anna Chalupa-Albrecht / Maximilian Wick
I Epigonen
Anders als die Geschichte der ‚Klassiker‘1, der prägenden wie zunächst geprägten Gestalten und Werke fast jeder Literaturhistorie, scheint eine gleichermaßen eigenständige der ‚Epigonen‘2 noch nicht geschrieben, ja aufgrund ihrer augenscheinlichen Abhängigkeit von Ersterer nicht einmal sonderlich schreibenswert. Solange außer Frage gehalten wird, bei welchen Werken „die Fortdauer der unmittelbaren Sagkraft […] grundsätzlich unbegrenzt ist“,3 kann per Ausschluss alles unmittelbar zuvor Geschriebene als ‚Vorläufer‘ (deren Geschichte ebenfalls oft ehrfürchtig geschrieben wird) und das Folgende als unwerte ‚Nachahmer‘ klassifiziert werden. Mitunter verdeckt dieser Mechanismus jedoch sein wesentliches, ex negativo geschöpftes Kriterium, denn während die innovativen Leistungen des Höhenkamms ausführlich untersucht werden, wird das ästhetische Urteil über die Werke in seinem Schatten oft genug suggestiv gefällt: Was nach den Klassikern kommt, zumal wenn es sich ausdrücklich und lobend auf diese bezieht und sie damit gegebenenfalls erst in den Stand der Klassiker erhebt, kann gegenüber deren Qualität nur abfallen. Bedenkt man nun, dass Originalität als wesentliches Merkmal literarischer Hochleistung sowie die daraus resultierende „Einflussangst“4 von einer Ästhetik des 19. Jahrhunderts rühren, deren Maßstab – zumeist ohne große Modifikationen – schließlich auch auf vergangene Epochen angewandt wurde und wird, mag das doch mit Blick auf vormodernes Erzählen skeptisch stimmen.5 Immerhin überlebten besonders in der mediävistischen Forschung solche – literaturhistorisch durchaus praktischen – Urteile häufig ihre ursprünglich auf den unmittelbaren Zugang zum alteritären Gegenstand angewiesene Begründung, sei es aus mangelnder Reflexion ihrer Prämissen oder schlicht Verlegenheit und Scheu vor einem eigenen ästhetischen Urteil. Stattdessen vertiefte die Forschung die Kluft zwischen ‚Klassikern‘ und ‚Epigonen‘, indem sie zum einen ihre Aufmerksamkeit auf Erstere zentrierte und zum anderen die ‚wissenschaftlichen‘ Gründe einer Abwertung der epigonalen Texte auf Basis einer ästhetischen Logik nachlieferte, die anfangs eine aus der Romantik adaptierte war. So macht Gumbrecht zu Recht auf die „Verschiedenheit der Wertungsgrundlagen“ aufmerksam, die zu einer Revision der ‚Klassiker‘ hätte führen können.6 Die erstaunliche Stabilität des Höhenkamms verdankt sich demgemäß einer kaum hinterfragten Verselbstständigung rund 200 Jahre zurückreichender Urteile, deren Geltung, wenn überhaupt, nur auf eine Weise geprüft wurde, die tautologisch anmutet: Eigenmächtig „reproduziert[e];“ der Kanon „sein ‚Programm‘“.7
II Epigonentum und die mediävistische Germanistik8
Noch vor den Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts, deren Gliederungen und Urteile die mediävistische Germanistik nachhaltig prägten, markierte bereits 1812 Friedrich Heinrich von der Hagen den Zeitraum, der später zu jenem der ‚Staufischen Klassik‘ avancierte. In dem von ihm und Johann Gustav Büsching erarbeiteten ‚literarischen Grundriß‘ stellt sich „der Raum vom zwölften bis sechzehnten Jahrhundert [als] gleichartiges organisches Ganzes [dar], von seiner kräftigen Jugend bis zum Alter und Tode; sodann drängt sich die bei weitem größte Fülle ihrer Hervorbringungen in das zwölfte und dreizehnte, faßt in nur in ein Jahrhundert zusammen“.9 Innerhalb dieser „eigentlichen Blüthezeit des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts“10 fokussierte sich die Kanonfrage der Altgermanistik schließlich,11 neben dem Minnesang mit Walther als seiner einsamen Spitze,12 auf die höfische Epik, zumal den Artusroman,13 in deren Bereich prominent die Brüder Grimm 1815 in der Erstausgabe des Armen Heinrich die drei großen Literaten in den Stand, später kanonischer, Klassik erhoben.14
Wenige Jahrzehnte später setzt Gervinus mit seiner zwischen 1835 und 1842 in fünf Bänden erschienenen Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen nicht nur einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Germanistik als Wissenschaft, sondern prägt zugleich eine neue Form der Literaturgeschichte:15 Diese soll nicht mehr ästhetischen, gar der romantischen Idee eines direkten Zugangs verpflichteten Urteilen folgen, sondern einer quasi ‚objektiven‘ Perspektive des Historikers, der „aller poetischen Producte Entstehung aus der Zeit, aus dem Kreise ihrer Ideen, Thaten und Schicksale“ erklärt und ihren „Wert“ auf Grundlage der „Ursachen ihres Werdens und ihre[r]; Wirkungen nach […] beurtheilt.“16 Dass er mit diesem Verfahren letztlich ebenfalls zum Befund einer Blütezeit um 1200 kommt, scheint ihm wenig verwunderlich, denn die Urteile würden – sofern sie korrekt gefällt sind – immer übereinstimmen: „Ich bemerke übrigens noch, daß das Endurtheil des ästhetischen und das des historischen Beurtheilers, wenn beide in gleicher Strenge zu Werke gingen, immer übereinstimmen wird; es rechne nur jeder auf seine Weise richtig, die Probe wird die gleiche Summe ausweisen.“17 Dieses historische wie ästhetische ‚Endurtheil‘ des frühen 19. Jahrhunderts blieb seinem Namen in der gesamten ‚vorwissenschaftlichen‘ Phase der Germanistik gerecht, so etwa bei Wackernagel, der vom „glanzvollen Gipfel“ von einer „Zeit der Edlen“ spricht,18 und bestimmte gerade über die Selektion der zu edierenden Texte auch die weitere Ausrichtung der Forschung.19 Indem zunächst überwiegend Texte jener angenommenen ‚Blütezeit‘ ediert wurden, ‚verspäteten‘ sich die meisten ‚Epigonen‘ aus wissenschaftshistorischer Perspektive ein zweites Mal, eine dritte Verspätung sollte mit Blick auf die interpretatorische Werkerschließung folgen.
Wohl auch vor dem Hintergrund des zunehmend in den Geisteswissenschaften spürbaren Legitimationsdrucks gegenüber naturwissenschaftlichen Verfahren und der vermeintlich höheren Evidenz quantifizierbarer Ergebnisse entwickelt Scherer in seiner 1879 begonnenen Geschichte der deutschen Literatur ein organizistisches Literaturgeschichtsmodell. Was rund einhundert Jahre zuvor bei von der Hagen noch eher metaphorisch zu verstehen war, bedurfte nun einer nachträglich eingezogenen empirischen Stütze, um Geltung beanspruchen zu können. Mit der Ausarbeitung dieser naturhafte Persistenz reklamierenden Metaphorik einer zyklisch alle sechshundert Jahre wiederkehrenden Blüte (600 / 1200 / 1800) sowie deren jeweiligem Verfall, analog zu Jahreszeiten oder Lebensabschnitten,20 mathematisch umschrieben mit Wellenberg und -tal, bringt er den „Gang unserer Literaturgeschichte […] auf ein merkwürdig einfaches Schema […]: drei große Wellen, Berg und Tal in regelmäßiger Abfolge. Ach, nur zu regelmäßig!“21 Bei einem solchen Geschichtsverständnis bietet sich die Denkfigur des Epigonen geradezu an: Der auf die Blüte folgende Nach-Wuchs kann entsprechend nicht zu voller Größe finden und folgt in ‚Schulen‘ den Klassikern, vornehmlich Gottfried und Wolfram.22 Die gegenüber dem romanischen Raum höher reichende Blüte und den damit einhergehenden, erschöpfungsbedingt jeweils umso gravierenderen Verfall deutschsprachiger Literatur erklärte Scherer sich augenzwinkernd mit dem typisch „Germanischen“, das sich in einem Unvermögen zum Maß-Halten und mathematisch gedacht in besonders heftigem Wellenausschlag zeige.23
Fasste Scherer den Unterschied zum Romanischen also vorwiegend in der qualitativen Intensität, wobei er diesem eine geringere Volatilität zusprach, rangiert es etwa für Weber im Zuge nationalistischer Vereinnahmung neben dem – in seiner der Architekturgeschichte entlehnten Terminologie – „Frühgotischen“ gleichsam nur als Vorläufer einer germanischen „Erfüllung des hochgotischen Stils“24 bei Wolfram. Nach dem Zweiten Weltkrieg schließt man in Westdeutschland weiter an die naturhafte Metaphorik und die mit ihr verbundene Logik von Blüte und Verfall an.25 So bietet exemplarisch Schneider mit dem Postulat einer „ästhetische[n]; Rangordnung“ nach „objektive[m] Maßstab“, die zugleich einer temporal situierbaren „Gesetzmäßigkeit“26 folgt, einen Ansatz, der letztlich als Rückbesinnung auf das Scherer’sche Literaturgeschichtsmodell beschrieben werden kann.27 Anders verhält es sich jedoch bei der Frage nach der Abhängigkeit vom romanischen Vorbild, dem sich die Literatur der Blütezeit nur vorgeblich „völlig verschrieben zu haben scheint“; vielmehr sei die Lyrik „ohne französische Nachhilfe“ ausgekommen, die Romane seien „Vollender französischer epischer Kunst“ und „das Nibelungenlied […] zu Unrecht mit fremden Vorlagen in Beziehung gebracht“.28
Während Geerdts das Epigonentum als – politisch bzw. geschichtlich bedingte – literarische Resteaufwertung des ‚Alten‘ deutet,29 kritisiert Kuhn in den 60er Jahren die bisherige „Trennungslinie zwischen reiner und Gebrauchs-Literatur“30 und hinterfragt damit indirekt zumindest methodisch die literaturhistorische Marginalisierung von Texten abseits des Höhenkamms. Für ihn folge diese „einer gewissermaßen schizoiden Methodik: Die autonome poetische Literatur nehmen sie ganz als ›Dichtung‹, d. h. oft unter dem Anachronismus ältester bis jüngster Geschmacksurteile (Beispiel: ›Epigonentum‹ des 13. Jahrhunderts) – die Gebrauchspoesie und Sachprosa dagegen ganz als Kultur- und Sachgeschichte“.31 Letztlich kommt, wie er selbst bemerkt, jedoch auch seine „historische Reihung […] – abgesehen von der kulturhistorisch erzwungenen Aufwertung der neuen Prosa – doch überraschend nah an das traditionelle Epigonen- und Verfalls-Schema fürs 13. Jahrhundert heran“.32 Dennoch räumt Kuhn den nachklassischen Autoren mit ihrem „Zug zur ›Summe‹“33 die Möglichkeit von Vollständigkeit als eigenem zeitgenössischen „Qualitätskriterium“34 ein. Mit Haugs Postulat einer ‚Entdeckung der Fiktionalität‘ im Sinne eines autonomieästhetischen Experiments von kurzer Dauer wurde der von Kuhn geforderten Aufhebung jener Trennungslinie nicht nur widersprochen, sondern diese sogar noch radikal verschoben. Von ästhetisch wertvollen Texten, die in einem „fiktionale[n]; Prozeß […] eine Sinnerfahrung eigener Art möglich mach[en]“, scheidet er jene mit „unmittelbar[er] […] Lehre“35 als Charakteristikum für die Nachklassik. So scheint es zwar zunächst widersinnig, dass für ihn der Wigalois, noch mit Benecke gesprochen eigentlich ein Text „aus der besten Zeit“36, „einen Gegentyp zum klassischen arthurischen Roman Chrétien-Hartmannscher Prägung dar[stellt]“,37 jedoch ist die Aufgabe eines streng chronologischen Modells zugunsten ästhetischer Wertmaßstäbe vor diesem Hintergrund nur konsequent.38
Etwa 20 Jahre zuvor reklamiert Jauss statt eines „naturhaften“ einen prozesshaften Gattungsbegriff, der sich für ihn in Anführungszeichen manifestiert.39 Anstelle von Blüte und Verfall setzt er die aus seiner Sicht „teleologiefreie Begrifflichkeit des Durchspielens einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten“,40 führt die ‚klassische‘ Einordnung jedoch erneut auf evolutionistische / genetische Strukturmerkmale zurück, wenn er statt Wachstum, Blüte und Verfall eine letztlich wertende Einteilung in evolutive und involutive Strukturen vornimmt, wobei Letztere für ihn als Prozess des ‚Absinkens‘ beschreibbar sind.41 Sofern jedoch „literarische Gattungen ihren ‚Sitz im Leben‘ und damit ihre gesellschaftliche Funktion haben, muß auch die literarische Evolution über das ihr eigene Verhältnis von Diachronie und Synchronie hinaus durch ihre gesellschaftliche Funktion im allgemeinen Prozeß der Geschichte bestimmbar sein“.42 Und somit geraten eventuell gerade solche Texte in den Blick, die ihre epigonale Textsituation reflektieren und verstärkt Auskunft über die „bedeutsame Anfänglichkeit […] einer […] neu sich formierenden Literatur“ sowie deren „kommunikationsstiftende Leistung“ geben.43 In diesem Sinne geht es auch Cormeau nicht darum, einfach „bisher vernachlässigte Autoren aufzuwerten“, sondern um einen „historisch-funktionale[n];“ Gattungsbegriff statt eines „normati[v] überhistorische[n]“.44 In ihrer zumeist charakteristischen Reflexivität verfügten die epigonalen Texte situativ bedingt über eine höhere Aussagekraft über die eigene und die vorgängige „historische Situation“.45 Entsprechend verliert für ihn die ästhetisch orientierte Frage nach „Qualität und Originalität“ gegenüber einem strukturellen Erkenntnisinteresse an Bedeutung, in dessen Zentrum steht, „welche Strukturen die späteren Romane bestimmen, und was Wiederholung und Veränderung von Elementen der vorausgehenden Texte über die Entstehungsbedingungen eines späteren Textes aussagen“.46 Analog hierzu nimmt auch Kern die „literarische Situation“ der Texte des Pleier zum Ausgangspunkt seiner Untersuchungen. So sei der Erwartungshorizont des Publikums maßgeblich: „Lassen sich nicht vielleicht viele Phänomene, die für die Eigenart der Romane des Pleier (und darüber hinaus anderer nachklassischer Artusromane) mit konstitutiv sind, als Reflex bestimmter – vom Autor antizipierter – Publikumserwartungen verstehen?“47
Vor dem Hintergrund einer solchen Aufwertung nachklassischer Texte entstanden in den Folgejahren gehäuft Standardwerke und Editionen, die ihre Relevanz ähnlich wie Cormeau und Kern über deren literarische Situation oder gar das erwachte Interesse der Forschung an ‚Nachklassikern‘ erklären.48 In jüngerer Zeit lenkt Müller die Aufmerksamkeit auf eine mögliche „bedenkliche Folgeerscheinung dieser Tendenz: den häufigen Verzicht auf die Frage nach der Relevanz der Gegenstände, zumal de[n]; Verzicht auf ästhetische Werturteile.“49 Der daraus resultierenden Gefahr neopositivistischer Willkür begegnend fordert er ein, die Selektion des jeweiligen Untersuchungsgegenstands hinsichtlich seiner kulturhistorischen Relevanz und/oder ästhetischen Qualität zu begründen, wobei Letztere gleichermaßen am Faktor interpretatorisch offen gelegter Kohärenz wie auch vor dem Hintergrund zeitgenössischer Wertmaßstäbe zu bewerten sei.50 Dieser wertende Dreiklang biete die Möglichkeit eines stets „lebendigen Rezeptionsprozesses“51 der mittelalterlichen Texte, da er über den Interpreten – als Kohärenzfinder – zu neuen Ergebnissen und damit vor allem auch neuen, nachvollziehbar begründeten ästhetischen Urteilen kommen kann.52
III Epigonalität als Textsituation
Mit den skizzierten Beobachtungen eines Epigonentums, wie es vor allem das 19. Jahrhundert entwirft, also der Zuschreibung (in weitestem Sinne geschichtlich bedingten) literarischen Unvermögens, sollte zunächst die historische Problemlage markiert werden. Auf sie mit einer ästhetischen Umwertung zu reagieren und etwa neue ‚Klassiker‘ und ‚Epigonen‘ zu küren, wäre nun ebenso wenig förderlich wie den Begriff aufgrund seiner anachronistischen Übertragung vom 19. Jahrhundert auf das Mittelalter schlicht aufzugeben. Vielmehr könnte die Epigonalität in Abgrenzung zum Epigonentum – wie von Harms gefordert „stärker deskriptiv“53 – verstanden als Textsituation die Beschreibbarkeit von nicht zwingend chronologisch-wertend zu denkenden Relationierungen ermöglichen. Entsprechend sind diese als Teil einer Situierung zu betrachten, die der Text selbst leistet und die nicht erst literaturhistorisch herzustellen ist. Während Epigonentum eine nicht mehr zeitgenössische, literaturkritische Zuschreibung ist, bezeichnet Epigonalität also ein aus der eigenen Position des Textes resultierendes, produktionsseitiges Vermögen.54 Epigonisch hießen dann solche Verfahren, mit denen der Text dieses Vermögen zur wertenden Relationierung nutzt, deren Konfiguration die spezifische Differenz zu einer schlichten Unterform intertextueller Gefüge begründet. Das Moment der wertenden Situierung aus der Position, ob expressis verbis ausgesprochen oder in der Kombinatorik von Mustern, Normhorizonten und dergleichen sichtbar, ist entscheidend: Hierbei geht es um die textuell erzeugte diskursive Nähe zum Bezugspunkt, die epigonisch noch einmal bekräftigt werden muss, um den intertextuellen Verweis zu übersteigen.55 Entsprechend sind Stoffanleihen aus der Antike in der Regel nicht als epigonische Bezugnahme zu verstehen, während die adaptation courtoise durchaus als epigonisch charakterisiert werden könnte.56
Die Folgen einer solchen Konzeptualisierung werden besonders am prominenten Beispiel Gottfrieds von Straßburg deutlich, dessen unzählige Male besprochener Literaturkatalog anlässlich der zu beschreiben anstehenden Schwertleite Tristans ebenfalls mit Blick auf Epigonalität gedeutet werden kann.57 Immerhin verfährt Gottfried epigonisch, indem er eine Tradition inszeniert,58 wenn er sich auch nur einreiht, um „selbst“ den Platz als „Höhepunkt und Erfüllung des Kanons“ zu beanspruchen: „Der Klassiker konstruiert seine Klassik.“59 Dass diese Strategie im Umgang mit der eigenen Epigonalität auch hätte misslingen können, zeigt das Beispiel Rudolfs von Ems, der in seinem Alexander ganz ähnlich epigonisch verfährt, damit jedoch „im 19. und 20. Jahrhundert weniger Glück“60 hatte. Während man beim einen das Spiel mit der Selbststilisierung als Epigone durchschaut hat, schenkte man dem anderen nur zu gern naive Zustimmung zum subtil unterlaufenen Bescheidenheitstopos.
Doch epigonische Verfahren können auch weniger explizit ausfallen. Ein gutes Beispiel liefert Lutwins als Eva und Adam gehandelte Adamsvita aus dem 14. Jahrhundert. In Elias von Steinmeyers Rezension zur Erstausgabe von 1881 heißt es über den Dichter, dass er „in hohem masse […] von Wirnt von Gravenberg abhängig ist. von diesem hat er den stumpfen, seltener klingend ausgehenden dreireim als schluss der 82 ungleich grossen abschnitte entlehnt“ und darüber hinaus „sowol umfängliche partien als einzelne worte und phrasen erborgt“.61 Daraufhin listet der Rezensent auf gut fünf Seiten die mitunter „ungeniert[en]“ Anleihen am Werk „seines Vorgängers“62 (sowie an der Marienhimmelfahrt Konrads von Heimesfurt) auf, um zum Fazit über den Dichter – allerdings gerade nicht über die Herausgeber, denen er trotz einiger Versäumnisse mittelmäßige Leistung bescheinigt – zu kommen: „Zieht man von Liutwins leistung ab was er diesen seinen vorbildern verdankte und was er seinen lateinischen quellen entnahm, so bleibt in der tat nur ein armseliger rest übrig.“63 Mit Blick auf die Forschungspraxis des ausgehenden 19. Jahrhunderts mag dieses Beispiel beliebig wirken, doch lässt sich die Akribie von Steinmeyers für eine mögliche Deutung des Werkes nutzbar machen, wenn man von seinen Prämissen absieht. Perspektiviert man die Übernahmen im Kontext einer „heiklen Konkurrenz höfischer Romane“,64 der sich bibelepisches Erzählen um 1300 ausgesetzt sah, lässt sich hier eine epigonische Strategie im Umgang mit dieser vermuten. Markant wird dies im Prolog, der stellenweise fast wörtlich dem Wigalois folgt:
|
Wigalois |
Eva und Adam |
|
Swer nâch êren sinne, |
|
|
triuwe und êre minne, |
|
|
der volge guoter lêre – |
Und volgen [wir] wyser lere, |
|
daz vürdert in vil sêre – |
Das fristet lip, güt und ere, |
|
unde vlîze sich dar zuo |
Und flissen uns darzü, |
|
wie er nâch den getuo |
Wie unser jegelicher getü |
|
den diu werlt des besten giht, |
Nach dem, do man des besten giht, |
|
und die man doch dar under siht |
Und den, man doch darunder siht, |
|
nâch gotes lône dienen hie; |
Leben nach gottes lere, |
|
den volge wir, wan daz sint die |
Dem volgen wir, wann das ist der, |
|
den got hie sælde hât gegeben |
Dem got die selde hat gegeben |
|
und dort ein êwiclîchez leben; |
Und dort das ewige leben. |
|
dar nâch wir alle sulen streben.65 |
Das ist wol und reht geton, |
|
Es ist der welte ein selig man, |
|
|
Wer nach gottes leben will, |
|
|
Der müsz ouch der welte spil |
|
|
Lossen, als ich mich versynne. |
|
|
Nü wer mag der welte mynne |
Details
- Seiten
- 346
- Erscheinungsjahr
- 2020
- ISBN (PDF)
- 9783631816875
- ISBN (ePUB)
- 9783631816882
- ISBN (MOBI)
- 9783631816899
- ISBN (Hardcover)
- 9783631797211
- DOI
- 10.3726/b16743
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (April)
- Schlagworte
- Fachgeschichte Geschichte der Mediävistik Literaturgeschichtsschreibung Literaturgeschichte Klassik Intertextualität Originalität Nachahmung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 346 S., 2 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG