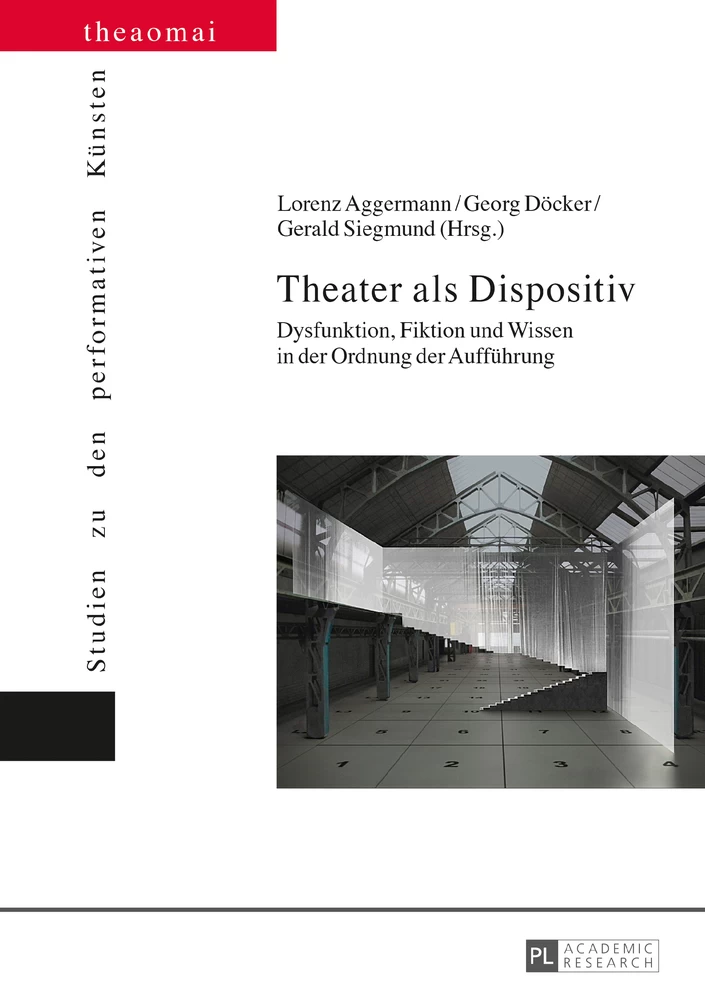Theater als Dispositiv
Dysfunktion, Fiktion und Wissen in der Ordnung der Aufführung
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Die Ordnung der darstellenden Kunst und ihre Materialisationen. Eine methodische Skizze zum Forschungsprojekt Theater als Dispositiv (Lorenz Aggermann)
- Die Performance in ihrem Element (Dirk Baecker)
- Antike und moderne Konfigurationen
- Theater als Dispositiv der Demokratie. Foucault liest Euripides (Andreas Hetzel)
- Das Dispositiv und das Unregierbare. Vom Anfang und Fluchtpunkt jeder Politik (Nikolaus Müller-Schöll)
- Was einem Dispositiv notwendig entgeht, zum Beispiel Kleist (Ulrike Haß)
- Anomalie und Dysfunktion der Ordnung
- Theorie-Szenen: Eine (Wieder-)Aufführung (Petra Löffler)
- Was ein Dispositiv nicht ist: Archäologie der Norm bei Foucault, Canguilhem und Goldstein (Matteo Pasquinelli)
- Dispositive als strategische Ordnungen … und ihr Nicht-Scheitern-Können am Beispiel von Stanley Kubricks Dr. Strangelove (Mirjam Schaub)
- Zeitgenössische Konstellationen
- Theater als Dispositiv: Eine Alternative zum ideologischen Vorhang? (Yannick Butel)
- Aspekte des Scheins im Dispositiv der Aufführung (André Eiermann)
- ‚Ausweitung der Kunstzone‘. Das szenographische Dispositiv in den Künsten der Gegenwart (Birgit Wiens)
- Akute Notstände
- Dispositive im Notstand? Experimentelle Ensembles zwischen Theater und Wissenschaft (Alexander Jackob)
- Der radikale Einsatz (in) der zeitgenössischen Performance. Das Dispositiv der De-Subjektivierung (Bojana Kunst)
- Theologie und Dispositiv. Hermeneutische Überlegungen zu einem komplexen Zusammenhang am Beispiel der Sünde (Christian Berkenkopf)
- Biographien
- Reihenübersicht
Abseits von Aufführung und Analyse
Die Frage, was im Zentrum des Faches Theaterwissenschaft zu stehen hat, und die Bemühungen, den Gegenstand der darstellenden Kunst zu definieren, erscheinen heute dringlicher denn je: Die weitere Entgrenzung des offenen Kunstwerks sowie intermediale und hybride Formen führen nicht selten dazu, dass Kunst respektive ihre Aufführung „durch ihre unklaren Grenzen zur nichtästhetischen Lebenswelt noch nicht einmal mehr als objektiv Bestimmtes gegeben ist.“1 Doch womit hat es die Theaterwissenschaft dann zu tun – sofern man eine ihrer Aufgaben in der Beschäftigung mit gegenwärtiger darstellender Kunst sieht? Eine mögliche, recht pointierte Antwort auf diese Problemlage definiert die zeitgenössische (darstellende) Kunst als einen ideologischen Schwindel, dem auch die Philosophie und jede weitere Wissenschaft zwangsläufig anheim fällt. Der Versuch einer genauen Bestimmung ihres Wesens wäre demnach geradewegs jener Effekt, den die zeitgenössische Kunst hervorruft, wohl wissend, dass eine solche unmöglich ist.2 Damit ist einer wissenschaftlichen Disziplin, die sich nicht zuletzt aufgrund der Entgrenzung der Kunst mit anderen Fächern messen und in ihrer Methodik vergleichen lassen muss, wenig geholfen. Das Bedürfnis, den Gegenstand des Faches mehr oder weniger konzise zu bestimmen, lässt jedoch übersehen, dass mit jedweder noch so allgemeinen Definition bereits eine Setzung Hand in Hand geht, die auch das mögliche Wissen über diesen Gegenstand entscheidend reglementiert und restringiert. Nachgerade im Zeitalter hybrider Kunstformen und ← 7 | 8 → Formate erweist sich die methodische Fokussierung auf die Aufführung und ihre ontologische Definition, wie sie beispielsweise in Analogie zu den exakten und objektiven Wissenschaften vorgenommen wird, als kurzlebig oder im eigentlichen Sinne als historisch, fasst eine derartige methodische Engführung doch stets nur einen momenthaften, instantanen Teil des Phänomens Theater und seiner Erscheinungsweisen.3 Problematisch ist darüber hinaus, dass die Konturierung und Erörterung dieser theoretischen Setzung an einem bestimmten, wohl überlegten und analysierten Beispiel, wie sie nun schon einige Jahre gängige Praxis im Fach ist, die Kunst respektive ihre Materialisation ohne ihre genealogische und institutionelle Verankerung als ästhetische Singularität bewertet, wie insbesondere die Bemühungen um eine neuartige Phänomenologie des Theaters zeigen.4 Die Analyse der Aufführung gleicht infolge nicht selten einer selbsterfüllenden ← 8 | 9 → Prophezeiung, wird doch am Beispiel oft nur das erkannt und ausgewiesen, was der begriffliche Apparat und die damit einhergehende Methode zulässt.
Mehr noch prägt die Fokussierung auf ein methodisches Zentrum in nicht unerheblichem Ausmaß ebenjenen Gegenstand, den es ursprünglich zu erörtern und zu befragen gilt, wird doch das Objekt der Wissenschaft zumeist erst durch die Wissenschaft selbst theoretisch und experimentell konstruiert.5 Eine derartige Methodik erweist sich im besten Sinne als performativ – sie produziert in ihren Diskursen sowohl ihren Gegenstand als auch die davon abgeleiteten Ergebnisse und Erkenntnisse und erhebt das bloße Zuschauen zur eigentlichen Kunst.6 Das mag zwar durchaus in der Logik des Faches liegen und entsprechend pointierte, kritische Kommentare evozieren, erweist sich aber nachgerade dann als Problem, wenn sich theaterwissenschaftliche Erkenntnisse mit jenen aus anderen Disziplinen messen lassen müssen, wie es gegenwärtig verstärkt der Fall ist.
Doch auch für das Fach selbst birgt diese Konzentration auf die Aufführung als methodisches Zentrum eine eigentümliche Paradoxie, wird doch im Diskurs der Theaterwissenschaft gerne jenes (ideelle) Theater als besonders bedeutend ausgewiesen, das nicht zur Aufführung gelangt, schlicht, weil es nicht in den vorgegebenen institutionellen Rahmen passt und keine Form gefunden hat. Theorie und Methode stellen sich derart über und vor allem vor die Erfahrung von Kunst, um ein abstraktes Forschungsobjekt sowie wissenschaftliche Plausibilität und Objektivität zu gewinnen. Schon der Rekurs auf ein geringfügig anderes Beispiel kann eine derartige methodische Setzung und ihre Definition ihrer überzeugenden Kraft berauben, respektive ihre intentionale und fallweise auch ideologische Begrenztheit zum Vorschein bringen. Entsprechend wird, kaum ist eine derartige Setzung und Definition vorgenommen, allerorten berechtigte Kritik an dieser geübt. ← 9 | 10 → 7
Doch wie ließe sich das, was gemeinhin als Theater behauptet und erfahren wird, theoretisieren, um diesem epistemologischen Problem zu entkommen, das die Theaterwissenschaft durchaus mit anderen, der Kunst gewidmeten Disziplinen teilt? Rückt man von der Vorstellung von Theater und seiner Aufführung als einem gegebenen Gegenstand ab und versteht es unter epistemologischen Prämissen als ein historisches Phänomen, das erst in seiner Vermessung konturiert oder gar produziert wird,8 so ergeben sich andere Fragen, die infolge womöglich im Zentrum einer zeitgenössischen Theaterwissenschaft zu stehen haben – nicht jene nach dem ontologischen Status der Aufführung oder der Kunst, sondern jene nach ihrer epistemischen und dispositivischen Verfasstheit: Was weiß die darstellende Kunst und ihre spezifische Ordnung, und mehr noch, was lässt uns ihre Rezeption wissen? Welche Elemente finden darin Eingang, welche Beziehung haben diese zueinander, zu den Beobachtenden, zu anderen Ordnungen? Welche Dynamiken sind innerhalb dieser Beziehungen am Werk, und in welcher Konstellation materialisieren sich diese Elemente und Beziehungen? Wer oder was regiert die Ordnung der Aufführung? Und vor allem: worauf antworten das je spezifische Dispositiv Theater respektive seine Materialisation in der Aufführung?
Diese Fragen versuchen das Theater als eine epistemische Ordnung und infolge als ein Dispositiv zu verstehen. Damit wird ein Modell zur Theoretisierung vorgeschlagen, in dessen Rahmen sowohl konzipiertes und realisiertes, vergangenes und künftiges Theater reflektiert werden kann, das der komplexen Zeit und Räumlichkeit der darstellenden Kunst gerecht zu werden sucht, und das den Gegenstand des Faches nicht nur in einer konkreten Aufführung, sondern in jeder (un)möglichen, notwendigen Materialisation eines theatralen Dispositivs sieht.
Dieser Ansatz versucht, das Theater in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen und damit dem wissenschaftlichen Diskurs auch jene fiktive und ideelle, utopische Dimension von Theater zu erschließen, die nicht selten den Rahmen einer Aufführung sprengt, weil sie sich nicht konkretisieren und materialisieren lässt. Umgekehrt rückt durch diesen Ansatz nachgerade die institutionelle Verankerung und Genealogie jedweder realisierten Aufführung unweigerlich in den Fokus, wird ← 10 | 11 → doch die Ordnung der Aufführung entscheidend von deren Dynamiken – von ihrem Dispositiv – bestimmt. Das Modell Dispositiv erlaubt somit ergänzend zu der von der Kunst eingeforderten, aber immer wieder scheiternden ontologischen Definition eine umfassende Historisierung und Relationierung ihrer gegenwärtigen und künftigen Erscheinungsweisen und Formationen.
Sein maßgebliches Fundament findet dieses Modell in der Epistemologie Michel Foucaults und im Begriff Dispositiv, der seine Schriften als latentes Konzept durchzieht und für Foucault einen allgemeinen Fall der Episteme, also einer spezifischen Anordnung darstellt.9 Der Begriff Dispositiv, der im Französischen recht gebräuchlich ist und mit Werkzeug, Gerät, Maßnahme, Vorrichtung, Apparat oder Modell übersetzt werden kann, steht hierbei für eine offene Ordnung, die je nach Zeiten und Räumen aus unterschiedlichen Elementen besteht, die wiederum je spezifisch konstelliert sind und gerade in ihrer Offen- und Unabgeschlossenheit die wesentliche Funktionsweise eines Dispositivs bestimmen. Anders als beispielsweise ein Mechanismus oder Apparat – Termini, mit denen der Begriff Dispositiv ebenfalls immer wieder übersetzt wird und die stärker auf technische oder kausal-logische Verknüpfungen abheben – versteht sich das Dispositiv als eine abstrahierte Ordnung, die nach bestimmten, indes nicht immer durchschaubaren Regeln funktioniert.
Vor dem Hintergrund der Abstraktion und Verallgemeinerung darf allerdings nicht übersehen werden, dass der Begriff Dispositiv eine stark alltägliche Konnotation zeitigt, was nicht zuletzt darauf hinweist, dass sich jedes Dispositiv konkretisieren, oder materialisieren muss, wie Louis Althusser festhält: Aus jedem Dispositiv „ergibt sich völlig natürlich das (materielle) Verhalten“ seiner Elemente.10 Letztlich wird immer etwas Bestimmtes disponiert, muss sich ein Dispositiv ← 11 | 12 → immer materialisieren. Andernfalls bleiben seine Kräfte und Wirkungen leere Behauptung. Trotz seiner Abstraktion zeigt sich ein Dispositiv folglich in einem begrenzten und konkreten Rahmen, in einer bestimmten Materialisation – als ein bestimmtes Dispositiv.11 Gerade diese Notwendigkeit zur Materialisation legt es nahe, Kunst als ein spezifisches ästhetisches Dispositiv zu verstehen: Da Kunst, weder als Werk noch als Aufführung, Ereignis oder performativer Akt ontologisch zu fassen ist, beruht sie zwangsläufig auf der Materialisation einer ihr vorangehenden, konzipierten Ordnung.12 Versteht man nun Theater als ein derartiges ästhetisches Dispositiv, dann ist die Aufführung eine mögliche und zugleich notwendige Materialisation dieser Ordnung.
Im Fach nun voll und ganz auf die Analyse der Aufführung abzuheben und sie zu einem singulären Ereignis zu stilisieren, zielt demnach am eigentlichen Wesen des Gegenstandes und am Modell Dispositiv vorbei. Zu fragen wäre, wie die theoretische Arbeit mit diesem Modell zu bezeichnen wäre, worin sie sich von semiotischen, strukturalistischen oder phänomenologischen Analysen abhebt und ob sie denn überhaupt eine Form der Analyse darstellt? Dass aus der Beschreibung eines Dispositivs nicht unbedingt seine elementaren Konstruktionsprinzipien oder all seine Elemente hervorgehen, zählte schon für Jean-François Lyotard zu den Vorteilen dieses Konzepts, weshalb er auch dezidiert von dem Begriff der Analyse in diesem Zusammenhang abgeraten hat.13 Eine Analyse verlangt einen realen, festgestellten Gegenstand (selbst wenn dieser als ephemer definiert wird), während durch das Modell Dispositiv – nicht nur für Lyotard – gerade die kontingenten Elemente wie die zeiträumlichen Dynamiken, die Beziehungen, die Strategien oder das Kalkül dieser Anordnung zur Sprache gebracht werden sollen. Darüber hinaus rechnet dieses Modell auch den wissenschaftlichen Diskurs und die Erörterung des Gegenstands selbst den Elementen eines Dispositivs zu. Damit wird indes nicht, wie im Falle der Phänomenologie, der Abstand zwischen dem Gegenstand und der Betrachtung aufgehoben, viel eher wird deren ← 12 | 13 → Verhältnis abermals gewendet und gleich einer Matrix einer weiteren Schichtung und Reflexion unterzogen. Wie verhält sich der fachliche Diskurs und seine Epistemologie zum Gegenstand, wie determiniert dieser wissenschaftliche und auch essayistische Diskurs das Dispositiv Theater? Mit dieser Potenzierung geht ein großes Versprechen für die gegenwärtige Kunsttheorie und -philosophie einher: „Scheinbar heterogene Phänomene werden so mit einem Begriff gefasst, der die klassische Subjekt/Objekt-Opposition ebenso überwindet wie die hermeneutische Zentrierung auf Kunstwerke.“14
Als theoretisches und epistemologisches Modell hat das Dispositiv seine Genealogie vor allem im Denken von Gaston Bachelard und Georges Canguilhem, deren Theoreme immer wieder die Schriften Foucaults durchziehen, vor allem wenn es darum geht, nachzuweisen wie eine Methode, sei es als Instrument, sei es als diskursive Prämisse oder als Episteme, den wissenschaftlichen Gegenstand determiniert.15 Darüber hinaus ist das Dispositiv als Modell nicht ohne die weiterführenden Kommentare und Adaptionen von Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jacques Rancière und nicht zuletzt Giorgio Agamben anzuwenden, deren Thesen sich weniger der Grundlage denn der Binnenlogik des Dispositivs widmen, um den zeitgenössischen wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch den gegenwärtigen ästhetischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Eine Erwähnung am Rande verdient in diesem Kontext auch Jean-Louis Baudry, der den Begriff Dispositiv in den beginnenden 70er Jahren in den filmwissenschaftlichen Diskurs einbringt, dessen medientheoretische Schriften allerdings primär den technischen-psychologischen Apparat des Kinos beschreiben und stark der Althusserschen Konzeption folgen.16 Auch im Feld der Theaterwissenschaft gibt es mittlerweile eine Handvoll Arbeiten, die dieses Modell aufgreifen oder eine große Ähnlichkeit zu diesem aufweisen, so beispielsweise die bereits erwähnte Studie ← 13 | 14 → André Eiermanns, das Theatralitätsmodell von Rudolf Münz und dessen Adaption durch Andreas Kotte oder Stefan Hulfeld, aber auch die Arbeiten von Ulrike Haß und jüngst von David Roesner oder Birgit Wiens,17 die trotz methodischer Ähnlichkeit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Doch was besagt dieses Modell, wie lässt sich mit ihm operieren? Ausgangspunkt von Foucaults epistemologischen Überlegungen, die von der (An)Ordnung zum Dispositiv führen, ist die einfache Idee, dass Wissen nichts anderes heißt, als Dinge zu ordnen.18 Objekte und Körper, aber auch Diskurse sowie Bewegungen und Affekte, Materielles und Immaterielles – Foucault spricht von einem „multiplen Gewimmel“19 – können, ja müssen gleichsam in einer Ordnung zusammengefasst werden, da sich nur aus dieser Wissen ergibt. Die Konstellation ist das Wissen. Dieser Ansatz zeitigt allerdings zwei markante Probleme: Die so unterschiedlichen Dinge bleiben inkommensurabel, entsprechend muss sich auch deren Klassifikation und das gewonnene Wissen als variabel und als fehlerhaft erweisen. Bei jeder Ordnung fallen die Heterogenität und die Unvereinbarkeit ihrer Elemente auf, da die Dinge nur durch „die immaterielle Stimme, die ihre Aufzählung vollzieht“20, aufeinander bezogen sind. Jede Ordnung generiert somit vor allem ein paradoxes Wissen, das sich auf Brüche und utopische Setzungen, auf Dysfunktion (Fehler) und Fiktion (zu deren Lösung) gründet und nur qua einer übergeordneten Stimme funktioniert. Dysfunktion und Fiktion gehören somit grundlegend zu jeder Form von Wissen. Erstere erweist sich als ein unumgängliches epistemologisches Faktum, zu dessen Überwindung notwendig die Erfindungsgabe in Anspruch genommen werden muss.21 Dysfunktion und ← 14 | 15 → Fiktion markieren somit einen epistemologischen Bruch, der sich in der Wissensgenese immer wieder zwischen ontologischer Bestimmung und historischer Relationierung auftut und der in einer jeden Ordnung von Dingen evident wird. Fällt der Fehler auf die Seite der Ontologie, so ist seine fiktionale und kreative Überwindung nicht ohne ihre historische Relationierung zu verstehen. Folgt man Foucault, so bleibt diese inkongruente und mangelhafte Methode zur Wissensgenese alternativlos, da es zweifelsohne besser ist, mit einer fehlerhaften Ordnung als in einem gesetzlosen Raum zu leben.22 In dieser Bruchstelle einer jeden Epistemologie liegt indes auch ein wesentliches Versprechen. Maßgeblich für jede Form von Wissen ist also nicht so sehr das scheinbar erkannte factum brutum, sondern die der Ordnung inhärente Paradoxie aus Dysfunktion und Fiktion sowie die ihr ebenfalls inhärenten Grenzen: einerseits gibt es die verdeckte Ordnung der Ordnung und somit etwas, das Giorgio Agamben in seiner Lesart des Dispositivs als Strategie radikal betonen wird.23 Andererseits ist es das menschliche Subjekt, das sich, wie alle anderen Elemente der Ordnung, als über- respektive unterdeterminiert gegenüber diesen erweist, da es gleichsam Subjekt und Objekt der Ordnung ist. Von ihm gehen die Strategie und das Wissen partiell aus, zugleich wird es zum Ziel der verschiedenen Strategien und Kalküle und kann folglich nur bedingt durchschauen, was letztlich die Instanz der Ordnung ist, was die Objekte und Subjekte regiert. ← 15 | 16 →
Die Kunst im Wissen
Die Übertragung dieses Ansatzes auf das Theater und auf die Kunst liegt nahe. Auch Foucault greift zu seiner Explikation immer wieder auf Beispiele aus Kunst, Literatur und Theater zurück. Sein Prinzip der Ordnung, das heißt der dysfunktionalen und fiktiven Konstellation von über- respektive unterdeterminierten Elementen, legt Foucault vorderhand an einer Erzählung von Borges – also am Beispiel der Literatur – dar.24 Und auch das Modell des Dispositivs wird vor allem in den späteren Studien, die dem Verhältnis von Sexualität und Wahrheit gewidmet sind, nicht nur anhand der historischen Medizin und Biologie, sondern vor allem vor dem Hintergrund dramatischer, literarischer und anderer ästhetischer Werke expliziert. Neben den Dramen von Euripides und Sophokles kommt beispielsweise auch das Traumbuch des Artemidor zur Sprache. „Es scheint, als trete [Foucault] (bis in unsere Gegenwart hinein) als ein Denker mit zwei Gesichtern auf: er zeigt uns das etablierte Gesicht mit der Maske der Wissenschaftsgeschichte und das subversive Gesicht mit der Maske der literarisch-künstlerischen Avantgarde. […] Dieses Doppelgesicht zeigt bis heute ein aktives Denken, welches an der heterotypen Grenze zwischen Wissenschaften und Kunst, Wahrheit und Fiktion, Wissen und Macht sichtbar wird.“25 Foucault greift immer wieder auf Theater, Literatur als auch auf die Kunst im Allgemeinen als Quellen zurück. Es ist also nicht nur das alltägliche, sozialpolitische Leben und seine Geschichte (und die Frage, in welcher Praxis sich dieses niederschlägt), welche das maßgebliche Substrat für sein Denken und sein epistemologisches Modell bildet, sondern vor allem auch die Kunst.26 Insofern liegt die Übertragung dieses Konzepts auf das Theater mehr als nahe, obgleich Foucault das Theater nie explizit als Ordnung oder als Dispositiv beschreibt. Konstituiert sich nicht auch die Aufführung aus einer heterogenen und inkommensurablen Vielfalt von Elementen? Erweist sich nicht jede Aufführung als eine spezifische, konkretisierte und materialisierte Ordnung von Dingen? Ergeht nicht aus deren Konstellation eine spezielle, zu reflektierende ästhetische Erfahrung, die durchaus mit Wissen vergleichbar ist – sofern dem Wissen auch eine affektive Dimension zugestanden wird respektive der Affekt (gleich ob als Störung oder als Begehren) als ein initialer Moment der Wissensgenese verstanden wird? ← 16 | 17 →
In der zweiten Hälfte der 1970er verwendet Foucault verstärkt den Begriff Dispositiv, womit auch eine maßgebliche Erweiterung seiner Epistemologie einhergeht. Auch das Dispositiv wird von ihm als ein „entschieden heterogenes Ensemble“27 gefasst, das diskursive und nicht-diskursive Phänomene, „Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes“28 beinhaltet. Es ist weniger die Rejustierung des Modells auf Nichtdiskursives, Materielles und Tätigkeiten, mithin Praxen, die das Dispositiv vom Konzept der Ordnung unterscheidet. In der Neukonzeption verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der Heterogenität und Inkommensurabilität der Elemente auf ihre Ausrichtung und Anordnung, auf ihre Konstellation und Dynamik. Der Begriff Dispositiv soll primär die Verbindung zwischen diesen Elementen deutlich machen und die Ordnung als eine dynamische und energetische Konstellation fassen, die sich zu einer bestimmten Zeit ausbildet, um ein Problem in gesellschaftlichen und kulturellen Ordnungen zu lösen. Damit werden vor allem die Kräfteverhältnisse einer Ordnung und ihre Lenkung bedeutsam. Foucault beschreibt das Dispositiv als eine „Formation, deren Hauptfunktion zu einem historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten.“29 Es reagiert mittels seiner Dynamik auf die Dysfunktionalität einer Anordnung, manipuliert Dinge und deren Verhältnis untereinander zu einem bestimmten Zweck. Dispositiven kommt somit ein intentionaler, strategischer Charakter zu. In ihnen tritt vornehmlich das hervor, was die Ordnung der Dinge regiert. Foucault spricht interessanterweise von einer „funktionellen Überdeterminierung“30 des Dispositivs, das sich ständig rejustieren muss. Elemente, die ins Dispositiv eingehen, um als bestimmte hervorgebracht zu werden, werden nie ausschließlich durch ihre Verwendung im Dispositiv definiert, sonst wären sie verbraucht, verschwänden mit Ende des Problems, auf welches das Dispositiv eine Antwort darstellt. Vielmehr vektorisiert das Dispositiv seine Elemente auf ein Ziel, eine Bestimmung hin. Offen bleibt indes, wer im Dispositiv als entscheidende Instanz firmiert, von wem die Strategie ausgeht.
Ein Dispositiv ist kein geschlossenes System, keine endgültig fixierte Ordnung. Denn auch die von ihm hervorgebrachten, das heißt strategisch vektorisierten und materialisierten Elemente wie beispielsweise Stimmen, Worte oder Körper, sind stets mehr oder weniger als das, als was sie hervorgebracht werden. So entstehen, aus einem intrinsischen Kalkül heraus, das ebenso wie die Strategie das Dispositiv ← 17 | 18 → regiert, Sollbruchstellen und Spielräume, die Gilles Deleuze in seiner Lesart des Dispositivs, das er Diagramm nennt, als Fluchtlinien zur kreativen Öffnung und Veränderungen hervorgehoben hat.31 Gäbe es sie nicht, wäre das Dispositiv, wie Agamben betont, identisch mit purer Gewaltanwendung.32
Überträgt man nun das Modell des Dispositivs auf das Theater, so ist zunächst ein vermeintlicher Widerspruch festzuhalten, der aus der Verbindung von Kunst und hier vor allem Theater und dem Gedanken des Dispositivs hervorgeht.33 Verspricht Kunst und die mit ihr verbundene ästhetische Erfahrung stets ein Moment der Freiheit, steht das Konzept des Dispositivs zunächst für Einschränkung und zielgerichtete Problemlösung. Kunst und Dispositiv haben jedoch in der Wirkung, die sie evozieren, und die sich als normative oder als ästhetische preisgibt, einen gemeinsamen Nexus. Nicht selten fallen beide zusammen, geht die ästhetische Wirkung mit einer Normierung einher. Sowohl Kunst als auch Dispositive sind entsprechend keine abstrakten Denkfiguren, sondern materialisieren sich und wirken dergestalt subjektivierend nach: Architektur und Stadtplanung, Betriebsanleitungen oder Gesetzesvorlagen, Ausstellungen und Aufführungen lassen uns die Kräfteverhältnisse und Spannungen eines bestimmten Dispositivs konkret erfahren und uns überwiegend im Rahmen ihrer Fluchten agieren. Doch während in den Dispositiven des Alltags die Über- respektive Unterdeterminiertheit der zugrunde liegenden Elemente Störungen hervorruft und Reaktionen, häufig auch Sanktionen evoziert, sorgen die daraus resultierenden Dysfunktionen und Anomalien im Rahmen der Kunst für eine entscheidende Qualität. Kunst weiß sich diese in und als Fiktion zu nutze zu machen: die theatrale Spaltung von Blick und Gehör oder das urbanistische dérive, aber auch Kleists nicht festgestelltes oder Artauds grausames Theater und die Experimente der Neo-Avantgarden der 1950er und -60er,34 sowie zahlreiche weitere ästhetische Praktiken und Utopien normieren und regulieren weniger ihre Subjekte, sondern generieren qua Dysfunktion und Fiktion eine Eigengesetzlichkeit und eine Erfahrung, die der Kunst einen anderen Wert verleiht, nachgerade weil sich das Subjekt darin erst positionieren muss.
Details
- Seiten
- 278
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (PDF)
- 9783631713761
- ISBN (ePUB)
- 9783631713778
- ISBN (MOBI)
- 9783631713785
- ISBN (Hardcover)
- 9783631713679
- DOI
- 10.3726/b10470
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Januar)
- Schlagworte
- Theaterwissenschaft Theaterhistoriographie Michel Foucault Performance Subjektivierung Zeitgenössische Kunst
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 278 S., 6 farb. Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG