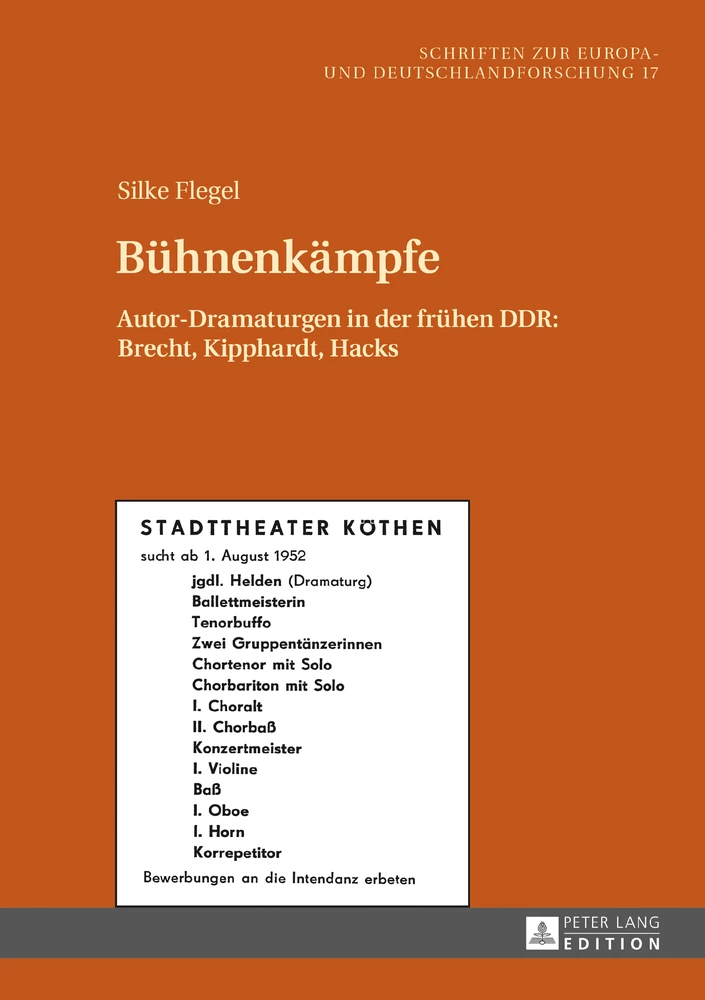Bühnenkämpfe
Autor-Dramaturgen in der frühen DDR: Brecht, Kipphardt, Hacks
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autoren-/Herausgeberangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Die Legende vom „Dramaturgenstaat“
- Forschungsstand
- Die Funktion des Dramaturgen
- … im 18. Jahrhundert
- … im 19. Jahrhundert
- … im 20. Jahrhundert
- Autor und Dramaturg in der frühen DDR
- Bertolt Brecht: Stückeschreiber, Dramaturg, Regisseur, Musiker und Bühnenbauer
- Bertolt Brecht – ein Dramaturg?
- Eine „Gratwanderung zwischen künstlerischer Autonomie und politischem Engagement“
- Heinar Kipphardt: „verantwortlicher Politkommissar für den Spielplan“
- Shakespeare dringend gesucht. Ein satirisches Lustspiel in drei Akten
- Hintergründe und Kontexte
- Ortswechsel I – Die Übersiedlung
- Ortswechsel II – Wege zum Weggang
- Peter Hacks: Goethe-Verehrer und Ulbricht-Anhänger
- Die Sorgen und die Macht. Stück in fünf Aufzügen
- „Ich interessiere mich nicht für Theater.“
- Die Denkfigur Autor-Dramaturg – Perspektiven
- Literatur
- Dank
- Reihenübersicht
Die Legende vom „Dramaturgenstaat“
Der Autordramaturg: ein glücklicher Mensch
John von Düffel1
Zu den unzähligen Legenden, die sich um die DDR-Kultur ranken, gehört unzweifelhaft auch diejenige von der Existenz eindeutig zu vieler Dramaturg/-innen2 an allen Orten, von der DDR als Dramaturgenparadies also, in welchem zu leben durchaus erstrebenswert gewesen sei. So soll etwa ZK-Mitglied Hans Rodenberg einmal geäußert haben, „Dramaturgen täten nie viel, er könne das beurteilen, denn er sei selbst einmal Dramaturg gewesen.“3 Und tatsächlich beschert der Blick in die Archivakten dieser Legende einen durchaus realen Hintergrund und das oft zitierte und viel strapazierte Wort vom sogenannten „Dramaturgenstaat“ DDR lässt sich vielfach nachlesen.4
Auch im großen Kreis der Betroffenen, also der DDR-Dramaturgen, ob nun im Theater, bei der DEFA, beim DDR-Fernsehen oder -Hörfunk beschäftigt, kursierten selbstironische Dramaturgenwitze über den eigenen Berufsstand im „reinen Wohlfahrtsstaat“ (Peter Hacks): „Wer einmal fünf Zeilen geschrieben hat und zu ihnen gekommen ist, um zu klagen, er wisse nicht, wie er leben solle, dem haben sie gesagt: ‚Ach, schauen Sie, dann werden Sie doch Dramaturg bei der DEFA, da haben wir zwar schon 32, warum sollen ← 9 | 10 → das aber nicht 33 sein?‘“5 – die Parteimitgliedschaft des Bittstellers natürlich immer vorausgesetzt.6
Die kleine Anekdote hat Peter Hacks 1990 rückblickend seinem engen Freund André Müller sen. erzählt. Ähnliche Scherze finden sich jedoch in vielen Künstlerbiografien wieder, die einen Ort in der DDR hatten, ebenso wie auch zahlreiche ernsthafte Beschreibungen die große Zahl angestellter Dramaturgen in den Kulturinstitutionen bestätigen.7 Es handelt sich hierbei um ein schlichtes Faktum, das vielfach erinnert wird. So nennt etwa Sibylle Schönemann, bis zu ihrer Inhaftierung 1984 vier Jahre lang Dramaturgin bei der DEFA, konkrete Daten: „Es gibt vier Dramaturgengruppen […]. Zu jeder Gruppe gehören fünf bis sechs festangestellte Dramaturgen, der Hauptdramaturg als ihr Leiter, die Sekretärin sowie der eine oder andere Volontär oder ← 10 | 11 → Praktikant. 27 ‚feste Dramaturgen‘ zählt das Studio“,8 und zwar bei einer DEFA-Jahresproduktion von bescheidenen 16 bis 18 Kinospielfilmen. Darauf dass die vielen Dramaturgen nicht unbedingt alle ihrem Einsatzort und ihrer Position entsprechend speziell ausgebildet und befähigt waren, spielt Peter Hacks bereits an. Und Christoph Schroth, als langjähriger Schauspieldirektor (1974–1989) des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin einer der wichtigsten und populärsten Theatermacher der DDR, bestätigt dies mit den eigenen ersten Schritten ins Theater:
[…] ich ging zum Intendanten [in Leipzig, S. F.] und fragte, ob ich als Regieassistent angenommen werden könnte. Da sagte er, daß ich keine Qualifikation habe; aber es ergab sich die Möglichkeit, am Maxim Gorki Theater in Berlin als Dramaturg für Presse und Werbung anzufangen. Der Chefdramaturg war damals Gerhard Wolfram, Armin Stolper war Dramaturg […]. Ich habe zunächst Programmhefte gemacht, Dramaturgie und bin dann in die Regieassistenz hineingeschlüpft […].9
Offensichtlich fehlte es dem jungen Christoph Schroth zwar an ausreichender Qualifikation für die Position des Regieassistenten in Leipzig, doch für die Dramaturgie in Ost-Berlin genügte es.
Über all dies, den von Hacks angespielten Aspekt des rein Wohlfährigen, den Arbeitsmarkt für Kulturschaffende in der DDR Verschönernden hinaus, muss darauf hingewiesen werden, dass die Person des Dramaturgen auf ganz besondere Weise dazu geeignet war, Einfluss auf die Ideologisierung und Politisierung der Arbeit gebenden Institution geltend zu machen. Ob dieser als ‚Schaltstelle‘ zwischen Künstlern und Bürokraten fungierte und als solche an herausragendem Ort zugegen war, ob er als geborener Vermittler – zumeist in zweiter Reihe stehend – galt, ob ihm im günstigsten Fall als intellektueller Kopf die besondere Gabe unterstellt wurde, vom ‚Richtigen‘ überzeugen zu können, ob er als ‚dienstbarer‘ Geist für alle Abteilungen des Theaters besonders gut Kontakte und Gespräche zu nutzen in der Lage war – all dies ← 11 | 12 → stellt nur wenige Aspekte dieses besonderen Berufsstands (in der DDR) vor, denen in der Untersuchung nachgegangen wird.
Die Studie reflektiert die besondere Aufgabenstellung, Funktion und Problematik der Dramaturgen im Spannungsfeld von Theaterkunst und Kulturpolitik der DDR. Sie beleuchtet in der konzeptuellen Denkfigur10 des Autor-Dramaturgen zugleich zentrale Aspekte dieser besonderen Theatergeschichte. Dabei argumentiert sie primär empirisch und historisch-rekonstruierend. Die am konkreten theaterhistorischen Bühnengeschehen – auf, hinter und vor der Bühne – entwickelten Befunde werden mit interpretativen Zugriffen innerhalb dieses Spannungsfelds verortet. Ihren übergreifenden Anspruch gewinnen die Fallstudien und Einzelanalysen jedoch erst in der Denkfigur des Autor-Dramaturgen. Dieses Konzept wird mehr als ein empirisch erkundetes Terrain denn als ein ideales theoretisches Modell vorgeschlagen, um den inneren Zusammenhang der einzelnen Bühnenereignisse und der besonderen Position der Akteure plastisch zu beschreiben und vergleichbar zu machen. Mit der Charakterisierung von Bertolt Brecht, Heinar Kipphardt und Peter Hacks als Autor-Dramaturgen wird also keine ausgearbeitete Theorie des dramaturgischen Tuns in der DDR entwickelt, sondern ein Vorschlag für eine, möglicherweise nur an eine bestimmte historische und theatrale Situation gebundene Konstellation formuliert.
Dem „Dramaturgenstaat“ wird hier allein im Theater der DDR nachgegangen. Denn im Theater tritt die im Zentrum stehende Personalunion von Dramaturg und Autor besonders prominent und künstlerisch besonders wirksam auf und hier wird die Kombination zweier künstlerischer Berufe als ← 12 | 13 → kulturpolitische, aber durchaus – wie zu zeigen sein wird – auch als sozialpolitische Strategie genutzt. Der Hacks’sche Scherz deutet diesen Umstand schon an. Aber natürlich wurden Intellektuelle als Verbündete in allen Bereichen der Kultur gebraucht, insofern ist die Verbindung von Talent(en) in einer Person und deren Nutzbarmachung innerhalb des Theaters nur als konsequent zu betrachten. Angesichts von durchschnittlich etwa 16 Millionen Bürgern der DDR, denen am Ende (1989) flächendeckend eine Zahl von 61 Theatern mit 173 Spielstätten zur Verfügung standen,11 wundert es nicht, dass eine so große Zahl von Bühnen auch eine große Zahl von Mitarbeitern erforderlich machte.12 Die Spielpläne für alle Häuser mussten gefüllt werden, sodass Dramaturgen immer gebraucht wurden. Ganz zu schweigen von begabten Dramatikern, die die sozialistische Gegenwartsdramatik auf den Bühnen der DDR garantieren sollten. Die personelle Kombination des fest am Haus engagierten Dramaturgen mit dem Autor, der seine neuen Stücke exklusiv ‚seinem‘ Haus zur Uraufführung gab, sollte einerseits die Stückeproduktion der DDR sicherstellen. Andererseits erhoffte man sich auch eine Qualitätsverbesserung durch die enge Verflochtenheit des Autors mit dem Ensemble, also den potenziellen Darstellern seiner Figuren, mit der besonderen Programmatik und den Traditionen des Hauses und seiner Umgebung und durch die tägliche praktische (Berufs-)Erfahrung des Dramaturgen im Theater. Der amerikanische „dramaturg’s dramaturg“ Bert Cardullo hat diesen Vorzug noch im Jahr 1995 zeit- und ortsunabhängig für gültig erklärt: „A dramaturg is to a play as a mechanic to an automobile: he may not have built it, but he knows what ← 13 | 14 → makes it work […]“.13 Unter einer ersten Voraussetzung, dass ein Automechaniker (s)einem Kraftfahrzeug eine ähnlich große Bedeutung beimisst wie ein Dramatiker dem Stück, das er selbst geschrieben hat, und einer zweiten, dass dem Automechaniker auch ganz verschiedene Automodelle zur Begutachtung, Pflege, Reparatur, im ungünstigsten Fall auch Verschrottung anvertraut werden, mag dieses etwas schiefe Bild ungefähr stimmen: Der Dramaturg nimmt ein Theaterstück – zur Aufführung – entgegen, begutachtet es und ggf. repariert er es mit seinem professionellen Blick. Schmuck oder fehlende Teile gibt er hinzu, Überflüssiges entfernt er und schließlich begleitet er das nun funktionstüchtige, nämlich unter den Bedingungen seines Hauses aufführbare Theaterstück auf die Bühne. He „makes it work“. Und tatsächlich war es keineswegs notwendig, dass der Dramaturg das Stück selbst verfasst hat; dies muss nicht zwangsläufig seine Aufgabe gewesen sein. Notwendig war vielmehr, so Cardullo, dass der Dramaturg wusste, was dem Stück fehlte, „what makes it work“, bevor er es – zumindest – auf ‚seine‘ Bühne bringen konnte. Doch der Dramaturg, der gleichzeitig Autor des Stücks ist, wird umso besser wissen, welcher Aspekte es im Besonderen bedarf, um ein Werk auf die Bühne ‚seines‘ Hauses bringen zu können: Er kennt die Kapazitäten und die Qualitäten des Ensembles, darüber hinaus sind ihm die Spielplan-, Aufführungs- und Inszenierungstraditionen des Hauses vertraut ebenso wie das spezielle Publikum in seiner Stadt oder Region. Der Autor im Dramaturgen hat also die besten Voraussetzungen, ein an die (Spiel-)Pläne des Hauses optimal angelehntes Stück zu präsentieren. Denn als Dramaturg weiß er, was das Theaterstück auf dieser speziellen Bühne funktionieren lässt, als Autor hat er es geschrieben. Dies beschreibt exakt das Konzept des Hausautors an Bühnen der DDR – insbesondere die Situation in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, in denen Dramatiker wie Helmut Baierl, Volker Braun, Hartmut Lange, Heiner Müller und andere als Dramaturgen oder „künstlerische Mitarbeiter“ in den Theatern verpflichtet waren.
Zur Förderung der zeit ihrer Existenz immer als verbesserungswürdig geltenden und stets zu vermehrenden sozialistischen Gegenwartsdramatik auf den Bühnen der DDR griff man gern auf die Verpflichtung von Autoren an ein bestimmtes Haus zurück und diese sollten quasi nebenbei und zum ← 14 | 15 → Zweck des kontinuierlichen Broterwerbs die Arbeit des Dramaturgen gleich mit erledigen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass natürlich 40 Jahre Theatergeschichte der DDR keine ‚Dramaturgen-Maschinen‘ hervorgebracht haben, die in jeder Phase ihres beruflichen Lebens immer dieselben Aufgaben und Funktionen übernommen haben. Mit den verschiedenen kulturpolitischen Phasen und den veränderten Vorgaben aus dem Politbüro änderten sich auch das Was und Wie der Tätigkeitsbereiche der Dramaturgen und der Stückeschreiber. Dies war in den frühen Jahren der SBZ/DDR etwa bis 1950 doch eher noch als ein Suchfeld gekennzeichnet, das auf dem Weg zu einer zukünftigen sozialistischen Kultur noch ein liberaleres Gesicht zeigte und auf dem der Kampf um die Ideale des sozialistischen und/oder des kritischen Realismus noch nicht ausgefochten war. Man konnte und musste sich noch positionieren. Nur kurze Zeit später ist die notwendige Entscheidung in den Führungsebenen in Moskau und somit auch in der DDR gefallen und jeder Kulturschaffende stand im Dienst eines konsequenten Stalinismus. Jeglicher Versuch der Eigenständigkeit und der Verteidigung eigener Standpunkte gegen die russisch-deutschen Vorgaben wurde zunichte gemacht, was im gesellschaftlich-politischen Bereich durch den 17. Juni 1953 belegt ist und in der Kultur sich beispielsweise in den intensiven Auseinandersetzungen der Formalismusdebatte niederschlug. Auch hierzu hatte man sich als Theatermensch (richtig) zu verhalten und es erlebten nur diejenigen Bühnentexte ihre Uraufführung und ihren Erfolg auf den Bühnen der DDR, deren Autor sich für Stanislawski und gegen Brecht entschieden hatte.
Insofern lässt sich die gesamte (kultur-)politische Entwicklung in der DDR auch an den uraufgeführten Gegenwartsstücken vor allem auf den hauptstädtischen Bühnen ablesen, fiel ihnen doch eine besonders große, weil vorbildhafte Bedeutung zu: etwa vom Mauerbau 1961 mit der einhergehenden großen Hoffnung auf Liberalisierung auch vieler Künstler und Intellektueller ‚hinter der Mauer‘ – dies ist etwa bei Peter Hacks deutlich zu erkennen – und das in der Folge etwa ab 1962 einsetzende „Tauwetter“ bis zum berüchtigten „Kahlschlag-Plenum“ 1965, dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965. Damit reagiert die DDR-Spitze auf die Ablösung Chruschtschows durch Breschnew in Moskau und Walter Ulbricht und sein Zögling Erich Honecker springen auf den sowjetischen Zug mit auf. Folgen und Ergebnisse für den kulturellen Sektor, etwa das Auftrittsverbot für Wolf Biermann und das Spielverbot für „Beatmusik“ oder die fast vollständige Absage an eine ← 15 | 16 → Jahresproduktion der DEFA – immerhin zwölf Spielfilme –, sind ausgiebig erforscht und lassen sich vielfach nachlesen.14 Auch mit dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker 1971 keimt erneute und zunächst auch begründete Hoffnung auf eine deutliche Liberalisierung auf, hatte Honecker doch propagiert, dass es von der „festen Position des Sozialismus“ ausgehend in Kunst und Literatur „keine Tabus“ geben könne.15 Und mit Recht wird man für die erste Hälfte der Siebzigerjahre von einem Gewinn größerer Freiheiten sprechen können, sodass nach langen Zeiten ohne eine einzige Aufführung in der DDR etwa Peter Hacks und Heiner Müller auf die Bühnen des Landes zurückkehren konnten. Auch das ‚Intendantenkarussell‘ drehte sich in dieser Zeit, als Ruth Berghaus 1971 nach dem Tod Helene Weigels das Berliner Ensemble (BE) und Gerhard Wolfram ein Jahr später das Deutsche Theater (DT) übernahm und Benno Besson 1974 endlich Intendant der Volksbühne am Luxemburgplatz wurde, nachdem er schon seit 1969 mit seiner Verpflichtung als „künstlerischem Oberleiter“ (unter dem formellen Intendanten Karl Holàn) den Umbau des Hauses in ein „Kulturzentrum des Arbeiterbezirks Prenzlauer Berg“ begonnen hatte.16 Doch im November 1976 wurde mit der Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann aus der DDR das zuletzt ← 16 | 17 → mühsam erprobte Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Kulturschaffenden jäh wieder vernichtet.
Denn es regt sich Widerstand vor allem von Künstlern und Intellektuellen, zum Teil offiziell verkündet in einer Petition gegen die Ausweisung,17 darüber hinaus von großer Öffentlichkeit in Ost und West begleitet und getragen. Die Folgen für das gesellschaftliche und kulturelle Klima in der DDR und für alle nun folgenden politischen Entscheidungen sind immens: Dass zwölf höchst prominente Schriftsteller, von denen allein fünf dem Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR angehören, in einem kritischen Protestbrief öffentlich gegen die Entscheidung der SED-Führung aufstehen, ließ die Partei von nun an „das Bündnis, ein Zweckbündnis, das die beteiligten Seiten voller Mißtrauen und ohne alle definierten Paragraphen abgeschlossen hatten“ aufkündigen. „Die Künstler, unter ihnen vor allem die Literaten als geistige Wortführer, galten der Parteiführung nun vor allem wieder als unsichere Gesellen“,18 die sich als undankbar für die vermehrt gewährten künstlerischen Freiheiten erwiesen hätten. Parteistrafen und Verbandsausschlüsse, Inhaftierungen von Musikern und Schriftstellern und Hausarrest für Robert Havemann, Publikations-, d. h. Berufsverbote folgten ebenso wie der – nicht in jedem Fall ganz freiwillige – Exodus einer vor allem innerhalb der DDR-Kulturszene spürbar großen Zahl von Künstlern und Intellektuellen in die Bundesrepublik, der zunächst bis Sommer 1979 mit der Ausreise von Günter Kunert, Klaus Poche, Rolf Schneider und Joachim Seyppel anhielt.19 ← 17 | 18 →
Im Theater hatten die Biermann-Ausweisung und der folgende Exodus so vieler Kulturschaffender besonders große Auswirkungen. Furcht, Vorsicht und Misstrauen zogen in die Häuser und Ensembles ein: So wurden die Theaterspielpläne neuerlichen Überprüfungen auf allzu Kritisches unterzogen, denn in den Vorstellungen ‚problematischer‘ Stücke (etwa von Volker Braun, der sich dem Protest gegen die Ausbürgerung Biermanns angeschlossen hatte) vermuteten die Theatermacher die stete Überwachung des Hauses etwa durch unerwünschte Besucher der Staatssicherheit. Auf diese Weise sollte ihnen, so die Mutmaßung, der besondere Schutz vor dem befürchteten „Ausbruch der Konterrevolution vom Theater aus“ deutlich demonstriert werden.20 Für viele kritische und experimentierfreudige Künstler wurde die Situation in ihren Häusern zunehmend schwerer erträglich, wobei Benno Bessons wunderbares Ensemble der Volksbühne am Luxemburgplatz die meisten Weggänge zu verkraften hatte, bevor er 1978 in letzter Konsequenz auch selbst aufgab und die DDR zunächst in Richtung Paris verließ: Matthias Langhoff, Manfred Karge, Jürgen Gosch, Angelica Domröse, Bessons Tochter Katharina Thalbach und Jürgen Holtz verließen die Volksbühne in Richtung Bundesrepublik ebenso wie der Hausautor Kurt Bartsch und seine Ehefrau, die Dramaturgin Irene Böhme. „Der Sturz der Volksbühne vom Spitzentheater Anfang der Siebzigerjahre in die völlige Bedeutungslosigkeit am Ende des Jahrzehnts ist symptomatisch“ für die Vorgänge innerhalb der DDR-Theaterszene nach der Biermann-Ausweisung, so der Dramaturg und Publizist Knut Lennartz.21 Während die ausgereisten Künstler in der Bundesrepublik zumeist innerhalb kurzer Zeit Fuß fassen und ihre Karrieren in Theater, Kino und Fernsehen weiterleben konnten, fehlten sie der darstellenden Kunst in der DDR erheblich. Ein „gewichtiger Teil des DDR-Theaters spielte sich nun außerhalb der ← 18 | 19 → DDR ab“,22 wovon Manfred Krug, Angelica Domröse, Hilmar Thate und Heiner Müller nur die prominentesten Zeugnisse abgelegt haben.
Doch die jüngeren Künstler blieben und mit ihnen die Hoffnung, freigewordene Positionen erobern zu können, nun reüssieren zu können, und zwar ohne die Absicht, sich für Aufbau oder Pflege des sozialistischen Staates noch zu engagieren. Sie entzogen sich der politischen Verantwortung, verweigerten sich den Vorgaben und Anforderungen von Partei und Kulturfunktionären und suchten einen eigenen freien künstlerischen Weg, wofür Heiner Müller schon früher eine Erklärung gefunden hatte:
Die Generation der heute Dreißigjährigen in der DDR hat den Sozialismus nicht als Hoffnung auf das Andere erfahren, sondern als deformierte Realität. Nicht das Drama des Zweiten Weltkriegs, sondern die Farce der Stellvertreterkriege (gegen Jazz und Lyrik, Haare und Bärte, Jeans und Beat, Ringelsocken und Guevara-Poster, Brecht und Dialektik). Nicht die wirklichen Klassenkämpfe, sondern ihr Pathos, durch die Zwänge der Leistungsgesellschaft zunehmend ausgehöhlt. Nicht die große Literatur des Sozialismus, sondern die Grimasse seiner Kulturpolitik […].23
Einer dieser (1977) Dreißigjährigen etwa, die Müller im Blick hatte, war Christoph Hein, der an der Volksbühne am Luxemburgplatz bis zum Weggang Benno Bessons und eines großen Teils des Ensembles 1978 einen Dramaturgen- bzw. Autorenvertrag innehatte und dies – bis dahin – als besondere Förderung seiner Arbeit erfuhr. Er sei an dieser Stelle in all seiner Dankbarkeit zitiert: zum einen als ein weiteres Exempel für die Realität des Hausautors und Dramaturgen in der DDR, zum anderen auch als ein bekannt gewordener Repräsentant der Müller’schen Erkenntnis. Die schwierige Situation an der Volksbühne am Ende der Siebzigerjahre, die zur nahezu vollständigen Auflösung des Ensembles geführt hat, reflektiert er hier (1985) freilich in keiner Weise mit:
Mich hatte ja inzwischen die Volksbühne übernommen in Berlin, da war ich zwei Jahre als Dramaturg und noch sechs Jahre als Autor an der Bühne. Das ist so eine Besonderheit der DDR, daß die großen Theater häufig einen Dramatiker als Hausautor beschäftigen. Das ist keine Notwendigkeit, sondern mehr ← 19 | 20 → eine Freundlichkeit, das Haus ehrt sich da ein wenig, wenn es große Namen sind […]. Ich weiß nicht, wie das an anderen Theatern in der DDR war, aber an der Volksbühne bei Besson war das ganz freundlich. Wir sahen uns gelegentlich und sprachen darüber, wie die Geschichte des Hauses weitergehen sollte. Ich habe mitgeteilt, was ich schreibe und wann ich abgeben will. Da hatte ich dann absolute Ruhe. Das ist ein großer Luxus, ein sehr sinnvoller Luxus, der gerade für junge Leute etwas sehr Wichtiges ist.24
Auch Hein war Teil des beschriebenen Exodus aus der Volksbühne nach der Biermann-Ausweisung geworden, doch verließ er nur das Theater, nicht gleich das ganze Land wie viele seiner Kollegen.25
Die sich durch die 40 jährige Geschichte der DDR variabel darstellenden kulturpolitischen Phasen werden für die vorgestellten Protagonisten die Folie sein, vor der die Tätigkeit des Einzelnen als Hausautor und Dramaturg zu betrachten ist. Eine konsequente Parallelsetzung der DDR-Kulturgeschichte mit den Funktionen des Autor-Dramaturgen ist jedoch – wie die Beispiele der untersuchten Persönlichkeiten zeigen werden – nur allzu verführerisch und birgt die Gefahr, etwa das problematische Verhältnis des sozialistischen Künstlers zum bürgerlichen Erbe zu verdecken.
Ganz besonders deutlich erhellt sich die Legende vom „Dramaturgenstaat“ durch einen Blick in die Akten des Ministeriums für Volksbildung und des Ministeriums für Kultur der DDR, die hinreichend Aufschluss über die Situation in den Dramaturgien der Theater geben, in denen auf der verzweifelten Suche nach geeigneter Gegenwartsdramatik jede weitere dramaturgische Spürnase willkommen war. Aber auch die prompte, schon 1946, mit Gründung des ← 20 | 21 → Fachorgans Theater der Zeit (TdZ) einsetzende fachliche Auseinandersetzung über die Existenzberechtigung von Dramaturgen im DDR-Theater, über die Notwendigkeit ihrer zweifelsfreien ideologisch-politischen Haltung zur neuen sozialistischen Gesellschaft, über ihre Aus- und Weiterbildung, ihr Heranwachsen als Funktionsträger in den Theatern, ggf. ihre ideologische Schulung und – ganz besonders wichtig und in allen Argumentationen immer im Vordergrund stehend – ihre Qualifikation als Entdecker und im besten Fall eben als Schreiber für die Bühnen der DDR geeigneter sozialistischer Gegenwartsdramatik, belegt den Stellenwert der Institution von Hausautor und Dramaturg für den DDR-Kulturbetrieb. Diese besondere Kombination stellt die eigentliche Fragestellung der Studie dar: Inwieweit ist die Kombination institutionengeschichtlich im Theater verankert, inwieweit ist sie spezifisch für das DDR-Theater oder genauer: Welche besondere Qualität gewinnt diese theaterhistorisch durchaus etablierte Doppelfunktion für den kultur- und theaterwissenschaftlichen Blick auf die Bühne im SED-Staat?
Wirft man heute einen Blick zurück auf die 40 Jahre der DDR-Theatergeschichte, ist es erstaunlich, wie leicht und problemlos ein Interessierter den Weg hinter die Kulissen des Theaters nehmen konnte, wie gern ihm die Gelegenheit einer Mitarbeit im professionellen Theaterbetrieb eröffnet wurde. Das Theater im Arbeiter- und Bauernstaat – ein Arbeitsplatz wie jeder andere? Die eingesehenen Akten der Ministerien für Volksbildung und für Kultur legen diesen Schluss durchaus nah, zeigen sie doch, dass sich ein offensichtliches Nachwuchsproblem auf dem Theater – und insbesondere im Bereich der Produktion sozialistischer Gegenwartsdramatik – entwickelt und sich durch jede kulturpolitische Phase hindurch schließlich auch manifestiert hatte. Insofern wurde massiv für ein aktives Mitwirken im Gegenwartstheater geworben, sei es durch die Ausschreibung von (Nachwuchs-)Dramatikerwettbewerben durch die Ministerien, die Verlage oder durch einzelne Theaterhäuser, durch die regelmäßige Veranstaltung von Autorenwerkstätten, durch die gezielte Vergabe von Stückaufträgen an freie Schriftsteller oder durch die Bindung des freien Autors an eine Bühne im Wege des Dramaturgenvertrags.
Die für diese Untersuchung ausgewählten Künstler nahmen unterschiedliche Wege ins Theater – und schließlich auch wieder hinaus. Dabei ist Bertolt Brecht, der auch an dieser Stelle eine Ausnahmestellung einnimmt, der Einzige, der in ‚seinem‘ Theater geblieben und gleichsam dort gestorben ist. Die beiden anderen – Heinar Kipphardt und Peter Hacks – traten als ← 21 | 22 → hoffnungsfrohe Jungautoren mit einem Dramaturgenvertrag ins Theater ein und verließen es wieder.26 Die Gründe für den Weggang sind in den einzelnen Fällen unterschiedlich, übereinstimmend zeigt sich jedoch, dass die an die Personalunion von Autor und Dramaturg im Theater der DDR adressierten Erwartungen den ausgeprägten Künstlerpersönlichkeiten, wie sie hier im Zentrum stehen, zuwiderlaufen mussten. Insofern wird das titulierte Prinzip von Hausautor und Dramaturg empirisch quasi ex negativo als Dilemma gezeigt: Auf Dauer konnte der eigenständige Künstler kein guter und zuverlässiger Dramaturg sein, weil die Eigenständigkeit seiner dramatischen Kunst im gelenkten Theaterbetrieb nicht gewährleistet war. Und dies gilt für einen so überzeugten Sozialisten der Anfangsjahre wie Heinar Kipphardt, einen der bekanntesten und bedeutendsten Autoren und Dramaturgen, der seiner Bühne immerhin zehn Jahre verpflichtet blieb, ebenso wie bis in die späten Jahre hinein etwa für Armin Stolper. Zwar sah er sich als zeitgenössischer und erklärter sozialistischer Dramatiker und über viele Jahre hinweg an unterschiedlichen Theatern verpflichteter Dramaturg zwar stets mit dem drängenden Postulat einer Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Erbe konfrontiert, hat sich jedoch trotzdem später als freier Schriftsteller „in der Bindungslosigkeit gegenüber dem Theater nie wohlgefühlt“. Er brauche, wenn er seine „bestmögliche Produktivität erreichen will, die Verbindung mit einem Theater.“27
Die nachfolgenden Angaben zum Forschungsstand zeigen, dass eine systematische Aufarbeitung des Theaters in der DDR noch längst nicht geleistet ist. Auch diese Untersuchung kann nur einen einzigen Aspekt des Gesamtkomplexes betrachten. Dieser darf aber – so die Arbeitshypothese – als besonders symptomatisch für das System und als folgenreich für die deutsche Theatergeschichte betrachtet werden. Denn es sind eben auch Bertolt Brecht und Peter Hacks, also – neben Heiner Müller – die erfolgreichsten Dramatiker im Deutschland ihrer Zeit, die hier im Mittelpunkt der Analyse stehen. Ebenso ← 22 | 23 → wird aber auch deutlich, dass die doppelte Berufung des Autors und Dramaturgen im Theater der DDR zwar ein wichtiges und maßgebliches Rädchen im Getriebe der DDR-Theaterkunst darstellte, mit seiner Erforschung und Positionsbestimmung jedoch die Beschäftigung mit den Mechanismen innerhalb der Kulturhierarchien der DDR keineswegs als abgeschlossen gelten kann.
Details
- Seiten
- 426
- Erscheinungsjahr
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783631703021
- ISBN (MOBI)
- 9783631703038
- ISBN (PDF)
- 9783653070552
- ISBN (Hardcover)
- 9783631678947
- DOI
- 10.3726/978-3-653-07055-2
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (Mai)
- Schlagworte
- DDR-Theatergeschichte DDR-Kulturpolitik Dramaturgiegeschichte Theaterzensur 1950er-Jahre Denkfigur
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien. 2017. 426 S., 1 Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG