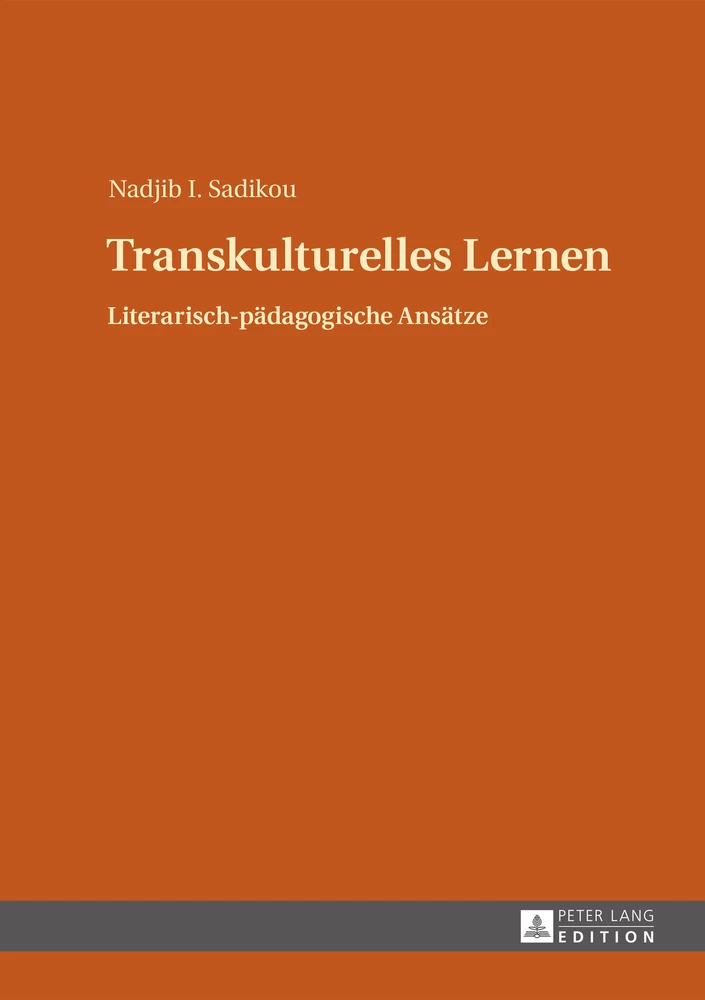Transkulturelles Lernen
Literarisch-pädagogische Ansätze
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Danksagung
- Einleitung – Worum es geht
- Kapitel I: Reflexionen zu transkulturellem Lernen
- 1. Kulturkonzept: Konzepte und Konklusionen
- 2. Transkulturelles Lernen: Theoretische Überlegungen
- 3. Integrationsbegriff: Blicke und Vorschläge
- 4. Transkulturalität: das Beispiel muslimischer Jugendliche
- Kapitel II: Krise der Wahrnehmung – Ambivalenz von Werten
- 1. Warum Werte?
- 2. Überlappung von Werten
- 3. Konflikthaftigkeit von Werten
- 4. Filmtrailer „Innocence of Muslims“: Krise der Wahrnehmung?
- Kapitel III: Literatur – Experimentierfeld transkulturellen und transreligiösen Lernens
- 1. Was kann Literatur bewirken?
- 2. Goethes Experiment transkulturellen Lernens im West-östlichen Divan
- 3. Goethes Erbe im 21. Jahrhundert
- 4. Ost-Westliche Verschränkung heute: Selam Berlin (Yadé Kara)
- 5. Wider die Weltvermessung: Der Weltensammler (Ilija Trojanow)
- 6. Afropolitische Identität: Ghana must go (Taiye Selasi)
- 7. Konfluenz Euroamerika-Afrika: Tor der Tränen / In den vereinigten Staaten von Afrika (Abdourahman Waberi)
- Kapitel IV: Transkulturelle Kompetenz: Schule und Gesellschaft im Fokus
- 1. Transkulturelles Verstehen
- 2. Transkulturelle Kompetenz: Zwei Begriffsbestimmungen
- 3. Multiperspektivische Bildung
- 4. Vorschläge für eine transkulturelle Stimmung
- Kapitel V: Aspekte kultureller Bildung in Afrika
- 1. Einstieg: Vielfalt afrikanischer Kulturen
- 2. Das „wesentliche“ und das „andere“ Afrikas
- 3. Medien kultureller Bildung in Westafrika
- 4. Transreligiöser Dialog am Beispiel Westafrikas
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Das vorliegende Buch hätte nicht geschrieben werden können ohne motivierende Impulse und konstruktive Kritikpunkte von außen. Ein besonderer Dank gilt zunächst Prof. Dr. Jürgen Wertheimer, Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann und Prof. Dr. Frank Baasner, den drei Koordinatoren des Tübinger Kooperations- und Forschungsprojekts „Wertewelten“, im Rahmen dessen ich als wissenschaftlicher Angestellter zahlreiche Anregungen erhielt. Ihnen drei verdanke ich viel, ohne dass ich dies hier gebührend zum Ausdruck bringen kann. Prof. Dr. Karin Amos danke ich für die Organisation einer „Vortragsgruppe“ über Erziehung zur Grenze – Grenze der Erziehung – Entgrenzte Erziehung während des 8. internationalen Wertewelten-Forums (11.–14. Juni 2013). Bei der Überarbeitung meines dortigen Referates1 stieß ich auf einige Überlegungen, die im Buch dargestellt sind.
Zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Privatdozenten Dr. Philipp Thomas sowie Regina Keller für die Einladungen im Rahmen der vom Zentrum für Lehrerausbildung der Universität Tübingen organisierten Vorlesungsreihe Modul Personale Kompetenz. In Erinnerung bleiben mir die Diskussionen und wertvollen Kommentare vor und nach meinen Vorträgen über Interkulturelle Kompetenzen: Wie kann eine Lehrkraft interkulturell kompetent sein?. Prof. Dr. Stephan Buchloh, dem Leiter der Abteilung Kultur- und Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg danke ich dafür, dass er mich am 23. November 2011 einlud, einen Vortrag über kulturelle Bildung in Westafrika im Rahmen seines Seminars Kultur, Medien, Bildung: Bildungstheoretische Grundlagen zu halten. Bedanken möchte ich mich bei dem Verein Süddialog e.V. für die Einladungen im Rahmen der Württemberger Gespräche in Tübingen, Böblingen sowie an der pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Dr. Djiby Diouf und seiner Frau Birgit Kaiser-Diouf aus Münster danke ich für ihre Gastfreundschaft, die mir die erste und wichtige Durchsicht des Manuskripts erleichterte. Besonders großer Dank gebührt Andrée Gerland, der das Manuskript kritisch durchgesehen und mit großer Sorgfalt lektoriert hat. ← IX | X →
Der innigste Dank gebührt schließlich meiner Frau, die das Buchprojekt aus dem Geist einer Medizinerin begleitet hat und mir immer wieder neue Kraft und Hoffnung schenkt.
| Tübingen, im Juli 2014 | Nadjib I. Sadikou |
| ← X | XI → |
1. Sadikou, Nadjib: Grenzziehung oder Grenzüberwindung. Aspekte transkulturellen Lernens in der Gegenwart. In: Grenzen. Hrsg. von Assmann, Heinz-Dieter/ Baasner, Frank / Wertheimer, Jürgen. Baden-Baden: Nomos 2014, S. 219–231.
Kaum jemand wird ernsthaft in Frage stellen, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft eine Schaubühne von diversen Lebensentwürfen und Wertewelten ist. Im Zuge von Migrationsdynamiken, von globalisierten Finanz- und Warenmärkten und nicht zuletzt von transnationalen Informationsflüssen bzw. Medienstrukturen des 21. Jahrhunderts erleben wir einerseits ein rasantes Ineinanderfließen verschiedener kultureller Zugriffsmodi, eine zusehends geballte Grenzen-Verwischung zwischen dem ‚Eigenen‘ und dem ‚Fremden‘. Andererseits erschüttern und erzürnen uns grausame Bilder von Geiselnahmen, von Terrorakten fundamentalistischer und extremistischer Gruppierungen bzw. ‚Gotteskrieger‘, denen die Vielfalt von Kulturen und Religionen ein Dorn im Auge ist. Die meisten solcher Gruppierungen, wie z. B. die Boko Haram in Nigeria, die Terrormiliz ISIS (Islamischer Staat im Irak und im Syrien) oder die somalische Aš-šabāb-Bewegung, streben nach klaren Verhältnissen, vor allem nach der Etablierung einer Ordnung, die oftmals von der Verabsolutierung einer Ideologie, einer vermeintlichen Identität (religiös, ethnisch, kulturell) geprägt ist. Sie eifern danach, wie der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Baumann zeigte, „die Welt in ein Gitter sauberer Kategorien und klar umrissene Einteilungen zu sperren.“2 Diese Sperrung führt zu einem schablonenhaften Weltverständnis und missachtet dabei jene Dynamik, mit der sich das vorliegende Buch beschäftigt: die der Transkulturalität.
In der Forschungslandschaft wurden bereits Konzepte von Transkulturalität, Interreligiosität, von kulturtheoretischen Paradigmen der Kreolisierung, Hybridisierung oder auch der Ähnlichkeit programmatisch gefasst. Allen diesen Ansätzen ist es, mit unterschiedlicher Gewichtung und Akzentsetzung, daran gelegen, Möglichkeiten des Zusammenlebens in Frieden und Differenz zu erfassen bzw. eine ‚Fluidität‘ des Miteinanderseins herauszuarbeiten. Eine Fluidität, die nicht ein Anything goes propagiert, sondern stets kontextbezogene kulturelle Zugänge und Übergänge. ← XI | XII →
Das vorliegende Buch nimmt diesen gegenwärtig stark diskutierten kulturellen Cross-Over in den Fokus. Es reiht sich im Diskurs über Transkulturalität ein, wobei ein zentraler Aspekt darin liegt, die kunstvolle Inszenierung transkultureller Zusammenhänge in literarischen Texten zu analysieren und ihr pädagogisches Potential zu beleuchten. Pädagogisches Potential, weil transkulturelles Lernen, insbesondere mit Blick auf Diskussionen über Diversität, Inklusion und Pluralität, eine Herausforderung für unser heutiges Zusammenleben darstellt. Genau hier spielen literarische Werke, insbesondere Romane, eine entscheidende Rolle, insofern als sie uns Denkmöglichkeiten zur Hand geben. Inklusion und Exklusion, Ideologien der Reinheit sowie sprachliche Formierung von Diversität und Pluralität werden in der Literatur aufs Genaueste durchgespielt. Aufgrund dessen lässt sich Literatur als ein Kraftwerk komplexer Weltwirklichkeiten bezeichnen. Literarische Texte sind Vehikel welthaltiger Themen und Motive, die uns ermöglichen, ideologische, politische, kulturelle sowie religiöse Grenzen zu überschreiten.
Details
- Seiten
- XIV, 107
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (PDF)
- 9783653049930
- ISBN (MOBI)
- 9783653973556
- ISBN (ePUB)
- 9783653973563
- ISBN (Hardcover)
- 9783631656761
- DOI
- 10.3726/978-3-653-04993-0
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2014 (August)
- Schlagworte
- Integration kulturelle Bildung Transkulturalität
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. XIV, 107 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG