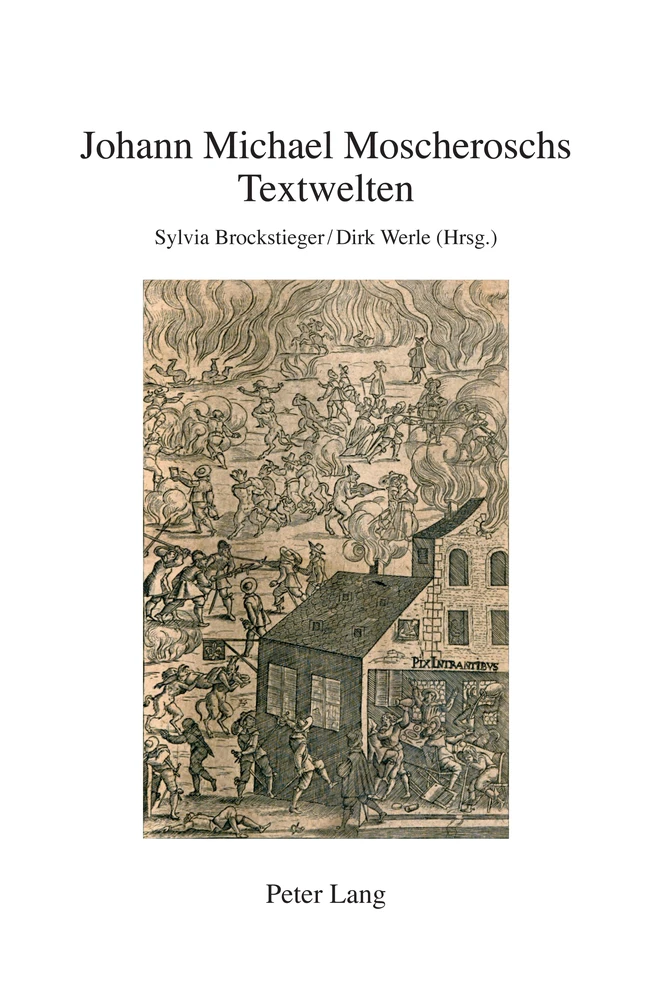Johann Michael Moscheroschs Textwelten
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Einleitung (Sylvia Brockstieger / Dirk Werle (Heidelberg))
- Textwelten in Darstellungsformen
- Philanders Urteile. Gattungsgrenzen und -lizenzen der Prosasatire bei Moscherosch (Nora Ramtke (Bochum) )
- Selbstrechtfertigung des Moralsatirikers und Sozialutopie. Johann Michael Moscheroschs Reformation (Peter Heßelmann (Münster))
- Einfalt und Geschicklichkeit. Zur gelehrten Selbstrepräsentation in Moscheroschs Insomnis Cura Parentum (1643) (Simon Zeisberg (Berlin))
- Textwelten im Sprachkontakt
- Vom Übersetzen eines europäischen Bestsellers. Moscheroschs Quevedo (Eric Achermann (Münster))
- Das Reden über die Liebe in Moscheroschs Gesichten (1650) im Rahmen intermedialer Transformation und im Vergleich mit La Genestes Les Visions (1633) (Stefanie Arend (Rostock))
- Tridentinische Bibelepik und hugenottische Meditationspraxis. Robert Arnauld d’Andillys Poeme sur la vie de Iesus-Christ (1634) als Vorlage von Johann Michael Moscheroschs Meditation sur la vie de Iesus Christ (1646) (Elsa Kammerer (Paris))
- Ein mehrsprachiger Weltentwurf und seine Ordnung. Johann Michael Moscheroschs und Johann Caspar Herrmanns Technologie Allemande & Françoise im zeitgenössischen Kontext (Misia Sophia Doms (Baden bei Wien))
- Textwelten in der Textumgebung
- Die Paratexte in Moscheroschs Gesichten (Rosmarie Zeller (Basel))
- Teufel und Absolutismus. Zur politischen Theologie in Moscheroschs Hoff-Schule und Grimmelshausens Höllenvision aus der Continuatio des Simplicissimus Teutsch (Maximilian Bergengruen (Würzburg))
- Moscheroschs Bibliothekskatalog (Dirk Werle (Heidelberg))
- Rotwelsch bei Moscherosch (Jörg Riecke † (Heidelberg))
- Textwelten in der Lebenswelt
- Moscheroschs Lebenswelt im Spiegel der Willstätter Gemeinderechnungen (Martin Ruch (Willstätt))
- Moscheroschs Schreibkalender (Sylvia Brockstieger (Heidelberg))
- Eine neu entdeckte Quelle zu den Beziehungen Moscheroschs nach Frankfurt. Johann Philipp Thelott (1639–1671) und sein Arbeitsbuch (Holger Th. Gräf (Marburg))
- Alamode. Verfremdung, ‚Überfremdung‘ und Antimoderne im Werk Moscheroschs und in seinem Umkreis (Wilhelm Kühlmann (Heidelberg))
- Die Herstellung Guter Policey in Moscheroschs Gesichte Philanders von Sittewald. Poetologische und gesellschaftliche Aspekte eines Problems (Philip Ajouri (Mainz))
- Textwelten in der Nachwelt
- Moscheroschs ‚zweite‘ Ausgabe seiner Epigramme. Aus seiner Korrespondenz mit Samuel Gloner und den „Additamenta“ der Gesamtausgabe (1665) (Michael Hanstein (Ditzingen))
- Pseudomoscherosch. Die Fortsetzungsbände der Moscherosch-Ausgabe des Frankfurter Verlegers Johann Gottfried Schönwetter (1645–1648) (Dieter Breuer (Aachen))
- Zur Moscherosch-Rezeption in Schulprogrammen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Hans-Joachim Jakob (Siegen))
- An der Grenze. Eine Ausstellung für Johann Michael Moscherosch (Thomas Schmidt / Dirk Werle(Marbach a.N. / Heidelberg) / (Heidelberg))
- Forschungsbibliographie zu Johann Michael Moscherosch (zusammengestellt von Kim Anh Schäfer)
- Namenregister
Sylvia Brockstieger / Dirk Werle (Heidelberg)
Einleitung
Johann Michael Moscherosch ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Erzähler des 17. Jahrhunderts und sein Werk ein Meilenstein auf dem windungsreichen Weg zum modernen Roman. Seine erstmals 1640 veröffentlichten und in Folgeauflagen vielfältig erweiterten Gesichte Philanders von Sittewalt sind vielleicht die bedeutendste satirische Erzählsammlung der frühen Neuzeit in deutscher Sprache; im 17. Jahrhundert ist dieser Text auf dem Buchmarkt, wie man an den zahlreichen Neuauflagen und Raubdrucken erkennen kann, erfolgreicher als der heute kanonischere Simplicissimus Teutsch Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausens, der in manchen Aspekten von Moscheroschs Philander abhängig ist. Darüber hinaus ist der zwischen Rhein und Schwarzwald, in Willstätt in der Nähe Straßburgs geborene Moscherosch ein herausragender Vertreter des südwestdeutschen Späthumanismus, ein bedeutender Epigrammatiker, Pädagoge und Lexikograph.
Der vorliegende Band macht es sich zur Aufgabe, aufbauend auf die bestehende Forschung neue Beiträge zu Moscheroschs Œuvre und dessen literarhistorischer Kontextualisierung zu präsentieren. Mit Blick auf die Breite der behandelten Themen beansprucht der Band eine gewisse Repräsentativität – er möchte als Ersatz für ein bislang nicht vorhandenes Moscherosch-Handbuch gelten. Er versammelt die Beiträge zu einer internationalen und interdisziplinären Tagung, die anlässlich von Moscheroschs 350. Todestag im April 2019 in seiner Heimatgemeinde Willstätt stattfand.1 Im Vorfeld dieses Jubiläums eröffnete die Gemeinde Willstätt im Sommer 2018 in ihrem Rathaus eine Dauerausstellung zum Leben Moscheroschs vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges, des Lebens im Grenzbereich zwischen deutschem und französischem Kulturraum, zur in seinen Werken entwickelten pädagogisch-gesellschaftlichen Vision, zur poetischen Machart seines erzählerischen Hauptwerks und zu seiner Autorkonzeption. Die seitdem öffentlich zugängliche Ausstellung wurde von der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg am Deutschen Literaturarchiv Marbach kuratiert und durch ein studentisches Arbeitsprojekt der Universität Heidelberg konzipiert. Aufbauend auf den konzeptionellen Arbeiten an der Ausstellung verfolgte die Tagung das Ziel, in Zusammenarbeit mit der Grimmelshausen- Gesellschaft Moscherosch als bedeutenden Autor der deutschen Literaturgeschichte der frühen Neuzeit anlässlich seines Jubiläums zu würdigen. Der aus der Tagung hervorgegangene Sammelband steht also nicht nur nur an Stelle eines Moscherosch-Handbuchs, sondern auch an Stelle eines Katalogs zur Ausstellung.
Eine wissenschaftliche Tagung zu Moscherosch hatte es trotz seiner eminenten literaturhistorischen Bedeutung bis dahin nicht gegeben. Natürlich waren aber sein Leben und Werk nicht unerforscht geblieben.2 In den letzten Jahrzehnten haben insbesondere Wilhelm Kühlmann und Walter Ernst Schäfer mit ihren Moscherosch-Studien Bahnbrechendes zur historischen Aufarbeitung des Werks und seines Umfelds geleistet. Konzentrierten sich Kühlmann und Schäfer häufig auf die gesellschafts- und kulturhistorischen Kontexte von Moscheroschs Œuvre, lotet der vorliegende Band – neben neuen Forschungen zu Moscheroschs Netzwerken und Lebenswelten – vor allem die Vielfalt der Formen und Funktionen von Moscheroschs Texten und der darin entworfenen Welten sowie die Einbettung von Moscheroschs Texten in die umgebenden ‚Textwelten‘ aus.
Der erste Abschnitt des Bandes widmet sich dem Thema „Textwelten in Darstellungsformen“: Die Beiträge dieses Abschnitts gehen der Situierung von Moscheroschs Schreiben in der Gattungsgeschichte der Satire, seinen utopischen Dimensionen sowie Aspekten der Selbstrechtfertigung und Selbstpräsentation nach. Der zweite Abschnitt eruiert „Textwelten im Sprachkontakt“; literarhistorisch erschlossen werden in diesem Abschnitt Moscheroschs Leistungen als Übersetzer und Vermittler spanischer und französischer Literatur und Kultur. Im dritten Abschnitt stehen „Textwelten in der Textumgebung“ im Fokus; untersucht wird die Eigentümlichkeit von Moscheroschs Schreiben in seinen paratextuellen, ideengeschichtlichen, intertextuellen und varietätenlinguistischen Bezügen. Der vierte Abschnitt „Textwelten in der Lebenswelt“ erschließt in Fallstudien Moscheroschs literarische Tätigkeit im Rahmen lebensweltlicher Bezüge: der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der geschäftlichen Beziehungen, der lokalen politischen Situation und der juristisch-verwaltungspolizeilichen Wirklichkeit. Im fünften Abschnitt „Textwelten in der Nachwelt“ werden schlaglichtartig Facetten der Rezeption von Moscheroschs Texten erhellt: die bereits zu Lebzeiten durch den Autor vorbereitete Kuratierung seines Werks für die Nachwelt, die Aneignung und Verbreitung seines Werks in Gestalt von Raubdrucken, das zeitweilige Nachleben in schulischen Kontexten sowie schließlich die lokale Würdigung in Gestalt der Ausstellung im Willstätter Rathaus seit 2018.
Der vorliegende Band verfolgt den Anspruch, den Forschungsstand zu Moscherosch als bedeutendem Autor der deutschen Literaturgeschichte des 17. Jahrhunderts zu sichern und weiter zu entwickeln und damit nicht zuletzt Folgestudien anzuregen. Während der Arbeit am Band wurde allen Beteiligten immer wieder das Fehlen einer modernen editorischen Ansprüchen genügenden Ausgabe von Moscheroschs Werken schmerzlich bewusst.3 Dieses Desiderat schlägt sich in den Beiträgen des vorliegenden Bandes auch ganz konkret darin nieder, dass nicht einheitlich nach einer Standardausgabe zitiert werden kann, sondern die einzelnen Beiträge entsprechend ihrer thematischen Ausrichtung die Ausgaben heranziehen, die jeweils geeignet scheinen und verfügbar sind.
Als Herausgeberin und Herausgeber des vorliegenden Bandes danken wir an erster Stelle der Gemeinde Willstätt für die Möglichkeit, die Tagung zu Johann Michael Moscheroschs Textwelten an dem bedeutsamen Ort und in einem würdigen Rahmen abhalten zu können – und nicht zuletzt danken wir auch für die organisatorische und finanzielle Unterstützung. Wir danken darüber hinaus Dr. Thomas Schmidt von der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg für die fruchtbare Zusammenarbeit, die im Rahmen der gemeinsamen Arbeit an der Moscherosch-Dauerausstellung begonnen hat und die mit Tagung und Sammelband ihre Fortsetzung gefunden hat. Dem Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Arbeitsstelle danken wir ebenfalls für seinen großzügigen finanziellen Beitrag zur Tagung.
Weiterhin geht unser Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Teilfinanzierung der Tagung und des Bandes über das an der Universität Heidelberg angesiedelte Teilprojekt „Johann Michael Moscherosch: Übersetzen – Wissen – Erzählen“ des Schwerpunktprogramms 2130 Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit. Wir danken schließlich der Grimmelshausen-Gesellschaft für die kooperative Ausrichtung der Tagung und die Möglichkeit, die Ergebnisse hier als Beiheft zu den Simpliciana veröffentlichen zu können.
Unser herzlicher Dank geht darüber hinaus an alle Helferinnen und Helfer, die bei der Ausrichtung der Tagung unterstützend mitgewirkt haben: an Anne Leinberger, die Heidelberger studentischen Hilfskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus Willstätt. Mit Blick auf den vorliegenden Band danken wir vor allem Marvin Jonathan Asmussen, Kim Anh Schäfer und Björn Thesing für Hilfe bei der redaktionellen Betreuung der Beiträge; Marvin Asmussen hat darüber hinaus das Register erstellt, Kim Anh Schäfer die Bibliographie erarbeitet.
Der vorliegende Band ist dem Andenken Walter Ernst Schäfers (1928–2014) und Jörg Rieckes (1960–2019) gewidmet. Walter Ernst Schäfer war einer der bedeutendsten Moscherosch-Forscher seiner Generation und überhaupt; ohne sein jahrzehntelanges Engagement für Moscherosch und sein Werk, gerade auch in regionalen Kontexten, wären weder eine Moscherosch-Ausstellung noch eine Tagung zum Autor in Willstätt noch die vorliegende Publikation denkbar gewesen. Unser Heidelberger Kollege, der Sprachhistoriker Jörg Riecke, hat die Willstätter Tagung mit einem Beitrag zur Rolle des Rotwelschen bei Moscherosch bereichert. Gut einen Monat nach der Tagung, am 6. Mai 2019, verstarb Jörg Riecke unvorhergesehen und vor der Zeit. Seinen Beitrag für den vorliegenden Band hat mit Zustimmung seiner Witwe Svetlana Riecke unsere gemeinsame Kollegin Anja Lobenstein- Reichmann für den Druck fertiggestellt.
1 Vgl. den Tagungsbericht von Sofia Derer: Johann Michael Moscheroschs Textwelten. Interdisziplinäre und internationale Tagung in Willstätt, 3.–5. April 2019. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 30 (2020), S. 184–186.
2 Vgl. die Bibliographie der Forschungsliteratur in diesem Band.
3 Eine kommentierte Ausgabe der Gesichte bereitet derzeit Sofia Derer (Heidelberg) vor.
Nora Ramtke (Bochum)
Philanders Urteile. Gattungsgrenzen und -lizenzen der Prosasatire bei Moscherosch
Satire als „ästhetisch sozialisierte Aggression“ zielt wie wohl kaum eine andere Gattung auf eine Wirkung, die jenseits ihrer ästhetischen Dimension liegt: Sie „will aus der Öffentlichkeit Kapital schlagen“,1 wie eine bekannte Definition von Jürgen Brummack lautet. Das gilt im besonderen Maße für die Prosasatire des 17. Jahrhunderts, die aus der Rückbindung an außerliterarische Normen im Zeichen des Horazischen prodesse et delectare überhaupt erst Strategien der Gattungslegitimation entwickelt. Im Fokus meiner Überlegungen zu Johann Michael Moscheroschs Wunderlichen und wahrhafftigen Gesichten Philanders von Sittewald steht gleichwohl weder im inhaltlichen Sinne der normative Gehalt der Satire noch in erster Linie in sozialgeschichtlicher Perspektive deren faktische zeitgenössische Rezeption, sondern die Öffentlichkeit, insofern sie als intradiegetisch simulierte oder als fiktionalisierte faktische Öffentlichkeit zum Thema und – wie zu zeigen sein wird – zur Bedingung der Narration selbst wird.
Dabei verfolge ich die These, dass erst die konsekutive Publikation und mehrfache Erweiterung der Gesichte über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg diese Form der Öffentlichkeitsfiktion und -fiktionalisierung ermöglicht und damit zugleich das daraus resultierende Fortsetzungsgeschehen die Voraussetzung für die implizite poetologische Gattungsreflexion ist, die Moscheroschs Satire durchzieht. Daher sei die Publikationsgeschichte vorab kurz in Erinnerung gebracht.
Die Wunderlichen und wahrhafftigen Gesichte Philanders von Sittewald erscheinen in zwei Teilen, von denen jeweils mehrere, teils mehrfach überarbeitete Ausgaben vorliegen. Es handelt sich nach Arthur Bechtolds Kritischem Verzeichnis der Schriften Johann Michael Moscheroschs um folgende autorisierte Ausgaben:
- Der erste Teil erscheint ohne Angabe des Druckjahrs, ist aber datierbar auf 1640 und besteht aus sieben Gesichten, die im Wesentlichen eine Übersetzung der französischen Vorlage der spanischen Erzählsammlung von Francisco de Quevedo darstellen.2
- Zwei Jahre später, 1642, wird dieser erste Teil „Zum andern mahl auffgelegt von Philander selbsten/ vbersehen/ vermehret vnd gebessert“ und 1643 um einen zweiten, vier Gesichte umfassenden Teil ergänzt.3 (Diese Ausgabe B liegt dem Nachdruck des Olms Verlags von 1974 zugrunde und ist auf diesem Wege in der Forschung vergleichsweise breit rezipiert worden.4)
- Eine von B nur geringfügig abweichende dritte autorisierte Ausgabe liegt 1643 mit Ausgabe C vor, bei der die vier Gesichte des zweiten Teils unverändert bleiben.5
- Der „Andere Theil“ wird schon im Jahr darauf, 1644, als Ausgabe D noch einmal um ein fünftes und ein sechstes Gesicht ergänzt separat publiziert,6 bevor
- im Jahr 1650 mit Ausgabe E das Werk vollständig in zwei Teilen mit je sieben Gesichten vorliegt, „zum letztern mahl auffgelegt/ vermehret/ gebessert/ mit Bildnussen gezieret“, wie es auf dem Titelblatt heißt.7
- Die letzte rechtmäßige Ausgabe erscheint mit korrigierter Paginierung und einigen Änderungen wie aufgeschlüsselten Orts- und Personennamen 1665/66 (Teil II) bzw. 1677 (Teil I), ohne dass neue Gesichte aufgenommen worden wären, als Ausgabe F. Auf diese Ausgabe stütze ich mich im Folgenden, und zwar im Wesentlichen auf den zweiten Teil der Gesichte; der erste ist im vorliegenden Zusammenhang nur insoweit von Interesse, als seine Existenz im zweiten Teil thematisch wird.8
Diese Publikationsgeschichte der Wunderlichen und wahrhafftigen Gesichte Philanders von Sittewald geht unmittelbar in die Narration des zweiten Teils ein, und zwar in der Form mehrerer Gerichtsprozesse, die den gesamten „Anderen Theil“ durchziehen. Genau genommen sind es auf der Ebene erzählter Handlung im Wesentlichen diese Prozesse, die die sieben Gesichte untereinander sowie den zweiten Teil mit dem ersten verbinden. Insofern wäre Sylvia Brockstiegers Einschätzung, dass die Gesichte „weniger als kohärente, gar romanhafte Narration“ zu beschreiben seien denn „als eine Serie von satirischen Einzeltexten, die über zuweilen wiederkehrendes Personal und über den Erzähler und Protagonisten Philander […] miteinander verbunden sind,“9 für den zweiten Teil dahingehend zu modifizieren, dass die aufeinander folgenden Prozesse ein übergeordnetes narratives Grundgerüst für die Episodenstruktur bilden und so Fortsetzungscharakter haben.
Gegenstand der juristisch bzw. eher pseudo-juristisch ausgetragenen Auseinandersetzungen sind jeweils die schon veröffentlichten Teile des Werks, Philanders Autorschaft an denselben, damit einhergehende Fragen der Verantwortlichkeit für die Satire sowie schließlich gattungspoetologische Überlegungen. Was Philander als Protagonist und Erzähler vermag und darf, wirft immer auch ein Licht auf die Satire selbst. Damit werden nicht nur Modi und Instanzen der Urteilsbildung über die Gesichte innerhalb der Gesichte thematisch, sondern es stehen mit Philander, dem fiktionalen Autor und dem Werk Philanders Gesichte die Grenzen und Lizenzen der Gattung Prosasatire zur Verhandlung.10
1. Philanders erstes Urteil: „wider solche new vnd wälschsüchtige Sprach-verderber und Namenflicker/ in Teutscher sprach […] schreiben“
Auf der Flucht vor dem Hofleben ist Philander zu Beginn des „Anderen Theils“ auf der Suche nach dem Parnass – ein Umstand, der sogleich Licht auf seinen Doppelstatus als fiktionaler Autor und als pikaresker Protagonist wirft: Ist er in der ersten Funktion durchaus auf literarischen Ruhm aus, so ist der Reiz der Göttinnen der Künste für Philander auf der Handlungsebene ein ganz und gar profaner: „Da“, auf dem Musenberg nämlich, „glaubte ich sicherlich/ wirde ich alle tage Sauermilch vnd Bratwürst mit dem Apollo zobezehren“ (25).11 Schon wähnt er Pegasus auf sich zukommen, als er, von Reitern aufgegriffen, jäh aus diesen Einbildungen gerissen und zur Burg Geroldseck gebracht wird.12 Dort klagt ihn eine illustre Versammlung altdeutscher Helden der ‚Wälschheit‘ an, auf deren literarische Kontamination Wilhelm Kühlmann in einem wegweisenden Beitrag ebenso aufmerksam gemacht hat wie auf die daraus resultierende Fragwürdigkeit der Autorität dieser Helden.13
Vor diesem Heldenrat muss sich Philander nicht nur für den Verfall der Sitten im Allgemeinen und seine vorgebliche Wälschheit im Besonderen verantworten, sondern auch – und darauf kommt es im weiteren Verlauf der Narration an – für seine Autorschaft am ersten Teil der Gesichte. „[B]istu nicht der jenige der vor zwey Jahren die wunderliche Satyrische Gesichte geschrieben?“, wird er von Ariovist, dem „König Ehrenfest“, im Verhör gefragt:
So du nun ein Gebohrner Teutscher bist/ oder ja sein wilt/ was hastu dan für eine weise vnd manir zuschreiben? […] ist euch das Welsche Gewäsch mehr angelegen/ als die Mannliche Helden-sprach ewrer Vorfahren? was hast du in solchen Gesichten mit Welschen/ Lateinischen/ Grichischen/ Jtalianischen/ Spannischen Worten vnd Sprüchen also vmb dich zuwerffen gehabt? […] Solche Sprachverkätzerung ist anzeigung genug der Vntrew / die du deinem Vatterland erweisest (120–121).
Entgegen dem sorgfältig inszenierten Anschein von moralischer Autorität des Heldenrats gibt der Erzähler vorsichtig zu verstehen, dass der Prozess gegen ihn weder gerecht noch rechtmäßig verläuft.
Schon die Diskrepanz zwischen der erbaulichen emblematischen Gestaltung des Saals, in dem sich der Heldenrat versammelt, und dem Verhalten der Helden ist groß: „Hör/ vnd laß reden beyde Theyl/ Bedencks/ darnach so gib Urtheil“, mahnt etwa eine der „etliche[n] alte[n] Schrifften in die Wand gehawen“, die Philander sich vor dem Prozess abschreibt (45). Bei Gericht beobachtet er vor seinem eigenen Prozessbeginn Gegenteiliges:
Etliche sachen sahe vnd hörete ich alda schleinig vnd schier in einem huy außmachen/ vnd gleich Urtheil geben/ dessen ich mich verwunderte. Der Alte [Expertus Robertus] aber sagte mir/ das wäre die Vrsach/ weil zu jhrer zeit noch keine Advocaten oder Vorsprechen gewesen/ deßwegen die Händel desto weniger auffgezogen worden (64).
In der Verhandlung über den Vorwurf der ‚Wälschheit‘ nimmt der aus dem ersten Teil schon bekannte Expertus Robertus zwar die Rolle eines Ratgebers ein, nicht aber die eines förmlichen Anwalts Philanders. Ohnehin wird ihm kaum die Möglichkeit gegeben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen oder seine Unschuld zu beweisen. Als er in seiner Verteidigungsrede mit Bezug auf die Franzosen zu bedenken gibt, dass „sie nicht alle so böß sind“ und man „gute und böse vnder ihnen [findet]/ wie bey allen Mänschen“ (56), wird Philander sogleich unterbrochen und mehrfach ein „Schelm“ geheißen, sodass er sich wundert: „ist das ein König/ vnd würfft mit Schelmen also vmb sich!“ (57). Auch als er mit dem Hinweis auf „die Sorg vnd die Forcht deß Ellenden Lebens/ darin wir sind“, sein Verhalten verteidigt, lassen ihn die Helden „diese wort nicht wohl außreden“, bevor sie sich über Philanders „vnbedachtsame Einrede“ erzürnen und ihn „mit allen bösen Worten vnd Namen also beladen“ (110), dass er den negativen Ausgang der Verhandlung sogleich absehen kann.
Darüber hinaus ist der Heldenrat Kläger und Richter zugleich.14 Das Urteil „Jn sachen der Vralten Edlen Teutschen Helden/ als hoch-genöttigster Klägern/ an einem; vnd deß genandten Philanders von Sittewald/ Beklagten/ andern theils“ (133) wird schließlich in „einer Viertel stund“ (132) von Hans Thurnmeyer (Aventinus)15 verfasst, in Anwesenheit und auf Geheiß der Helden. Es verpflichtet Philander, „ohn gnädigste Erlaubnuß“ der Helden „auß [dem] Burg-zwang nicht zu weichen“ (134); er wird also zunächst einmal festgesetzt. Außerdem muss er „die welsche Trachten abschaffen: den Bart auff Teutsch wachsen lassen; die welsche Alamode-Kleydung einstellen/ sich Erbar vnd vntadelich tragen“ (134) und dergleichen mehr.
Die intradiegetisch zweifellos folgenreichste Bestimmung des Heldenrats lautet jedoch: Philander soll „die Muttersprach rein vnd vnverfälscht reden“ und sie „mit keinen fremden Wörtern beschmitzen noch vervnehren“ (136). Dies ist eine Weisung, die Philander aus Furcht vor weiterer Strafe so ernst nimmt, dass er sich im zweiten Gesicht „Hanß hienüber Ganß herüber“ sogar weigert, für den soeben angereisten Cicero zu übersetzen, und aufgrund seines Versprechens lieber „mauß still“ schweigt. Das wiederum bringt ihm den Vorwurf der Verzagtheit und Kleinmütigkeit ein (vgl. 191–192). Vor allem aber wird Philander verpflichtet, „wann vnd wie offt wir es von jhm erfordern werden/ wider solche new vnd wälschsüchtige Sprach-verderber und Namenflicker/ in Teutscher sprach (durch vermittelung eines auß vnsern alt-Teutschen-Geblüts Helden/ dem wir solches zubefürdern anlaß geben wollen) zuschreiben“ (136). Philander muss also seine Feder in den Dienst seiner Ankläger stellen.
Das Urteil des Heldenrats zu Philanders Sprachgebrauch schlägt sich damit unmittelbar auf der Handlungsebene nieder, denn seine Bedeutung für die darauffolgenden Gesichte geht weit über die Cicero-Episode hinaus. Anders als die weiteren im „Ala mode Kherauß“ vorgetragenen Welschheits-Vorwürfe zu Kleider-, Haartracht-, Essens-, oder auch sozialen Verhaltensmoden adressiert das Urteil, auf Geheiß des Heldenrats reines Deutsch zu schreiben, Philander nämlich doppelt: als handelnde Figur und als fiktionalen Autor der Gesichte. Entsprechend schreibt Philander im Folgenden, und zwar wie sein gattungskonformer Doppelstatus es nahelegt, die Gesichte, nun also den zweiten Teil bzw. zunächst einmal den „Ala mode Kherauß“. In ‚Teutscher Sprach‘ geschrieben, ist die Umständlichkeit und Verständlichkeit der langatmigen Lasterschelte – sie macht ja das Zentrum dieses ersten Gesichts aus – tatsächlich die buchstabengenaue Erfüllung des Urteils durch den Heldenrat, freilich erzählt aus Philanders Sicht, der nebenbei durchblicken lässt, dass ihm die Zeit „trefflich lang über all diesem Gespräch“ wird und „daß Stehen an einer stätte so saur/ daß [er] vor müde fast auff den Boden gesuncken“ wäre (105), ja dass ihm „die Augen zugehen wolten/ vnd daß [er] lieber zu Bett gewesen wäre“ (156).16 Solche Distanzierungsmarker eröffnen eine doppelte Perspektive und tragen, so Kühlmann, genauso wie „das bizarre Personal der literarisch kontaminierten Heldenschar keinesfalls dazu bei, die Autorität der rückwärtsgewandten Epochenkritik zu beglaubigen“.17
Indem Philander auf Geheiß des Heldenrats die Alamode-Schelte des ersten Gesichts schreibt, befolgt er sein Urteil, zeigt aber performativ auf, welche Folgen ein solches Schreiben für die Satire hat. Nicht nur relativiert sich die Kritik der mythologisch legitimierten moralischen Instanz der Helden „im Geflecht der fiktionalen Bezüge“, wie schon Kühlmann beobachtet hat, sondern auch in Anbindung an die menippeische Tradition der Anspruch der Satire insgesamt.18 Denn einmal abgesehen von der Müdigkeit, die solch langatmige Lasterschelte offensichtlich hervorrufen kann, ist mit der zweifelhaften Stellung des Heldenrats ein Grundproblem der Gattung angesprochen, die Frage nämlich, aus welcher Position heraus satirisches Sprechen überhaupt möglich ist bzw. ‚Straff-Schrifften‘ legitim sind. Satire steht mithin nicht nur vor der Schwierigkeit der Legitimation ihrer gattungskon- stitutiven moralischen Werturteile. Sie muss zudem überhaupt erst eine erzählerische Instanz schaffen, die ohne unbillige Anmaßung eines Richteramtes oder anderer performativer Widersprüche solche moralischen Werturteile zu fällen vermag – ein Problem, das in anderem Zusammenhang auch im „Schergen-Teuffel“, dem ersten Gesicht des ersten Teils, verhandelt wird, wie Maximilian Bergengruen demonstrieren konnte.19
Auf diese Weise zeigt der „Ala mode Kherauß“ die Gefahr an, dass persönliche Interessen oder eine starke Inszenierung der satirisch urteilenden Instanz, wie hier der literarisch-mythologischen Fundierung des Heldenrats, an die Stelle moralisch legitimierter Autorität tritt. Dass diese Gefahr tatsächlich besteht, beweist nicht zuletzt die Rezeptionsgeschichte der Gesichte. Lange wurde die deutschtümelnde und franzosenfeindliche Lasterschelte des „Ala mode Kherauß“ unter Ausblendung der narrativ und intertextuell angelegten Zweifelhaftigkeit von Philanders erstem Urteil ohne Weiteres als das inhaltliche Zentrum der Satire verstanden, mithin als Moscheroschs eigene Meinung.20
2. Philanders zweites Urteil: Der Freispruch „von der unnötigen Klag des Mutii Jungfisch und Don Unfalo“
1644 wird der zweite Teil separat publiziert und ergänzt um ein fünftes Gesicht, „Pflaster wider das Podagram“, sowie ein sechstes, das „Soldaten-Leben“ (Ausgabe D). Beide neuen Gesichte bringen neue Anklagen mit sich, sodass ein zweiter Prozess gegen Philander als Autor der Gesichte noch während seines unfreiwilligen Aufenthaltes auf der Burg Geroldseck angestrebt wird. Geklagt wird diesmal von einer Delegation verschiedener Berufsstände, die sich im ersten Teil der Gesichte verunglimpft und persönlich beleidigt sehen, wobei „Don Thraso Barbaviso, Don Vnfalo, vnd Mutius Jungfisch/ als Haupthändler vnd anhetzer“ (531) figurieren. Mutius Jungfisch ist dem Leser noch aus der Studentensatire des zweiten Gesichts des zweiten Teils in Erinnerung, in der dieser einen unrühmlichen Auftritt hat; auch Don Vnfalo taucht sowohl im ersten als auch im zweiten Teil namentlich auf. Dass hinter diesen Episoden persönliche Feindschaften stehen, in die Moscherosch verwickelt war, sei hier nur am Rande bemerkt.21
Anders als im ersten Prozess wird Philander nun nicht von einer sich als moralische Autorität gerierenden Heldenrunde über die Sprache und Form der Satire zur Rechenschaft gezogen, sondern von den drei Anklägern mit großem „Geschrey“ (527) des Pasquills beschuldigt:
Die Kerls brachten vor/ daß Jch Philander hiezugegen vor zweyen Jahren vngefähr ein Gesichten Buch geschrieben hätte/ welches sie zwar wegen etlicher guten Lehren vnd den zweck darhin es ziehlet/ nit zuschelten wüßten; doch aber weil sie in specie mehr als andere darin hart angezäpfft/ vnd schier an Ehren zu nahe angegriffen wären/ so hätten sie […] zu Rettung ihrer Ehren minder nicht thun können […]/ sich derselben Schmähwort wider ihn [Philander] zubeklagen/ wessen dann nicht minder die löbliche Zunfft der Herren Medicorum, Weinschenken/ Apothecker/ Gelehrten/ Frawenzimmer/ Hoff- vnd Kauffleute/ neben vielen andern ihnen sämptlich vollmacht vnd gnugsamen Gewalt ertheilet/ in ihrer aller Namen/ wo sie ihn Philander betretten möchten/ denselben anzuhalten/ Handvest zumachen/ vnd mit Recht dahin zuverweissen zulassen/ daß ihnen gnugsame Ersetzung ihrer Ehren durch ein öffentlichen Widerruf geschehen möchte (527–528).
Das gattungspoetologisch begründete Ziel der „guten Lehren“ steht somit nicht zur Disposition, wohl aber mit dem Vorwurf der Ehrantastung („an Ehren zu nahe angegriffen“) der Modus der Satire, das heißt ihre spezifischen Grenzen mit Blick auf Kritik an einzelnen Individuen. Was die Sprecher der sich verunglimpft fühlenden Berufsstände fordern, ist ein „öffentliche[r] Widerruf“ (528), doch zielen sie selbst zunächst nur auf die Wirkung ihrer halböffentlichen Rede, nicht auf eine förmliche Verhandlung. Ihre Beschwerde wird vor den ‚Ertzkönig‘ Ariovist gebracht, wo sie „mit allerhand greifflichen groben auffschnitten vermeynten […] es beym Richter dahin zu bringen/ daß auff ihr bloses angeben/ ich [Philander]/ also vngehört/ gleich in Thurn geworffen/ vnd hernach zum Widerruff gezwungen/ endlich aber ins Elend verwisen wirde“ (531). Als Lästerung wird in diesem Sinne bezeichnet „wo man ausser dem Gerichts zwang/ in gemeinem Gespräch/ übel von einem redet/ vnd niemand läst zur verantwortung kommen“ (532). „Lästerer“, so heißt es explizit, „haben im brauch/ […] daß sie das Gericht vnd Recht fliehen als der Teuffel das Creutz/ weil sie wissen/ da müsse ein ding erwisen seyn/ oder erlogen“ (533–534).
Philander allerdings – womöglich klug geworden aus der Erfahrung in seinem ersten, denkwürdigen Prozess – besteht auf eine „formliche Klag“ und ein ordentliches gerichtliches Verfahren: „Auff vnformliches vngerichtliches Geschrey“ sei ein Ehrenmann „nicht schuldig zustehen/ auch wäre es einem sich dergestalt zuerwehren vnmüglich“ (529). Entsprechend werden die Lästerer zunächst dazu angehalten, ihre Klage schriftlich vorzubringen, „weil solch vnordentlich Gespräch letztlich nur ein Gewäsch gebe“ (536), auch wenn diese Praxis „wider alt-Teutsches herkommen sein möchte“. So könne man „die Puncten der Klagde desto besser erwegen“ (537). Der Hinweis auf die Vorteile einer den römischen, nicht den germanischen Rechten entsprechenden schriftlichen Anklage lässt einmal mehr Philanders erstes Urteil durch den Heldenrat in zweifelhaftem Licht erscheinen.
Das Schriftstück, das die ‚Lästerer‘ Don Thraso Barbaviso, Don Vnfalo und Mutius Jungfisch daraufhin präsentieren, rollt noch einmal die Thematik des „Ala mode Kherauß“ auf: Die Klage wird zunächst abgewiesen, weil sie undeutsch formuliert sei. Für Philander bedeutet das zunächst einen Freispruch:
GEgenwertig-eingegebene/ mit Welschen Worten geschendete vnteutsche Schrifft ist vnwürdige geacht/ daß sie vor dem Heldenraht/ […] hätte abgelesen werden sollen: Derowegen auch Beklagter so fern loß erkant worden. Doch vorbehalten den Klägern/ für ein vnd alle mahl/ ihre Klagde […] in formlicher Teutscher Sprach einzulegen/ so sie wollen: damit so dann in der Sache erkant werden möge/ was recht ist (543).
Mit diesem Aufschub des Prozesses, einem echten Cliffhanger, endet das fünfte Gesicht. Erst im darauf folgenden „Soldaten-Leben“ wird die sprachlich bereinigte Klageschrift akzeptiert, in der Philander unter Angabe der gesetzlichen Grundlage vorgeworfen wird, die Kläger „in seinen titulirten Gesichten/ auff allerhand weiß vnd weg Ehren- verletzlichen anzugreiffen“ (573). Das mit dem Reichs-Abschied zu Speyer von 1541/42 und der Policey-Ordnung von 1548 zitierte Verbot von Schmäh-Schriften bezieht sich zwar keineswegs direkt auf Satiren, sondern ist im Kontext der Reformation entstanden, wird aber tatsächlich in der Folge auch insgesamt auf Klagen gegen ehrverletzende Schriften angewendet.22 Recht allgemein wird in der Policey-Ordnung bestimmt, dass Druckveröffentlichungen nur genehmigt werden sollen, wenn sie „nicht auffrührisch oder schmählich [sind], es treffe gleich hohe, niedrige, gemeine oder sondere Personen an“.23
Die Anklage gegen Philander lautet dementsprechend auf Pasquill, womit sich die Satire innerhalb der Satire gegen den in der Gattungstradition geradezu topischen Vorwurf rechtfertigen muss, unter dem Deckmantel gerechtfertigter Kritik persönlichen Angriffen zu dienen. Denn obwohl, etwa nach Albrecht Christian Rotths Poetik, die hier beispielhaft für eine Poetik des 17. Jahrhunderts stehen möge, der Satiriker „mehrentheils auf gewisse Personen sein absehen hat“, mithin von den Lastern konkret und „nicht nur insgemein […] redet“, gehe es doch nicht an, dass er „mit seinen Satyrischen Schrifften […] denckt sein Müthgen zu kühlen/ die Leute nur durch zuhüpeln und zu diffamiren“. Wer also Satire aus persönlichen Gründen ad personam adressiert, „der verfehlet des rechten Zwecks“.24
Dass Verleumdung tatsächlich das Wirkziel der Satire gefährdet, wird ironischerweise nicht dadurch zugestanden, dass den Klägern Recht gegeben würde, sondern umgekehrt dadurch, dass der Erzähler selbst Opfer einer Verleumdung durch diejenigen wird, die seine Satire als Pasquill verbieten lassen wollen. In der Folge ist Philander gezwungen, die Burg heimlich zu verlassen und sich als marodierender Soldat durch den Dreißigjährigen Krieg zu schlagen. Schließlich wird seine Bande versprengt, Philander erneut in der Nähe der Burg Geroldseck aufgegriffen und dieses Mal sofort in den Kerker geworfen. Auf ihn wartet die Fortsetzung seines Prozesses, wobei die Anklage durch Mutius Jungfisch und Konsorten um seine Verbrechen als Soldat erweitert ist: „Dann über das/ was wegen der Gesichten sie wider dich geklagt/ so haben sie ietzund die Klagde vmb so viel/ als du vngebür im Soldaten-Leben verübet haben magst […] gehäuffet“ (822). Doch die kurze Verhandlung verläuft schließlich unspektakulär: Philander wird als Verfasser des ersten Teils der Gesichte vom Vorwurf des Pasquills freigesprochen, wohl auch wegen des schlechten Leumunds der Kläger. Die Frage, wo die Grenze zwischen erlaubter Ständesatire und ehrverletzender Personalsatire verläuft, wird damit nicht explizit geklärt, wohl aber durch den Verlauf dieses Prozesses insgesamt dahingehend beantwortet, dass sich an der Reaktion der Adressaten bis zu einem gewissen Grad ablesen lässt, inwieweit die Satire überhaupt trifft. In diesem Sinne ist das Zustandekommen von Philanders zweitem Urteil die narrative Ausbuchstabierung des bekannten apologetischen Arguments, durch Satire könne sich nur jemand getroffen fühlen, der die beschriebenen Laster an sich habe: „die jenige/ welchen diese meine Schrifften übel gefallen/ müssen selbige entweders auß mangel Verstands nicht begreiffen/ oder aber wegen selbstbekandter tückköpffischer Schalckheit […] sich im Gewissen nicht wol staffiret befinden“,25 heißt es schon in der Vorrede zum „Schergen-Teuffel“, dem ersten Gesicht des ersten Teils. Ex negativo wird mit der „auß eigener Rachgierde“ (825) wiederholt eingegebenen Klage der Lästerer daher nicht nur eine Aussage über die Grenzen und Lizenzen der Prosasatire in Abgrenzung zum Pasquill getroffen, sondern auch intradiegetisch ein Szenario fehlgeleiteter Rezeption entworfen.
Soweit die erweiterte Anklage aber Philanders ‚Kriegshändel‘ betrifft, wird sie bezeichnenderweise erst gar nicht zugelassen. Satire, so könnte man daraus folgern, kann als Strafschrift allgemein über den Verfall der Sitten richten, und sie kann, wie es der zweite Teil insgesamt demonstriert, als Literatur über sich selbst richten. Was sie nicht ersetzen kann, ist eine weltliche Gerichtsbarkeit. Philanders Verbrechen aus dem „Soldaten-Leben“ bleiben innerhalb der Gesichte ungestraft, weil das satirische Schreiben angesichts des Krieges versagt und sich in diesem Sinne selbst als die nicht zuständige Instanz beschreibt.26
3. Philanders drittes Urteil: Der „Befehl […] es bey disen zweyen Theilen so fürohin verbleiben […] lassen“
Gegenstand der zwei bislang geschilderten Verhandlungen im zweiten Teil der Gesichte Philanders von Sittewalt ist der erste Teil der Gesichte, für den sich der Protagonist Philander der Fiktion nach als Autor rechtfertigen muss. Die Fortsetzung der Satire gebiert allerdings auch die Fortsetzung der Prozesse um Philander. Bevor dessen Widersacher Ende des sechsten Gesichts „Soldaten-Leben“ endgültig abtreten, überreicht Mutius Jungfisch dem Heldenrat ein weiteres Buch, damit „zu gemeinem Nutzen […] alles ärgerliche vnd vffrührische/ nach Vberlesung/ darinnen verzeichnet/ vnd beschnitten oder gar abgeschafft werde“ (826). Das klingt nach einer klassischen Metalepse – das „Soldaten-Leben“ gehört ja selbst zum zweiten Teil –, ist es aber nicht: Der zweite Teil war ja schon 1642 in der Ausgabe B mit zunächst vier Gesichten publiziert und erst im Jahr 1644 in der Ausgabe D um weitere zwei Gesichte, „Pflaster wider das Podagram“ und „Soldaten-Leben“, ergänzt worden; gemeint ist also die zuerst separat publizierte unvollständige Ausgabe.
Gefordert wird eine Untersuchung der zwischenzeitlich erschienenen ersten vier Gesichte des zweiten Teils, und Philander muss geloben, bis zum endgültigen Ausgang des Prozesses auf Burg Geroldseck zu bleiben. Schließlich wird ihm ein Bescheid übergeben, der den satirischen Zweck und damit den Nutzen des Werks grundsätzlich anerkennt:
Demnach es eine Staats-Nothdurfft erachtet worden/ auff vnterthänigste verschiedener Orthen her eingelangte Andungen/ des so genandten Philanders von Sittewalt zwey Gesichten-Bücher/ überlesen/ vnd fleissig durchgehen zulassen/ vmb/ was in denselben zu ändern sein möchte/ zuersehen: so ist nach reiffer Erwegung alles dessen so darinn begriffen/ funden worden/ daß zwar Hauptsächlichen/ Er/ Philander/ dahin gehet/ die heutigs tags in vnserm betrübtem Vatter-Land gangbare und giltige Vntugenden vnd Thorheiten dergestalt/ mit Schertz vnd Lust-Reden/ den Menschen verhaßt zumachen/ als welche nicht leiden mögen noch wollen/ daß man ihnen ihr Vnrecht mit Ernst vorhalte vnd abwehre: welcher Zweck/ wie er an sich selbsten gut/ also ist er auch nicht zu verwerffen (828–829).
Doch der Heldenrat sieht potenziellen Änderungsbedarf in der stilistischen Ausgestaltung sowie der inhaltlichen Gewichtung der dargestellten Laster. Da „viel Dinge in gedachten Büchern hätten förmlicher/ zierlicher gebührlicher/ verantwortlicher […] vorgebracht/ auch theils gar aussen gelassen werden“ können und Philander womöglich „einem Theil zu viel/ dem andern zu wenig gethan“ habe, könne der falsche Eindruck entstehen, die Gesichte seien „auß Vorwitz/ auß Rachgier/ auß Vnverstand/ auß Thorheit/ auß Frevel zusamen geschrieben“ (829–830). Satirische Prosa muss um ihrer öffentlichen Wirksamkeit willen mithin den Eindruck vermeiden, unverhältnismäßig, anmaßend oder persönlich motiviert zu sein. Daher wird der Fall zur Prüfung an eine höhere Instanz verwiesen und im letzten Gesicht „Reformation“ abschließend verhandelt.
So ist vor dem Hochadelichen Rath [dem Heldenrat] für thunlich/ auch nötig erachtet worden/ gedachte zwey Gesichten-Bücher dem Reformations-Rath anheimb zu übergeben/ […] vnd was sie so dann zu ändern/ zu mehren/ zu mindern/ außzustreichen/ bey zusetzen/ zu erläutern/ zu erklären fugsam befinden mögen/ dem sol gedachter Philander nach zu leben wol geruhen (830).
Dieser Reformations-Rat kommt in einem Palast im Palmengarten außerhalb der Burg zusammen und trägt die Züge der Fruchtbringenden Gesellschaft, der die Kompetenz und Machtbefugnis zugesprochen wird, gerecht über das Werk zu urteilen:
Details
- Seiten
- 552
- ISBN (PDF)
- 9783034347907
- ISBN (ePUB)
- 9783034347914
- ISBN (Paperback)
- 9783034344654
- DOI
- 10.3726/b21353
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (April)
- Schlagworte
- Literaturgeschichte Frühe Neuzeit Johann Michael Moscherosch 17. Jahrhundert Satire Roman Gelehrsamkeit
- Erschienen
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2025. 552 S., 23 farb. Abb., 18 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG