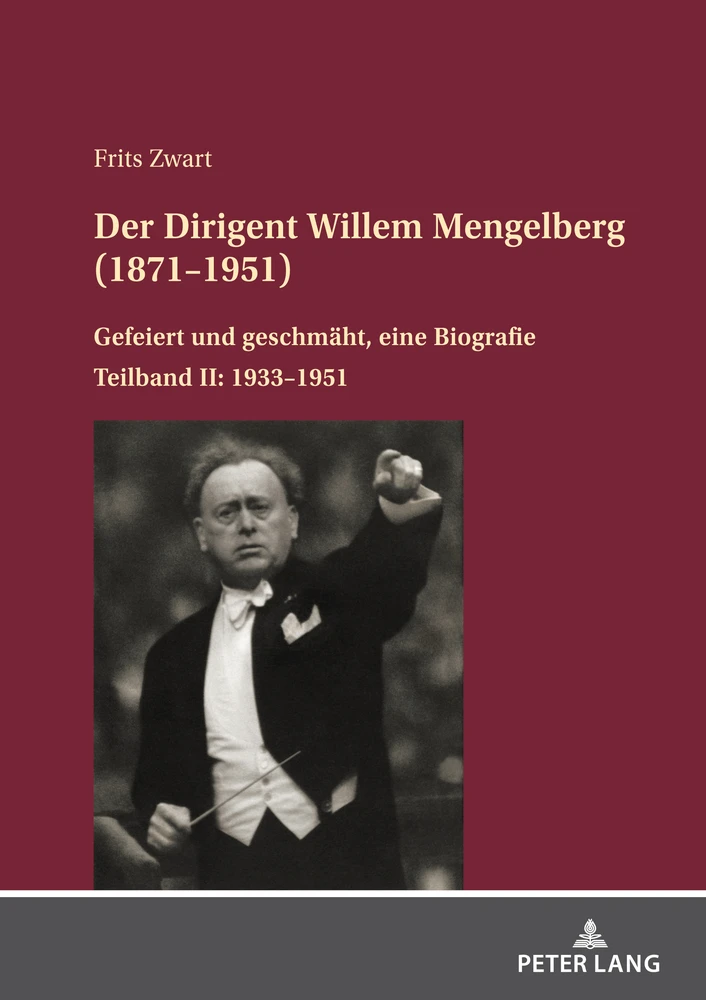Der Dirigent Willem Mengelberg (1871–1951)
Gefeiert und geschmäht, eine Biografie – Teilband II: 1933–1951
Zusammenfassung
Darüber hinaus war Mengelberg ein wichtiger Förderer zahlreicher Komponisten wie Gustav Mahler und Richard Strauss sowie Begründer der jährlichen Aufführungen von Bachs Matthäuspassion in den Niederlanden. Als Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters entwickelte Mengelberg das Ensemble zu einem der renommiertesten der Welt und verschaffte seiner Residenzstadt ein Musikleben von internationalem Rang. Seine musikalische Karriere wurde allerdings durch seine umstrittene Rolle während des Zweiten Weltkriegs überschattet.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Teilband II: 1933–1951
- Siebte Periode 1933–1940
- Willem Mengelberg aus Sicht der Musiker
- Achte Periode 1940–1945
- Neunte Periode 1945–1951
- Die unbestrittene Bedeutung des Dirigenten Willem Mengelberg
- Anhang 1 Brief W. Mengelberg an W. Hutschenruyter, 12. Januar 1903
- Anhang 2 Aufzeichnungen und Notizen von Mengelberg für den Vorstand des Concertgebouw, Dezember 1903
- Anhang 3 Auszüge aus Interviews mit Mengelberg in New York
- Anhang 4 Amerika: Übersicht Solisten und Repertoire, Erstaufführungen 1921–1930
- Anhang 5 Reflexion über Mengelberg in New York von Joseph Deems Taylor
- Anhang 6 Interview mit Dr. Hans Erman im Völkischen Beobachter, 5. Juli 1940
- Anhang 7 Brief von Hermann Scherchen an Willem Mengelberg, 18. Juni 1933
- Anhang 8 Übersicht über die Kompositionen von Willem Mengelberg
- Anhang 9 Werke von Mahler, aufgeführt von Mengelberg 1904–1940
- Anhang 10 Werke von Gustav Mahler, aufgeführt von Willem Mengelberg als Dirigent der Frankfurter Museums-Gesellschaft 1907–1920.
- Anhang 11 Werke von Gustav Mahler, aufgeführt von Willem Mengelberg als Dirigent des National Symphony Orchestra (1921) und des New York Philharmonic (1922–1930).
- Anhang 12 Übersicht über Willem Mengelbergs Konzerte im Ausland 1898–1944 (Liste zusammengestellt in Zusammenarbeit mit Eric Derom)
- Anhang 13 Überblick über das Repertoire von Willem Mengelberg
- Anhang 14 Diskographie
- Archive: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut/Haags Gemeentearchief
- Bibliographie
- Herkunft der Abbildungen
- Namensindex
Siebte Periode 1933–1940
Mengelberg: Interesse für Politik
Verbundenheit mit dem deutschen Volk
Mengelberg verfolgte die Ereignisse in Deutschland nach Kriegsende 1918 aus nächster Nähe. Er kam dort oft hin, sprach seine Freunde, besuchte seine Ärzte in Frankfurt und war über das Geschehen vor Ort gut informiert. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg fühlte er mit dem deutschen Volk mit. Er teilte die Empörung über das Strafmaß und die drakonischen Bedingungen des Vertrags von Versailles und dessen Folgen. Die Alliierten hatten mit diesem Strafmaß Deutschland beispielsweise enorme Wiedergutmachungszahlungen auferlegt. 1923, das Jahr der französischen Besetzung im Ruhrgebiet – als Folge eines Rückstands an Wiedergutmachungszahlungen –, hat er natürlich intensiv erlebt, die zahllosen Unruhen, die ausbrachen und im Anschluss eine katastrophale Inflation, die Mengelberg selbst – und mit ihm zahllose andere – den größten Teil seines ersparten Vermögens kostete. Einige Jahre später gingen Mengelbergs Guthaben in Amerika durch den Börsenkrach in New York am 24. November 1929 verloren. Für die meisten europäischen Länder war der sogenannte Börsenkrach in New York verhängnisvoll. Für Deutschland war der Crash dramatisch, weil sich gerade einige Stabilität und Erholung eingestellt hatte. 1932 war die Zahl der Arbeitslosen etwa auf sechs Millionen gestiegen.
Mengelberg stand gänzlich hinter Deutschland, und dass er ebenso wie zahllose Deutsche sich von Hitler angesprochen fühlte, verwunderte nicht: Dort musste hart gearbeitet werden, die Deutschen mussten solidarisch sein, Selbstbewusstsein entwickeln, für ihr Land aufkommen und sich anschließen. Adolf Hitler führte sie in eine neue Zukunft und von vielen wurde er als ein Messias betrachtet.
Einige meinten, dass Mengelberg nie eine Zeitung gelesen habe und nicht wisse, was in der Welt passiert, aber das stimmt nicht. Viele Kritiken seiner Konzerte sind erhalten, auf die er mit seinem „Dirigierbleistift“ in Rot oder Blau Worte oder Absätze unterstrich. Manchmal schrieb er einen Kommentar dazu, der mit Ausrufe- oder Fragezeichen versehen war. Mengelberg sagte oft, dass man nicht alles glauben dürfe, was die Tageszeitungen schreiben, aber daran hielt er sich selbst nicht. Er las nicht nur Rezensionen, auch die Weltnachrichten verfolgte er, wenn er Zeit dafür hatte, also vor allem während der Ruhephasen in seiner Chasa, denn dann war er ganz von seiner Arbeit absorbiert.
In der Schweiz ließ sich Mengelberg verschiedene Tageszeitungen zuschicken. Während der Phase des „Rückzugs“ in Zuort von Juli 1933 bis April 1934 vertiefte er sich intensiv in das Gedankengut der NSDAP. Die wichtigste Quelle dafür war die Nazi-Tageszeitung Völkischer Beobachter. Der nannte sich das „Kampfblatt der national-sozialistischen Bewegung Grossdeutschlands.“ Anhand erhaltener Rechnungen lässt sich zurückverfolgen, dass Mengelberg tatsächlich das Naziblatt mit einiger Regelmäßigkeit, manchmal Monate hintereinander erhielt. Daneben las er Zeitungen wie De Telegraaf, De Maasbode und die Neue Züricher Zeitung, die ihm auch nach Zuort geschickt wurden.

Rudi Mengelberg soll einmal gegenüber Willem Sandberg, dem späteren Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam, gesagt haben, dass Mengelberg nur den Völkischen Beobachter las.2497 Das war natürlich eine karikierte Darstellung der Angelegenheit. Das galt auch für die Bemerkung von Johan Koning, Mengelbergs Impresario von 1936 an. Dieser sagte später, dass Marianne Günther ihn „immer falsche Sachen [hatte] lesen lassen. Wenn er um eine Zeitung bat, gab sie ihm den Völkischen Beobachter.“
Auch andere Mitglieder der Familie Günther hatten laut Koning schlechten Einfluss auf Mengelberg.2498 Aber seine Frau Tilly muss dabei ebenso eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ein Enkel von Mengelbergs Schwester Katharina, Paul R. Th. Zander ter Maat, ist davon überzeugt, dass Tilly in politischer Hinsicht fatalen Einfluss auf Willem hatte.2499 Koning lieferte eine wirklich sehr simple Darstellung der Angelegenheiten, als ob Mengelberg keinen eigenen Anteil daran gehabt habe.
Mit großer Aufmerksamkeit las Mengelberg die Artikel in dem Völkischen Beobachter des Parteiideologen Alfred Rosenberg oder über die Sport- und Turngemeinde Kraft durch Freude. Er verfolgte die Berichterstattung über Österreich und über Bundeskanzler Dollfuss. Oft markierte er kurze Berichte, die Geld thematisierten oder im Allgemeinen mit Finanzen zu tun hatten: Über den Stand von Gold, über die Vereinfachung der Einkommenssteuer. Er notierte Ausrufe dazu – „oh! Armer O. H. [Onkel Hausfrau]“ – und zeigte damit seine eigene Betroffenheit.2500 Er war an deutscher Politik interessiert, an politischen Entwicklungen. Auch über Themen, die mit seiner eigenen Situation zu tun hatten, las er mit Neugier. Sein Interesse oder sogar seine Zustimmung signalisierte er durch Unterstreichungen in Rot und Blau, Ausrufezeichen, Fragezeichen und Urteile, so wie „Bravo.“
Die NSDAP, von der Mengelberg begeistert war, zeichnete sich durch ein starkes Selbstbewusstsein, außerordentliche Energie und nicht zu übersehende Zielstrebigkeit aus. „Sozialistisch“ bedeutete hier sozial mit Aufmerksamkeit für „Das Volk“, mit sozialen Regeln, Erneuerung der Gesellschaft, der Familie und der Familienwerte, Einheit, Selbstbewusstsein, Kraft und „Reinheit“ des deutschen Volkes.
Die Errichtung eines neuen deutschen Reichs, das Bündeln der Kräfte, Einheit unter dem deutschen Volk, Arbeitsethos, Vertrauen (in den Führer), Vaterlandsliebe, das Vaterland an vorderster Front, das neue Deutschland. Das waren alles Begriffe, die seine Vorstellungskraft anregten und die er für wertvoll hielt. Es waren Begriffe, die ihn ansprachen und wenn sie es nicht taten, gab es die charismatische Figur, Adolf Hitler, der Deutschland begeistern konnte, helfen konnte, wieder Selbstachtung zu gewinnen und der Nation erneut zu Ansehen zu verhelfen. Dann würde das große und mächtige Deutschland mit seinem sehr großen kulturellen Vorleben seinen Platz innerhalb Europas zurückerobern und wieder das Prestige gewinnen, auf das es Recht habe.
Außer für die Anführer des Dritten Reichs zeigte Mengelberg Interesse an den Parteistandpunkten und was diese für das gesellschaftliche Leben bedeuteten, beziehungsweise an den politischen Haltungen. Nachdem er im Januar 1934 den Bericht „Die Deutsche Akademie deckt sich völlig mit den Anschauungen der Reichsregierung“ gelesen hatte, strich er stolz an: „O. H. ist Ehren Verwalter der D. A.“2501 Nur knapp ein halbes Jahr zuvor wurde er nämlich zum außergewöhnlichen Senator der Deutschen Akademie in München berufen.2502
Im Dritten Reich ginge es nicht nur um Wissen, sondern auch um Kraft, so stand es im Januar 1934 im Völkischen Beobachter. Das höchste Ideal war der Menschentypus der Zukunft, in dem sich ein brillanter Geist in einem wunderbaren Körper befinde. Es folgten Sätze über die Bedeutung von Sport sowie die Sport- und Turngemeinde Kraft durch Freude: „Bravo, alle lesen“, schrieb Mengelberg.2503
Im Völkischen Beobachter, in dem geschrieben wurde, dass unter der neuen Führung in Deutschland die Unabhängigkeit der Rechtsprechung geschützt sei, schrieb Mengelberg „Bravo, lesen.“2504 Wollte er sich auf diese Art nicht durch andere, beunruhigende Berichte aus der Ruhe bringen lassen? Aber vielleicht hatte er durch seinen ausgedehnten Aufenthalt in der Schweiz noch wenig alarmierende Berichte aus Deutschland bekommen.
Der Artikel Nationalsocialismus als Grundlage des neuen Deutschen Reichs im Völkischen Beobachter vom 26. Januar 1934 „musste“ von allen in der Chasa Mengelberg gelesen werden: „alle, alle, alle lesen!!“ Mit Aufmerksamkeit las er die Worte von Rosenberg, der erklärt hatte, dass die nationalsozialistische Regierung tat, was sie sagte – im Gegensatz zu vorherigen Regierungen in Deutschland – ohne die Gefahr, dass andere Parteien die Beschlüsse durchkreuzten. Der Führer habe Initiativen ergriffen, es hinge jetzt von Frankreich ab, ob positiv weitergearbeitet werden könne. „Deutschland will keine Armee, um andere Völker zu überfallen.“ Das unterstrich Mengelberg mehrfach.2505 Er hatte eine Abscheu gegenüber Gewalt. Um seine Bestürzung bei der Aufzählung von Verwundeten, von Verhaftungen oder anderen Katastrophen zu äußern, schrieb er „oh, oh!!“, auch mal versehen mit seinen Chasa-Initialen. „Paris im Fieber, 90 Verletzte und 700 Festnahmen“, lautete eine Schlagzeile. „Ohh! Oh!!! O. H.“, kritzelte er dazu.2506 Aber das „oh“ zeugte auch von seinem Unglauben und Misstrauen, beispielsweise in dem Bericht, in dem der französische Außenminister sagte, dass sein Land immer die friedliebenden Länder um sich scharen wolle, nicht um Deutschland einzukreisen, sondern um mit allen Völkern zusammenzuarbeiten. Das wurde von Mengelberg mit einem Fragezeichen versehen und einem „oho!!“ Damit war er nicht einverstanden. Im Hinblick auf Deutschland war er auch ziemlich interessiert an der französischen Außenpolitik. Die „Ungünstige Aufnahme des Kabinetts Daladier in der Kammer“ verdiente ihm zufolge „Ein: ‚bah!‘ und: ‚oh‘ über diese Parlamentarischen ‚Parteien Politiker‘!“2507
Mengelberg betrachtete Deutschland als Opfer der alliierten Mächte und die Schlagzeile „Der Volksbund, ein einseitiges Machtinstrument der Siegermächte“, versah er dann auch mit einem zustimmenden „Bravo!“2508 In diesem Zusammenhang ist die Bemerkung von Ellie Bijsterus Heemskerk bedeutsam, die sich später erinnerte, dass Mengelberg keinen großen Unterschied zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg spürte.2509
Artikel, die er auch für andere Chasa-Bewohner interessant fand und ein „Bravo“ bekamen, haben Zeilen wie „Die Bauern als Fundament für den Staat“ und „Die SA muss gezielt Herrschernaturen ausbilden.“ Und dann noch der Artikel über „Die Dekadenz der weissen Völker“, in dem betont wird, dass Europa zu wenig Bevölkerungswachstum habe und sich das ändern müsse. Es würde noch einen schweren Kampf geben, ehe „wir“ wieder neben vollen Wiegen stehen. „Leider ist es wahr bravo O.H. alle lesen“, so meinte Mengelberg.2510
Auch die „Unterdrückung“ der Deutschen in Österreich beschäftigte Mengelberg. 1934 sollte das entscheidende Jahr werden, das Jahr des Sieges, so wie Theo Habicht (Landesinspektor der österreichischen NSDAP), der den Aufstand in Österreich vorbereitete, in seiner Neujahrsbotschaft formulierte. Und auch das wurde von Mengelberg angestrichen, ergänzt mit dem Hinweis „lesen!!! O.H..“2511
Die Berichterstattung über die Einweihung des Denkmals zur Erinnerung an den „Märtyrer“ SA-Sturmführer Horst Wessel, der 1930 getötet wurde, las Mengelberg gründlich.2512 Jeder musste einen Artikel über Die Nationale Front in der Schweiz lesen, über Nazis in der Schweiz, denn genau wie in Frankreich und den Niederlanden versuchten die Emigranten, d. h. diejenigen, die Deutschland verlassen hatten, ihren Hass auf Deutschland in der Schweiz zum Ausdruck zu bringen und warnten offenbar Mitglieder dieser Nationalen Front davor.2513 Dabei ging es natürlich vor allem um die Juden.
Alles, was mit Marxismus und den Juden zu tun hatte, beispielsweise, wenn es um das deutsche Volk ging, das nach dem Ersten Weltkrieg durch jüdische und marxistische Ansichten verdorben wurde, las Mengelberg mit Aufmerksamkeit. Ein Bericht, in dem stand, dass ein gewisser Pfarrer Senn behauptete, dass der Kampf von Hitler eine gewaltige Abrechnung mit dem Weltjudentum war, das er „der Todfeind der Menschheit ist“, versah er mit einem „oh!“ Es scheint so, als ob Mengelberg wegen dieser dreisten Behauptung getroffen worden wäre. Der Schlussfolgerung, dass die Deutsche Nationalhymne den jüdischen Schlager besiegen, dass die Dichtung gereinigt und dass sich der Mensch zu Gott erheben müsse, sodass der Text „Reinheit“ bringe, fügte er „Bravo“ hinzu.
Mengelbergs Interesse für die Juden, so wie es sich auch aus den markierten Zeitungsausschnitten von 1933 und 1934 ablesen lässt, war nicht neu. 1924 beschäftigte er sich eingehend mit Das Rätsel des jüdischen Erfolges, ein Buch aus dem Jahr 1923 von F. Roderich-Stotheim. Mit sehr viel Interesse studierte er Seite für Seite dieses äußerst rassistische Buch, in dem das Augenmerk vor allem auf das Verhältnis zwischen den Juden und der Finanzwelt gelegt wird. Die „Hebräer“ werden darin als kapitalistische Machthaber geschildert. Mengelberg strich beinahe jedes Wort an, aber er enthielt sich Kommentaren wie „Bravo“ oder anderen Formen der Zustimmung. Offensichtlich las er das Buch vor dem Hintergrund seiner eigenen finanziellen Situation. Er scheint sich von den Argumenten des Autors überzeugen zu lassen, dass die Juden versuchen, die gesamte Menschheit unter Hypnose zu setzen, um damit alle Staaten und Völker zu beherrschen.2514 Die Menschheit würde laut Roderich-Stotheim erst Ruhe und Frieden finden, wenn die Macht der Juden gebrochen sei. Um das zu erreichen, sei man laut Autor auf dem guten Weg, denn in verschiedenen Ländern erschienen anti-jüdische Zeitschriften und Bücher. Am Ende der Schrift notierte Mengelberg: „Wir werden mal das Beste hoffen.“
Die Rede von Goebbels über das Jahr 1933 der deutschen Revolution sollten „alle lesen.“ Wie stand es um Deutschland, fragte sich Goebbels. „Die öffentliche Meinung wurde nur von Juden geprägt. Berlin war nicht mehr eine Deutsche Stadt.“ Diese stark anti-jüdische Rede bekam Mengelbergs volle Aufmerksamkeit und er strich alles an.2515 Beifall mit einem Bravo oder dergleichen gab es übrigens nicht von ihm. Die Aussagen von Goebbels fand er vielleicht zu heftig. Kurz zuvor hatte er noch eine Anzeige unterstrichen: „bestellen bitte O.H..“ Es handelte sich unter anderem um ein Buch von Charlotte Köhn- Behrens, Was ist Rasse, eine Sammlung von Interviews mit „Forschern“ auf diesem Gebiet.2516
Stimmte Mengelberg zu, dass die Juden überall die Schuld bekamen? Hegte er Groll gegen sie? Möglicherweise misstraute er ihnen in der Finanzwelt, aber bestimmt nicht in der Musikwelt. In seiner Arbeit ließ er keinen einzigen Zweifel aufkommen, dass er jüdische Musiker weniger achten würde, im Gegenteil. Sein Freund Mahler war der beste Beweis dafür und auch Mendelssohn fand er einen großen Komponisten. Dieser hatte darüber hinaus die Musik der Matthäus-Passion von Bach wiederentdeckt. Er pflegte ferner zahllose freundschaftliche Kontakte mit Musikern jüdischer Herkunft. Wie viele Solisten hatten einen jüdischen Hintergrund? Und dann „die normalen“ Musiker in den Orchestern. Mengelberg hat bei seinen Musikern nie einen Unterschied gemacht. Wichtig war für ihn, dass jemand ein guter Musiker ist. In dieser Hinsicht konnte er also den Nazis nicht folgen. Das betonte er auch in München 1938, aber dazu später mehr Information. Vermutlich fand er den in Deutschland herrschenden Antisemitismus eine ärgerliche Begleiterscheinung, dem allerdings schwer zu entkommen war. Vielleicht musste er selbst antisemitische Gefühle bekämpfen und hatte zumindest „leichte“ antisemitische Vorurteile. Das könnte dazu beigetragen haben, die gröberen Ausdrücke zu akzeptieren. Im gesellschaftlichen Leben in den Niederlanden gab es auch viel Aufmerksamkeit im Hinblick auf jüdische Tendenzen. Manchmal spürte er einen Groll und äußerte sich auf unangenehme Weise über Juden. Darüber schrieb Nora ab und zu, dass er über Juden herzog. Die Haltung schien Tilly zu fördern.
Aus seiner Zustimmung wird deutlich, dass Mengelberg auch bei Erbkrankheiten gegen die Fortpflanzung war und die Meldepflicht für Träger von Erbkrankheiten begrüßte. Die medizinischen Artikel im Völkischen Beobachter mussten auch von „o. Hermann“ (Onkel) Hermann Günther, Arzt und ein Bruder von Marianne gelesen werden.2517 Hermann kam kurz darauf nach Zuort und gehörte auch zu dem kleinen Kreis, mit dem Mengelberg seine Auffassungen teilte. Das geht deutlich aus dem hervor, was er nach seinem viertägigen Aufenthalt in der Chasa im Februar 1934 ins Gästebuch schrieb:
In diesen Tagen stieß ich auf die alte Runenschrift von Ur-Zuort. Sie ist aufgezeichnet zwischen Kapelle und Haus, zwischen Berg, Wald und Tal, zwischen strahlendem Tageshimmel und nachtklarem Firmament. Es fand sich dort u.a. geschrieben: Der Glaube an die Kraft ist der Wegbereiter der Tat. Die Stimme der Taten, die Leistung, kann zwar Macht und Besitz erzeugen, aber nur die auf die Allgemeinheit gerichtete Leitung bringt wahre Befriedigung. Und dazu scheint mir ein Wort aus einer jungeren Rede Adolf Hitlers zu passen: Nur die heroische Natur wird diese Zeit meistern. Mehr denn je erfüllt von der Schönheit dieses Fleckchens Erde scheide ich von dem lieben Zuort mit grosser Dankbarkeit für herrliche, erholende Ferientage. Ich verlasse es mit dem festen Glauben, dass dem Meister dieses Ortes weitere, gute Fortschritte mit baldiger Wiedererlangung seiner vollen Kraft beschieden sein werde.
Zuort, 10.–14. Februar 1934. Onkel Hermann.2518
Es dürfte allerdings deutlich sein, dass 1934 in Zuort der Name von Hitler mit großer Verehrung erwähnt wurde, sei es nur in sehr kleinem Kreise.
Aus all den Anmerkungen, Unterstreichungen, Umrandungen, Ausrufezeichen, Bemerkungen in blau und rot und meist versehen mit seinen Chasa- Initialen O.H., wird deutlich, dass sein Interesse mit Sicherheit auch der Politik galt. Er wollte gerne über die Entwicklungen in Deutschland lesen, in gewissem Maße über die in Italien, über die Beziehungen anderer Länder zu Deutschland, über den Bolschewismus, den Marxismus oder Kommunismus und auch über die Kirche. Er las über den Widerstand der römisch-katholischen Priester und anderer Geistlicher. Über die Interessensgebiete Musik, Kunst, Goldwert, Steuern usw. Er strich alles über Niederländer an, über das Wohlergehen der Schweiz, über Frankfurt am Main. Das Interesse war zeitlich und nicht selten begrenzt auf eine Titelseite und noch eine zweite oder dritte Seite. Oberflächlich und auch begrenzt, wie gesagt auf die Perioden, da er in der Schweiz weilte.
Wenn Mengelberg etwas Wichtiges las, fügte er „lesen“ hinzu oder „alle lesen“, manchmal mit Namen: „Onkel Pa“ oder auch „Opa“ für Oscar Günther, „Tama“ oder „Tante Ma“ für Frau Günther, „Tati“ für Tilly Mengelberg, „Tamara“, „Tamar“ oder „Tante Marianne“ für Marianne Günther und einige Male „Mädchen“ für die Dienstmädchen, die für Mengelberg arbeiteten.
Es wurde schon einmal dargelegt, dass Mengelberg lange nicht in Deutschland auftrat, und erst wieder 1936 in Deutschland dirigierte, als ob sich dahinter eine gezielte, vielleicht sogar grundsätzliche Entscheidung verbarg.2519 Aber Mengelberg war regelmäßig in Deutschland für Konzerte. Mit dem Concertgebouworkest unternahm er noch im Dezember 1931 eine kleine Tournee nach Deutschland, im November 1932 dirigierte er zwei Konzerte bei der Frankfurter Museumsgesellschaft und im Dezember trat er mit dem Concertgebouworkest in Düsseldorf, Köln und Dortmund auf. Sam Bottenheim erzählte später, dass er in seiner Eigenschaft als Sekretär von Mengelberg dafür sorgte, dass Mengelberg von 1933 an keine Konzerte im Hitler-Deutschland annahm.2520 Ferner musste Mengelberg sowohl in den 1920er und 1930er Jahren verschiedene Male Einladungen der Berliner Philharmoniker ausschlagen, weil sein Terminkalender keinen Platz hergab.
Adolf Hitler
Der Dirigent Bruno Walter schreibt in seinen Memoiren über Deutsche, die etwas für die Hitler-Bewegung übrighatten. „Auch gab es breite Kreise im deutschen Volk, die die grausamen Handlungen und frevelhaften Äußerungen der Partei, ja selbst den Antisemitismus, für vorübergehende Kinderkrankheiten einer, im Wesentlichen gesunden Bewegung hielten und glaubten, man werde bald zum Anstand und zur Normalität zurückkehren.“2521 Diese Haltung gleicht der von Mengelberg. Er dürfte sich am meisten mit denjenigen verwandt gefühlt haben, die Hitler bewunderten, weil sie gegen die Weimarer Republik waren, die Unfähigkeit der Demokratie erkannten – Hitler wollte zumindest Abstand von der Parteidemokratie – und die Empörung bezüglich des Friedens von Versailles teilen. Die gewaltige Geldentwertung hatte Mengelberg sein Vermögen gekostet und der Friedensvertrag von 1918 brachte Jahre von Erniedrigung und Schmach mit sich. Deutschland sei nicht mehr die mächtige und starke Nation, die auch militärisches Ansehen habe, aber das müsse sie wieder werden.
Die Bewunderung von Mengelberg wird vor allem durch Verbitterung und Erbostheit über das vermeintliche Unrecht gefüttert worden sein. Das wurde Deutschland angetan durch die Großmächte England und Frankreich. Er muss davon überzeugt gewesen sein, dass Hitler dem deutschen Volk wieder Selbstbewusstsein geben könne nach den Demütigungen von Versailles und dem Chaos der Weimarer Republik. Er glaubte, dass nicht viel Unrecht in Deutschland geschehe oder er schloss bewusst die Augen und leugnete das. Er glaubte an den Aufbau mit Aufschwung und war positiv gestimmt. Der Führer erkannte auch, dass durchaus Sachen schief liefen, aber die wurden dann von der Partei verursacht. Letztendlich ging es um eine große und erhabene Mission. Eigentlich konnte alles, was für Nazi-Ideologie oder Doktrin stand mit Mengelbergs Zustimmung rechnen oder zumindest auf großes Interesse stoßen. Dieses hatte er nicht nur für Hitler oder Anführer wie Goebbels und Rosenberg, sondern auch für verschiedene Standpunkte oder für internationale Ambitionen Deutschlands. Aber außer in dem sehr kleinen Kreis von Gleichgesinnten behelligte er niemanden mit seinen Ansichten. Er entwickelte seine eigenen Überlegungen und teilte die nur mit einigen Mitbewohnern der Chasa. Das waren seine Frau Tilly und Familie Günther.
Die Anmerkungen von Mengelberg zeigen, dass er – in jedem Fall von 1933 an – stark unter dem Eindruck von Adolf Hitler stand. Die Zusammenfassungen von Hitlers Reden, die in der Zeitung standen, wurden manchmal Satz für Satz von ihm unterstrichen. Mit großer Regelmäßigkeit zeigte er 1933 und 1934 seine Bewunderung für Hitler, indem er andere Hausgenossen animierte, zu lesen, was über dessen Reden geschrieben wurde oder über die von anderen Führungspersönlichkeiten der NSDAP. Die Erfolge von Hitler schienen in Mengelbergs Augen evident. Es würde mit Erfolg etwas gegen die Arbeitslosigkeit unternommen. Hitler setzte den Beschränkungen, die der Vertrag von Versailles Deutschland auferlegt hatte, ein Ende. In Mengelbergs Notizen kommt das Thema immer wieder vor: Der Unfrieden über den Vertrag von Versailles, Deutschlands Außenseiterposition. Hitler gab dem erneuerten Nationalismus eine klare Form: gegen die Versklavung, die der Vertrag von Versailles – vom Führer Das Diktat genannt – verursacht und gegen die Demokratie von Weimar, denn die habe das Land noch weiter in den Abgrund gestürzt. Die demokratischen Kräfte stünden der Bildung eines mächtigen deutschen Reiches im Weg. Die Schuldigen, die zum Niedergang der deutschen Nation beigetragen haben, wurden von der NSDAP angeklagt: die Juden, die Bolschewiken, die Marxisten und die Kommunisten.
Im Völkischen Beobachter vom 8. Juli 1933 notierte Mengelberg seine Bewunderung für Hitler: „Ich bitte Opa, Tama u. Tamar diese glänzende u. kluge A. Hitlers ruhig aber genau zu lesen! O.H.“ Die Schlagzeile mit „Ein Führer, ein Volk, ein Staat!“ umkreiste Mengelberg, machte Pfeile und notierte: „sehr gut.“ Fast alles ist unterstrichen und von Zustimmung gekennzeichnet.
Der Artikel des Parteiideologen Alfred Rosenberg Totaler Staat?, in dem es heißt, dass die NSDAP die Partei ist, welche die Weltanschauung des Staates schützt, das Instrument von Seele, Geist und Blut des Nationalsozialismus im zwanzigsten Jahrhundert, erhält ein „Bravo!!!“2522 Vielleicht war Mengelbergs Bewunderung für Rosenberg Anlass für Tilly, ihm Weihnachten 1933 eine der „Bibeln“ des Dritten Reiches zu geben. Versehen mit folgender Aufgabe: „Dem lieben Willem mit besten Wünschen für 1934, Weihnachten 1933, Zuort, von Tilly“, bekam er Rosenbergs Der Mythos des 20. Jahrhunderts (1933).2523 Fühlte sich Tilly selbst von Rosenbergs Ideen berührt und wusste sie, dass Mengelberg an diesem Buch interessiert sein würde? Vielleicht bekam er bei dieser Gelegenheit auch Das Volksbuch vom Hitler von Georg Schott. Ein Beleg, der den Kauf dieser frühen Hitler-Biografie bezeugt, findet sich in den Berichten von Chasa Mengelberg aus dem Jahr 1934.
Die Bedeutung von Mengelbergs Markierungen von Berichten in der Zeitung vom 17. Juli 1933 sind vollkommen klar: „Hitler beglückwünscht Mussolini anlässlich der Unterzeichnung des Viermächtepakts“, „Der Hitler-Gruss in Tirol verboten“, „meine Hitlerjungen“ usw. Alles, was mit dem neuen Deutschen Reich zu tun hatte, fand Mengelberg interessant.
Im Völkischen Beobachter vom 1. und 2. Januar 1934 stand, dass Hitler den Wunsch ausgesprochen habe, dass Gott die deutsche Regierung segnen würde – „bravo!!! O. H.“ stand dabei. „Es lebe unser Führer und es lebe unsere wunderbare Partei“ hieß es irgendwo anders – „Bravo!!!“ schrieb Mengelberg erneut.2524 „Der Führer über die Rettung durch den National Sozialismus“; „Die Rede der Revolution“ (so wurde die Machtübernahme 1933 bezeichnet) vor dem Deutschen Reichstag – „alle Chasa Onkels u. Tanten müssen, sollen diese prachtvoll männliche, unvergleichlich ‚Schöne‘ u. ‚Kluge‘ u. ‚Interessante‘ Rede lesen alle lesen!!! Strenger Befehl O.H.“2525 „Die ganze Welt muss Adolf Hitler dankbar sein“ – „bravo!!! ganz richtig!!“2526 „Alle die grossen Gedanken und Forderungen des National Sozialismus sind verankert in dieser Neuordnung unserer deutschen Arbeit!“ und „in unerschütterlichem Vertrauen und unverbrücherlicher Treue zu unserem Führer“ – alles Sätze, die Mengelberg von ganzem Herzen bejahte.
Mengelbergs Notizen, Vermerke und Unterstreichungen rechnen gnadenlos ab mit der Idee, dass er unpolitisch sei, nicht über die Weltnachrichten informiert sei oder das Gedankengut der Nazis nicht kenne. Ob er immer wirklich begriff, wovon er begeistert war, bleibt die Frage. Die Ehrlichkeit gebietet es auch zu sagen, dass die Tragweite seiner Kritzeleien manchmal albern wirken. Er machte auch kindliche Zeichnungen und Karikaturen oder zeichnete Schnäuzer oder Bärte auf die Portraits. Ebenso wenig las er jede Zeitung mit genauem Interesse und versah nicht jede Zeitung mit Unterstreichungen. Viele der Zeitungspakete, gefunden im Lager des Weinkellers unter der Chasa Mengelberg, haben überhaupt keine Notizen und scheinen sogar ungelesen.2527
Die Frage bleibt, wie reflektiert Mengelbergs Interesse war. Dieses erscheint nämlich ziemlich oberflächlich. Über die Deutschen Bücher, die nationalsozialistischen Schriften aus dem Katalog 1934 des Verlags Franz Eher in München, dem Hausverlag der NSDAP, abgeduckt im Völkischen Beobachter, sind alle Titel angekreuzt. Die Titel von Alfred Rosenberg sind besonders gekennzeichnet. Außerdem hat Mengelberg alle Titel zu „Judentum und Freimaurerei, Marxismus und Bolschewismus“, die Hälfte der Titel zu „Rassenkunde“, fast alle Titel zu „Wirtschaft und Sozialpolitik“ und ein Fünftel Titel zu „Geschichte und Politik“ unterstrichen. Er blätterte nicht einmal um, weshalb er danach nichts mehr rot oder blau anstrich. Für seine Bestellung wollte er nicht mehr als 100 Mark ausgeben. Für den Betrag hätte er weniger als die Hälfte der Titel bekommen können. Vielleicht lässt sich sein Enthusiasmus als ziemlich impulsiv beschreiben.
Benito Mussolini
Auch der italienische Diktator Benito Mussolini konnte auf Mengelbergs Bewunderung zählen. Mengelberg war im März 1933, als er in Rom dirigierte, am Abend im Palazzo Venezia bei Mussolini zur Audienz. Lenie van Santen, Nichte und Patenkind von Mengelberg erzählte einmal, wie sehr er von Italien unter Mussolini beeindruckt war, wo die Züge endlich pünktlich fuhren und kein Gepäck mehr verschwand.2528 Dieser Besuch war keine Anwandlung von Mengelberg, bereits 1930 war er auch bei Mussolini zur Audienz. Dieser hatte einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn gemacht, weil er damals so berührt war von Mussolinis Persönlichkeit.2529 Auch sein guter Freund Charles Boissevain verehrte den italienischen Diktator und wusste, dass Il Duce hoffte, Mengelberg „im Mai […] wieder empfangen zu können.“2530
Wer die Erinnerungen des ungarisch-niederländischen Geza Frid (1904–1989) an Mussolini kennt, begreift vielleicht etwas mehr von der Faszination, die Mengelberg für den italienischen Führer empfand. Frid war mit dem Geiger Zoltán Székely 1929 auf Konzertreise durch Italien. Von der ungarischen Botschaft erfuhren sie, dass Mussolini wolle, dass sie für ihn spielten. Frid und Székely sagten, dass sie eine derartige Bitte nicht eben ausschlagen könnten, und machten Mussolini ihre Aufwartung.
Frid war trotz Widerwillen beeindruckt, denn Mussolini war sprachgewandt und seine Anmerkungen über Musik waren scharf und gut formuliert. Mussolini verfügte über großes Wissen und hatte ein äußerst zuverlässiges Gedächtnis. Frid fand auch, dass er faszinierende Augen habe. In seinem Palazzo zeigte Mussolini ein signiertes Foto von Fritz Kreisler mit der Widmung „A Benito Mussolini, la nouvelle étoile sur le ciel de l’humanité.“ Fritz Kreisler war auch einer von Mengelbergs Freunden. „Viele Politiker und Künstler, darunter auch sein späterer Widersacher Winston Churchill und der Schriftsteller Stefan Zweig suchten und bekamen einfach Kontakt zum Diktator“, schrieb Frid.2531
Als Székely und Frid ihr Recital für Mussolini beendet hatten, sollten sie ihre Namen genau aufschreiben, denn dann würde Il Duce dafür sorgen, dass einen Tag später ihre Namen in allen Zeitungen stünden, mit dem Vermerk, dass sie bei ihm aufgetreten seien. Tatsächlich stand das am nächsten Tag in den Zeitungen, ergänzt mit dem Programm.2532
Beim Lesen der Berichte im Völkischen Beobachter schenkte Mengelberg auch den Beiträgen über Mussolini Aufmerksamkeit. In einem Bericht über den Empfang von Staatsminister Hans Schemm in Rom schrieb Mengelberg: „wo ist Mussolini????.“ Der hätte zumindest nicht zu fehlen?2533
Informiert?
Die Machtübernahme durch die Nazis und die gesellschaftlichen Folgen in Deutschland waren auch zu den Vorstandsmitgliedern des Concertgebouw durchgedrungen. Denn bei der Sitzung vom 1. Juni 1933 wurde angemerkt, dass „infolge der Situation in Deutschland, vortreffliche Kräfte für die Besetzung des zweiten Pults zu gewinnen seien.“ Das war eine zynische Feststellung. Es schien schwierig, für freie Stellen im Orchester niederländische Musiker zu finden, etwas, woran das Ministerium sehr festhielt. Bei einer nächsten Sitzung wurde das Ergebnis einer Anzeige für einen Soloklarinettisten in niederländischen Fachzeitungen besprochen. „Allerdings sei nur eine Bewerbung eingegangen und die von einem Amateur-Klarinettisten aus dem Ort Woudenberg (NL).“2534 Hornist Adriaan van Woudenberg erzählte, dass Mengelberg seine Bläser aus Deutschland holte: Barwahser, Gall und Szell.2535 In den Niederlanden waren sie nicht zu finden. Im Juni 1934 informierte de Marez Oyens Mengelberg darüber, dass das Ministerium fand, dass mehr niederländische Solisten engagiert werden müssten und dass Ilona Durigo dann nicht mehr für die Matthäus-Passion gebraucht würde. Damit durfte man bei Mengelberg nicht argumentieren.2536 Er ließ sich nichts vorschreiben und traf selbst die Auswahl, wen er als Solisten haben wollte. 1935 stand Durigo traditionsgemäß auf der Solistenliste für die Matthäus-Passion.
Als Adolf Hitler im März 1933 in Deutschland an die Macht kam und das Deutsche Reich ausrief, spürte das Mengelberg nach einiger Zeit auch persönlich. Bereits im Juni 1933 erhielt er Briefe von Musikern, die Probleme mit der neuen deutschen Regierung bekommen hatten. Bernhard Sekles (1872–1934) bat ihn um Hilfe, weil er in Frankfurt seinen Job als Direktor des Hochsche Konservatoriums verloren habe und die Leitung der Kompositionsklasse. Mengelberg kannte Sekles aus seiner Zeit bei der Frankfurter Museumsgesellschaft und hatte seinerzeit einige seiner Kompositionen aufgeführt. Wusste er in Holland nicht über irgendeinen Job für ihn?2537
Der Brief von Sekles war die unmittelbare Folge des Judenboykotts, die vom 1. April 1933 an in Deutschland in Kraft trat und von Goebbels über alle Radiosender angekündigt wurde. Ein paar Tage später bekam Mengelberg einen Brief von Carl Flesch, der ihm schrieb, dass er trotz der „Arierverordnungen“ zu hören bekam, dass „der Minister den grössten Wert darauf lege, […] meine Mitarbeit der Hochschule [in Berlin] zu erhalten“, im Gegensatz zu dem, was einen Tag zuvor in den Tageszeitungen geschrieben wurde.2538 Jedoch sollte Flesch’ Anstellung am Konservatorium in Berlin fast ein Jahr später beendet werden. Der Berliner Geiger Alfred Krips hatte ebenfalls seine Stelle wegen der „Arierverordnungen“ verloren und fragte bei Mengelberg an, ob er in Amsterdam vorspielen kommen dürfe.2539 Auch der jüdische Oboist M. Fuhrmann bat Mengelberg um Arbeit.2540
In der Einladung der berühmten Agentin Louise Wolff, die gerne Mengelberg zu den Berliner Philharmonikern holen wollte, stand eine merkwürdige Anspielung: „Ich glaube […] dass keinerlei politische Bedenken speziell gegen Ihr Gastspiel vorliegen, sonst würden wir eine solche Einladung gar nicht wagen.“2541 Man war offensichtlich davon überzeugt, dass Mengelbergs Ruf als Mahler-Dirigent kein Problem bedeutete.
Es kann Mengelberg also nicht entgangen sein, dass mit der neuen Regierung sich einiges veränderte. Auch 1934 bekam Mengelberg einige Briefe, in denen mehr oder weniger auf die Folgen des Regimes in Deutschland angespielt wurde. Der Musiker Leo Fleischer schrieb im Juni 1934, dass er nicht arisch genug sei und deshalb andere Arbeit im Ausland suche.2542 Der Geiger Maurits van den Berg (1898–1971), Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, schrieb Mengelberg im Mai 1935, um ihm zu berichten, dass er eine jüdische Mutter habe und er deshalb keine Arbeit mehr in Deutschland bekommen könne. Er hoffte auf eine freie Stelle beim Concertgebouworkest. Möglicherweise besprach Mengelberg diesen Brief mit Rudi, denn van den Berg wurde zum 1. September 1936 als Geiger beim Concertgebouworkest angestellt, nachdem er erst ein Jahr Konzertmeister bei der Arnhemsche Orkestvereniging war.
Der deutsche „Mahlerfreund“ Klüver schrieb Mengelberg im Mai 1935, um ihn darauf hinzuweisen, dass seit zwei Jahren Mahlers Musik nicht mehr in Deutschland erklungen sei. Habe Mengelberg noch Pläne, in den Niederlanden dem bevorstehenden 75. Geburtstag des Komponisten zu gedenken? In diesem Fall würde er nach Amsterdam kommen.2543 Auf den Umschlag schrieb Mengelberg „besprechen mit Rudi.“ Scheinbar hatte er doch etwas übrig für die Idee eines Gedenkens.
Es ist nicht gut vorstellbar, dass Mengelberg auch nicht von den Vorfällen, die mit Dirigenten-Kollegen stattgefunden haben, gehört hatte. Fritz Busch musste Dresden verlassen wegen seines Widerstandes gegen die Nazis und der jüdische Klemperer zog aus Deutschland weg nach Amerika. Wegen der Entwicklungen in ihrem Vaterland hatten zahlreiche deutsche Musiker ihre Hoffnungen auf das Ausland gesetzt.
Furtwängler hatte 1933 einen offenen Brief an Goebbels geschrieben, in dem er sich für die Juden einsetzte und für die Freiheit der Künste. Bodanzky, Gabrilowitsch, Kreisler und andere hatten Hitler in demselben Jahr ein Telegramm geschickt, in dem sie sich ebenfalls für jüdische Künstler einsetzten. Toscanini hatte seine Mitwirkung in Bayreuth abgesagt.
Mengelberg hatte 1935 Dr. Berta Geissmar (1892–1949), damals mittlerweile die rechte Hand von Thomas Beecham, in Amsterdam empfangen und seine Hilfe und Gastfreundschaft angeboten, weil ihre Anwesenheit in Deutschland wegen ihrer jüdischen Herkunft unmöglich geworden war. Aber Mengelberg bezog keine Stellung und schloss sich nicht dem einen oder anderen Protest an. Nora Mengelberg sagte: „Willem war ein durch und durch Deutscher. Er glaubte zunächst nichts bezüglich Judenverfolgungen. Ferner sagte er: ‚Ich mache schöne Musik und damit mache ich Menschen glücklich. Und die Politik ist mir egal‘.“
Rückschläge in Amsterdam, 1933–1934
Krise beim Concertgebouw
Von Krankheit und finanziellen Problemen wegen Schwierigkeiten mit der Steuer geplagt, verblieb Mengelberg seit 1933, schwer überangestrengt, in seiner Schweizer Residenz in Zuort. In Amsterdam hoffte man immer wieder auf Besserung und Rückkehr von Mengelberg, aber ständig musste man enttäuscht auf seine Präsenz verzichten. Die Nachrichten über Mengelbergs langjährige Abwesenheit hatte sich wie ein Lauffeuer in der internationalen Musikwelt verbreitet. Marguerite Long informierte über sein Wohlbefinden, Josef Hofmann schrieb „tief berührt“ zu sein, ihn nicht in Amsterdam angetroffen zu haben und dass sie nicht zusammen musizieren konnten. Auch Ernest Schelling ließ wissen, dass er sich Sorgen mache. Zeitgleich bekam Mengelberg ein Angebot nach dem anderen: Für Berlin, Wien, für eine Reihe mit zwölf Konzerten in der Philharmonie in St. Petersburg.
Beim Concertgebouw war abgesprochen, Mengelberg, solange er überarbeitet in Zuort sei, nicht mit schlechten Nachrichten zu beunruhigen. Das würde die Situation nur verschlechtern. Die Korrespondenz ging an Tilly. Russel schrieb ihr über die Steuerangelegenheiten und Gerrit de Marez Oyens schrieb über die Krise beim Concertgebouw.
Gerrit bewunderte Tilly’s endlose Geduld, um hoch in Zuort zu verweilen, wo es so schneidend kalt sein konnte und die Dunkelheit lange anhielt. Jetzt, da Willem nicht mehr kam, aber für so viele Konzerte gebucht war, drohte, das Concertgebouw unterzugehen. Die Signale aus Amsterdam waren beunruhigend. Durch seine Abwesenheit entstanden große Defizite. Diese erhöhten sich Ende Oktober 1933 auf 80.000 Gulden (ca. 700.000 Euro) und waren vor allem durch den starken Rückgang an Konzertbesuchern entstanden. Alarmierend war, dass die Stadt Amsterdam nicht helfen wollte. Die Stadtverwaltung sei „jetzt sehr zurückhaltend und billigt den möglichen Betrag von 20.000 (ca. 180.000 Euro), der an Willem gezahlt werden sollte, wenn er in dieser Saison überhaupt nicht kommen würde, auch nicht und will diesen einsparen.“2544 Es handelte sich um das garantierte Einkommen von Mengelberg, das mit ihm 1927 festgelegt wurde. Hinzu kam, dass es viele Absagen von Musikern gab.
Von Ellie Heemskerk, die Dr. Hans Günther gesprochen hatte, begriff Gerrit, dass, wenn sie Willem noch einmal auf dem Podium wiedersehen wollten, sie nicht mehr darauf drängen sollten, ob er in der Spielzeit 1933/1934 noch kommen würde, sondern ihm vollkommene Ruhe lassen müssten. Er fragte Tilly, ob das stimme und ob der Vorstand jetzt Regelungen für Gastdirigenten treffen müsse, denn nur mit van Beinum würde es nicht gehen. „Gestern Abend dirigierte endlich mal wieder jemand, der besser ist als v. Beinum (der übrigens sehr intensiv sein Bestes gibt und eine sehr gute Aufführung von Mahlers 2. gab) nämlich Clemens Krauss aus Wien“, schrieb er.
Mit Rudi lief es auch nicht gut, denn der war seit Oktober 1933 krank. Er hatte schwere Magenblutungen. Im Dezember hat er wieder vorsichtig die Arbeit aufgenommen. Er arbeitete zu Hause und war noch nicht im Concertgebouw gewesen. Am liebsten wäre er nicht mehr hingegangen.2545 Sein Vorhaben, sich nach anderer Arbeit umzusehen, hat er auch umgesetzt. In Den Haag hatte er Gespräche geführt, um Direktor eines Ministeriums zu werden. Während seiner Erkrankung hatte er von seinem Freund Alexander Schmuller, der am 29. März des Jahres verstorben war, in Zusammenarbeit mit dessen Witwe Rosa ein Buch mit Artikeln herausgegeben mit dem Titel „Über Musik und Musiker.“ Er hatte sich vorgenommen, im Januar wieder tageweise ins Concertgebouw zu gehen.2546 Er wusste, dass das dringend notwendig war, denn es sei verhängnisvoll, dass Willems Erkrankung ausgerechnet in dieser Periode „schwerer ökonomischer Krise und mentaler Art“ stattfinde, das genau jetzt die Kontinuität seiner Anwesenheit dringend benötigte. Rudi begriff Willem nicht. Er hatte in Amsterdam eine ganze Reihe Konzerte angenommen und ließ sie danach im Stich. Hätte er bekannt gegeben, ein Jahr nicht zu kommen, wäre das viel besser gewesen. Dann hätten sie zumindest planen können, aber so konnte man nicht arbeiten. Rudi schien, genau wie 1921, einen ziemlich simplen Blick auf Willems Erkrankung zu haben.
Bei seiner Rückkehr ins Concertgebouw, Anfang Januar 1934, wurde Rudi zu seiner Überraschung sehr herzlich begrüßt und er gewann den Eindruck, dass seine Abwesenheit seine Position eher verstärkt habe. Vielleicht kam das deshalb, weil man mit ihm die „Rettung“ des Concertgebouw erwartete. In den Zeitungen waren inzwischen Artikel erschienen, in denen „nach einem starken Mann“ gefragt wurde. Laut Rudi war während seiner Abwesenheit, in der van Beinum die künstlerische Leitung wahrgenommen hatte, viel schiefgelaufen. Darüber hinaus bestanden innerhalb des Vorstands große Meinungsverschiedenheiten, wie das Concertgebouw mit dieser Krise umgehen solle.2547 Von seinen Eltern erfuhr Rudi, dass in den deutschen Zeitungen stand, dass Willem seine Verbindung mit Amsterdam brechen wolle. Aber davon sei nicht die Rede, erwiderte Rudi entschieden.2548 Gegen Jahresende fand Rudi, dass es in Amsterdam immer schwerer würde, da die finanziellen mit den psychologischen Problemen einher gingen.2549 Damit spielte er auf die Situation mit Willem an.
Im Februar 1934 war der Vorstand enttäuscht, dass Mengelberg noch immer krank war.2550 Die Spielzeit 1933/1934 wurde dann eine sehr schwierige. Das kam durch die Abwesenheit von Mengelberg in Zusammenhang mit den beunruhigenden Zahlen des Betriebs, vor allem ausgelöst durch die enttäuschenden Einnahmen. Die finanziellen Probleme des Concertgebouw waren der Grund, dass Minister Marchant 1934 den Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB) bat, dem Concertgebouw finanzielle Unterstützung zu gewähren, da es im Fußball so gut laufe.2551 Im Zuge des Vorschlags entstanden viele Animositäten zwischen dem KNVB und Marchant.2552 Das war jedenfalls ein ziemlich ungewöhnlicher Vorschlag.
Entgegen der Erwartung kehrte Mengelberg auch im März 1934 noch nicht nach Amsterdam zurück und musste von Eduard van Beinum vertreten werden. Sogar bei der jährlichen Aufführung der Matthäus-Passion war Mengelberg nicht dabei. Diese wurde damals von Hermann Abendroth geleitet. Dr. Hermann Günther erklärte nach seinem Besuch bei Mengelberg im Februar in Zuort, dass dieser stark überarbeitet sei und sich nur durch Ruhe erholen konnte.2553
Die Tatsache, dass Mengelberg nun erkranke, war natürlich sehr lästig, aber seine häufige Abwesenheit in den Jahren zuvor hatte bereits für Enttäuschung beim Publikum gesorgt. Laut einiger Tageszeitungen sollten Lösungen in Mengelbergs Rückkehr liegen und in der Neuorganisation des Concertgebouw.
Rückzug von Monteux
Unerwartet gab Pierre Monteux im März 1934 bekannt, dass er seine Verpflichtung gegenüber dem Concertgebouw nach einem Zeitraum von zehn Jahren beenden wolle. Es gab keinen Anlass: Konflikt und Uneinigkeit existierten nicht. Monteux wollte auch kein Abschiedskonzert. „Je m’en irai!“, sagte er und ging.2554 Das war die Version von Bottenheim in seiner Geschichtsschreibung über das Concertgebouw. Diese Version ist sehr kurzgefasst. De Marez Oyens hatte 1933 eine Notiz geschrieben, in der es hieß: „Heutzutage klingt das Orchester manchmal auf schreckliche Weise verstimmt und fragte, ob man wohl auf die Stimmung achte.“ Van Beinum sagte anlässlich dieser Anmerkung, dass der Dirigent die Stimmung immer kontrollieren müsse und dass Konzertmeister Louis Zimmermann die Neigung habe, immer etwas zu hoch zu stimmen. Infolgedessen stimmte auch ein Teil des Orchesters zu hoch. Rudi meinte, dass die Stimmung besser sei als noch zwei Jahre zuvor. Doch man fand, dass die unreine Stimmung größtenteils an Monteux lag. Der Vorstand war auch „über die gegenwärtigen Leistungen des Herrn Monteux nicht uneingeschränkt“ positiv und dachte, dass er während der Proben vielleicht „die Zügel zu locker lasse.“ Die Orchestermitglieder fanden Monteux nicht mehr so stark, vor allem in seinen Proben.

Vorstandsmitglied Baron C. J. Collot d’Escury meinte, dass man Monteux sehr viel zu verdanken habe, aber dass mit Ablauf seines Vertrages, diese Schuld eingelöst sei. De Marez Oyens meinte, dass Monteux viel zu nachgiebig sei und dass gerade der „starke und dezidierte“ Auftritt von Kleiber – im April 1933 – einen starken Eindruck beim Orchester hinterlassen habe. Kleiber habe allerdings über fehlende Disziplin im Orchester geklagt.2555 Da sich herausgestellt hatte, dass van Beinum vom Publikum gut aufgenommen wurde, war man der Meinung, dass Monteux nichts mehr hinzuzufügen hatte. Dr. H. P. Heineken (1886–1971, Direktor der berühmten gleichnamigen Brauerei in Amsterdam), seit 1934 der neue Vorsitzende des Concertgebouw, fasste es mit der Feststellung zusammen, dass Monteux es beim Publikum „verspielt“ habe. Wenn man nur auf Mengelberg zählen könnte!
Rudi und Nora waren gute Freunde von Pierre und Doris Monteux. Spürte Monteux, dass die Orchestermitglieder und der Vorstand nicht mehr zufrieden waren? Vielleicht hatte ihm jemand das vorsichtig mitgeteilt. Dass Rudi es gewagt hätte, eine solch heikle Nachricht zu überbringen, ist schwer vorstellbar. Doris Monteux schrieb in ihren Erinnerungen, dass niemand in den Niederlanden glauben wollte, dass nichts vorgefallen sei, was Monteux zu seinem Weggang veranlasst hätte. Die Tagespresse wollte Rudi trotz der systematischen Verneinung durch Pierre und Doris zum Sündenbock abstempeln.2556
J. Canarina und J. Ph. Mousnier, Biografen von Monteux, spekulieren über die Gründe für seinen Weggang. Mousnier vermutet, dass es Monteux nach zehn Jahren vielleicht satt hatte, das Orchester immer wieder aufbauen zu müssen, gerade wegen fehlender Disziplin unter den Orchestermitgliedern.2557 Canarina berichtet allerdings, dass mit Mengelbergs Rückkehr, nachdem Monteux zuvor das Orchester geleitet hatte, er immer bemerkte, dass das Orchester nicht an Qualität eingebüßt und nicht, so wie üblich kritisiert wurde, sich verschlechtert habe.2558
Eine Tatsache ist allerdings, dass auch bei Monteux selbst Unzufriedenheit entstand. Er fühlte sich nicht mehr der Familie des Concertgebouw zugehörig: In der Spielzeit 1933/1934 habe er nur zehn Konzerte bekommen, weil man eine größere Abwechslung an Dirigenten wollte.2559 Er fand es auch inakzeptabel, dass er die einzige Solistin, die er überhaupt haben wollte, die Pianistin Lili Kraus nicht bekommen habe und dass er in einem anderen Konzert einen Teil seines Programms an den Komponisten und Dirigenten George Enesco abtreten musste.2560 Deshalb schrieb Monteux an Röell am 5. März 1934, dass er dankbar sei für die zehn Jahre, in denen er das Orchester leiten durfte, aber dass alles ein Ende habe und er sein Konzert am 8. März als sein Abschiedskonzert betrachte.
Im Orchester bestand Sorge um die Situation mit Mengelberg. Im Rahmen einer Diskussion zum Probespiel vertrat H. Stips Mengelbergs Interesse. Zusammen mit anderen Vertretern des Orchesters, Tromp und Poppelsdorf, stellte er fest, dass Mengelberg immer noch „ein ganz besonderer Funktionär“ sei. Das Orchester wollte, dass Mengelberg, wie schon zuvor 16 Konzerte dirigieren solle. Wenn diese über kürzere Zeitabschnitte verteilt würden, wäre es einfacher, ihn im Krankheitsfall zu ersetzen. Mit anderen Worten: Mengelberg sorge für ein höheres Niveau im Orchesterspiel und wenn er nur regelmäßig vor dem Orchester stünde, würde das Niveau auch gewährleistet sein. Die Orchestermitglieder hofften, dass der Vorstand Mengelberg dazu bewegen könne, weniger im Ausland zu sein.
De Marez Oyens erzählte seinen Vorstandsmitgliedern, dass eine Bitte für eine Tournee mit dem Orchester durch Italien, Frankreich und die Schweiz käme. Das könne bedeuten, dass dies „für Dr. W. Mengelberg vielleicht eine Aufforderung sein würde, Privat-Konzerte im Ausland – wozu er sich, dass muss bemerkt werden, übrigens nur gelegentlich verpflichtete – nicht mehr anzunehmen.“2561
Die Ankündigung von Monteux’ Weggang kam kurz vor der lang erwarteten Rückkehr Mengelbergs aus der Schweiz. Für den Weggang von Monteux spielte Mengelberg dann auch keine Rolle und ebenso war die Rede von gegenseitigen Animositäten. Das Ehepaar Mengelberg war mit Monteux befreundet. Pierre hatte großen Respekt vor Willem und zeigte das auch. Er schickte ihm nach der Aufführung der Symphonie des Psaumes von Strawinsky 1933 einen Brief, in dem er seine Bewunderung zu erkennen gab. Bei seinem Weggang 1934 schrieb Monteux ihm einen herzlichen Abschiedsbrief. „Ich bin sehr stolz, dass Sie mir über zehn Jahre Ihr Orchester anvertraut haben, Ihr großartiges Werk, um Sie während Ihrer Abwesenheit zu vertreten […] nicht ohne Ihnen zu sagen, dass ich die wertvollste Erinnerung an unsere Zusammenarbeit habe – was unsere Freundschaft betrifft, so ändert das nichts und ich hoffe, dass sie in den kommenden Jahren wachsen wird.“2562 Im August besuchten Pierre und Doris die Mengelbergs in Zuort.
Von Mengelbergs Rückkehr wurde viel erwartet. „Wenn Mengelberg gleich wieder die Leitung habe, bestünde die Apathie des Publikums nicht mehr!“ schrieb De Telegraaf.2563 Aber die Tageszeitungen konstatierten auch, dass der Weggang von Monteux die Situation nicht besser mache.2564 Auch die Ernennung von Bruno Walter als Nachfolger von Monteux veränderte nichts. Die Apathie des Publikums würde vielleicht verschwinden, aber man konnte nicht von Mengelbergs Anwesenheit in Amsterdam ausgehen. Er hatte schon zu oft abgesagt. Es wurde sogar unterstellt, dass Mengelberg entlassen würde, sodass sein Dirigat den Charakter eines Gastdirigats bekommen würde. Das war auch bereits 1924 der Vorschlag von Charles Boissevain.
Der Ruf von Mengelberg schien in den Jahren wegen seiner langen Abwesenheit durchaus getrübt zu sein, aber dennoch war die Bedeutung Mengelbergs für das Concertgebouw noch immer sehr groß. Andere Dirigenten konnten die Lücke nicht ausfüllen.
Zurück in Amsterdam, 1934–1935
Eine große Ehrung, April 1934
In der Schweiz erhielt Mengelberg drängende Briefe, in denen um seine Rückkehr gefleht und ein Appell an ihn gerichtet wurde, seiner „Berufung“ zu folgen. Die Komponistin Emmy Frensel Wegener schrieb beispielsweise im Januar 1934: „Wenn Sie Sie Ihre Berufung bis zum Ende erfüllen wollen, dann bedeutet das: Zurück kommen nach Amsterdam und das Orchester leiten, das Sie braucht?“ Minister Marchant hatte im März erklärt: „Wir können ohne Sie nicht leben.“2565 Noch deutlicher wurde Jo Vincent: „Aber für Sie selbst ist es soviel besser, wenn Sie endlich den großen Schritt machen und aus ‚Zuort‘ weggehen. Sie haben dann viel weniger Zeit, um an sich selbst und die Schwierigkeiten mit der Steuer zu denken – denn das letzte Mal, als ich bei Ihnen war, habe ich gemerkt, dass das nach Ihrem Unwohlsein eine oder eigentlich die Hauptursache war, dass Sie nicht zurückkommen. Könnten Sie nicht Ihr Bestes geben, über Ihren Schatten zu springen!“ Das war eine klare Aussage. Sie schrieb auch: „Ich finde, dass Sie das ungeheure Talent, das Sie vom Herrn bekommen haben, weiter nicht so ungenutzt liegen lassen dürfen.“2566 Es gab mehr Menschen, die Mengelbergs Wegbleiben auch psychologisch interpretierten.
Wer wird sagen, ob diese Art Briefe Einfluss genommen haben? In jedem Fall wird auf seine Unverzichtbarkeit angespielt, und das dürfte seiner Eitelkeit gutgetan haben. Mit der Klärung des Streits mit dem Fiskus wurde auch ein wichtiges Hindernis aufgehoben. Eine bittere Seite war, dass die Mengelbergs nicht mehr in ihr Haus zurückkehren konnten.
Am 12. April verließ Mengelberg Zuort und kam am 21. April in Amsterdam an. Es war das erste Mal, dass er nicht mehr in sein Haus in die Van Eeghenstraat konnte, sondern das Amstel Hotel beziehen musste. Dort fand er einen netten Willkommensbrief von Wibaut vor, der damals Mitglied des Senats war: „Minister Marchant teilte mir das letzte Jahr sein Vorhaben mit, in die ‚Angelegenheit‘ einzugreifen. Aber ich habe seitdem nichts davon gehört. Allerdings kann man es Ihnen auch im Amstel Hotel angenehm gestalten.“2567 Auch Wibaut war über Mengelbergs Ärger mit der Steuerangelegenheit informiert.
Bezeichnend ist, dass Mengelberg selbst nicht glaubte, völlig geheilt zu sein. Er hoffte, dass er im Juni „mit Freudigen Gefühlen zurückkehren“ würde nach Zuort.2568 Hoffentlich würde er sich dann in jedem Fall zufrieden und geschätzt fühlen. Das war wichtig für ihn.
Mengelbergs Rückkehr war der Anfang einer Reihe von Ehrungen. Das Ausmaß hatte hysterische Züge. Überall wurde Mengelberg von neugierigen Menschentrauben zugejubelt und eine Ehrung nach der anderen wurde ihm zuteil. Bei manchen Ehrungen hatte Marchant seine Hände im Spiel. Er und viele mit ihm meinten, dass sie die unangenehmen Situationen, in die Mengelberg verstrickt war, wieder gutmachen könnten, indem sie Mengelberg mit allerlei Ehrungen überraschten, um damit seine Bedeutung für das Musikleben zu unterstreichen. Seine Rückkehr wurde überall publik gemacht, sodass der Zug, mit dem er an der Amsterdamer Bahnhof Station Weesperpoort ankam, von einer Menschenmenge empfangen wurde.
Der Amsterdam’sche Fanfare-Corps stand am Bahnsteig, um einen festlichen Marsch zu spielen, sowie das Lang soll er leben. Mitglieder des Concertgebouworkest, Vorstandsmitglieder, aber auch Vertreter der Konzertvorstände in Rotterdam, der Toonkunst und einzelne Mitglieder, van Beinum und Rudi Mengelberg und natürlich Musikliebhaber sowie Konzertgänger waren gekommen, um die lang ersehnte Rückkehr Mengelbergs mitzuerleben. „Am ersten Bahnsteig und vor dem Bahnhof standen Tausende Amsterdamer hinter einer starken Polizeiabsperrung.“2569 Kränze und Blumen wurden ihm überreicht und unter Begleitung des Musikcorps zog Mengelberg Richtung Amstel Hotel. Dort wurde er erneut von einer großen Gruppe Neugieriger erwartet. Für den Rundfunk sprach er einige Worte über seine glückliche Rückkehr. Die Illustrierte Het Leven zeigte einige Fotos, die während der ersten Probe nach seiner Rückkehr gemacht wurden. „Mit seiner Rückkehr mögen alle Schwierigkeiten mit ‚unserem Orchester‘ mit einem Schlag gelöst sein und eine neue Blütezeit unseres geschwächten Musiklebens schnell eingeläutet werden!“2570 Die Erwartungen waren hoch.
Beim ersten Konzert, das Mengelberg am 26. April wieder dirigierte, muss das Publikum außer sich gewesen sein. „Das Besuchen dieses Konzertes übertraf alles, was bis dahin in diesem Saal möglich schien. […] Der Saal war in seiner Kapazität gänzlich ausgelastet. In zwei Gängen und auf den Treppen neben der Orgel waren zusätzlich Stühle aufgestellt, wodurch 50 Sitzplätze gewonnen werden konnten, in allen Ecken und Lücken des Saals, Podiums, Balkons und Blauwe Zaal gab es Extra-Bestuhlung.“2571 Auf dem Programm stand außer er 39. Symphonie KV 543 von Mozart auch Das Lied von der Erde von Gustav Mahler mit der Altistin Rosette Anday und dem Tenor Martin Oehman als Solisten. Das Orchester spielte auf höchstem Niveau und Mengelberg hatte sich selbst mit dem Konzert übertroffen.
Am 30. April 1934 gab es am Mittag einen wahren Volksauflauf in Den Haag, um Mengelberg zu begrüßen. Am Viaduct von Wassenaar, am Leidschestraatweg, der Gemeindegrenze zu Den Haag, wurde er mittags von ein paar Hundert Menschen empfangen. Die Polizei war hoch zu Ross, mit Motorrädern und zu Fuß ausgerückt, um für Ordnung zu sorgen und die Cafés in der Umgebung machten gute Geschäfte. Das Ehepaar Mengelberg wurde von einem Komitée unter dem Vorsitz von Minister Marchant willkommen geheißen. Marchant selbst war verhindert, aber seine Frau war anwesend, ebenso Frau de Jong–Mengelberg, Mengelbergs Schwester, die in Scheveningen wohnte. Nach dem festlichen Empfang „unter Ohren betäubenden Hurra-Geschrei“, stieg Mengelberg um 16.30 Uhr mit seiner Frau wieder in sein Auto und begleitet von einer Kutsche mit vier Schimmeln, geschmückt mit rot-weiß-blauen Federn, fuhren sie zum Hotel De Oude Doelen in Den Haag, wo Mengelberg ein „Tee“ angeboten wurde. Dort wurden sie von Vertretern des Musiklebens erwartet.
Am Abend gab es ein Konzert im Gebouw voor K&W, bei dem Mengelberg das Concertgebouworkest mit dem gleichen Programm wie einige Tage zuvor in Amsterdam dirigierte. Über das Konzert schrieb die Wochenzeitung Haagsche Post: „Von dem Augenblick an, dass Mengelberg vor seinem Orchester stand, wurde es ein anderes Ensemble. Wieder wurde mit der messerscharfen Genauigkeit musiziert, wodurch seine Leistungen von so anderer Art, als die vieler sonstiger Dirigenten sind.“2572 In der Konzertpause wurde auf Mengelberg vom Vorsitzenden des Ehrenkomitées, das den Empfang organisiert hatte, eine Rede gehalten – „auf einen genialen Künstler wie Willem Mengelberg kann unser Land nicht verzichten und die Freude über seine Genesung wird dann auch vom gesamten Holland geteilt werden“ – und er bekam Blumen und einen Lorbeerkranz.2573 Bei seinem Eintreffen zu Beginn des Konzerts, hatte Organist H. A. Wegerif auf der Orgel ein Lied gespielt, das Mengelberg als 13-jähriger Junge komponiert hat. An dem Abend waren die Minister Marchant, de Graeff (Außenminister) und Deckers (Verteidigungsminister) anwesend.
Während des Konzerts vom 13. Mai steckte Minister Marchant Mengelberg die Dekorationen eines neuen königlichen Ordens an. Er wurde zum Großoffizier in der Orde van Oranje-Nassau ernannt.2574 Es war klar, dass die Auszeichnung die niederländische Treue gegenüber dem geplagten Maestro unterstreichen sollte.
Anlässlich Mengelbergs Ernennung zum Professor in Utrecht – dazu später mehr – schrieb Tilly an Marie Heller in Luzern: „Er ist ausgiebig geehrt und gefeiert worden und all das war schrecklich ermüdend.“2575
Tilly spielte auf die festlichen Empfänge und Ehrungen an, die es gab. Was für Mengelberg ein Lebenselixier bedeutete, musste nicht für sie gelten.
Das Stadionkonzert, Mai 1934
Eines der aufsehenerregendsten Konzerte, das Mengelberg nach seiner Rückkehr leitete, war das Konzert im Olympia-Stadion in Amsterdam. Die Initiative für dieses Konzert kam von Diplomingenieur J. A. Josephus Jitta, Vorstandsmitglied der Initiatief Comité Amsterdam, deren Ziel es war, „mehr Leben in die Bude zu bringen“ und in der Folge die Pensionskassen des Concertgebouworkest und des Residentie Orkest zu unterstützen. Die zurückgehenden Einkünfte des Concertgebouw hatten auch bei den Pensionskassen für die Orchestermitglieder für ein Problem gesorgt. Zur selben Zeit hatte Marchant seinen Vorschlag dem KNVB gemacht, das Concertgebouw finanziell zu unterstützen.
Das Concertgebouworkest und das Residentie Orkest sollten gemeinsam als ein großes Orchester auftreten. Josephus Jitta wollte verständlicherweise, dass Mengelberg das Konzert dirigiere und nur unter dieser Bedingung wollte der Vorstand des Concertgebouw mitwirken. Rudi war gegen die Veranstaltung, aber Mengelberg erkannte den Werbewert und machte mit. Natürlich half es, dass er die Freiluftkonzerte in Amerika kannte, so wie in Los Angeles in der Hollywood Bowl und in New York im Lewisohn Stadium, die dort erfolgreich verliefen und für das Ereignis in Amsterdam modellhaft sein konnten. Auch in New York hatte er einmal ein „Monsterorchester“ dirigiert, das aus verschiedenen Orchestern zusammengestellt war. Ein paar Jahre zuvor, am 28. Juni 1930, gab es im Olympia-Stadion ein Konzert unter der Leitung von Nico van der Linden, aber mit nur etwa 2.000 Zuhörern war das bestimmt kein Erfolg. 1931 hatte Mengelberg mit einer ähnlichen Veranstaltung in der Nenijto-Hal in Rotterdam zu tun. Damals war er dort mit dem Bürgermeister von Rotterdam, P. Doogleever Fortuyn und hatte die Halle als „vollkommen geeignet“ befunden. Die Bedingungen waren allerdings noch eingeschränkt; es passten dort etwa 3.000 Zuhörer hinein. Eigentlich ging es um ein für jedermann zugängliches Konzert, ein Volkskonzert, eines der Ideale, die Mengelberg pflegte. Für das Programm war damals die Rede von Beethovens 9. Symphonie.2576
Bei einer der gemeinsamen Proben im Concertgebouw für das Stadion- Konzert, hielt Mengelberg eine Rede, in der er auf die „pompöse Organisation der großen Fußballspiele verwies. Auch wir mussten diese Methoden anwenden und alle modernen Werbemittel nutzen, weshalb er vorgeschlagen hat, aus unseren beiden Orchestern ein Monster-Ensemble zu bilden, um auch über das Radio einen Friedensschrei [mit der Symphonie von Beethoven] erklingen zu lassen.“2577 In der Presse rundherum wurde von dieser Thematik nichts mehr vernommen.
Außer den beiden Orchestern arbeiteten bei dem Stadionkonzert auch vier Chöre mit: Der Toonkunstkoor, die Koninklijke Oratorium Vereeniging, die Koninklijke Christelijke Oratorium Vereeniging und die R. K. Oratorium Vereeniging. Die Chöre wirkten unentgeltlich mit, genauso die Solisten. Es gab eine ganze Reihe von ihnen, denn die Solostimmen waren dreifach besetzt.2578
Die Werbung lief vorbildlich. Über das Land verteilt gab es 23 lokale Komitees, der bekannte Illustrator und Grafikdesigner Bernhard van Vlijmen hatte ein Werbeplakat entworfen, es gab Radio-und Filmwerbung. In den Kinos wurde ein Film mit Josephus Jitta und Mengelberg gezeigt, die quasi in ein spontanes Gespräch über das Konzert verwickelt waren.2579 Es war gründlich vorbereitet und basierte auf einem detailliert ausgearbeiteten Manuskript. Auch der gesprochene Text war gänzlich auf Papier festgehalten. Es wurden sogar Busreisen zu dem Konzert veranstaltet und die Organisation bekam Vergünstigungen und Prozente, beispielsweise bei der Nederlandsche Spoorwegen. In der Gooi-Region [Hilversum und Umgebung] wurde „Lautsprecherwerbung“ von Jan Rahusen gemacht. Laut Joop Weyand, einem der Flötisten und Chronisten des Residentie Orkest ergab sich aus der Idee des Konzertes „eine groß angelegte Werbeveranstaltung.“2580
Auf dem Programm stand Mengelbergs Präludium über das Oude Wilhelmus, Peter van Anrooy, Dirigent des Residentie Orkest, führte seine Piet Hein Rhapsody auf. Danach dirigierte Mengelberg Wagners Meistersinger- Ouvertüre und wie gesagt Beethovens 9. Symphonie. Außer für das niederländische Radio wurde das Konzert in Amerika ausgestrahlt und für Philips Omroep Hollands-Indië (POHI). Prof. Dr. A. D. Fokker hat akustische Ratschläge erteilt. Laut Weynand missglückte das Konzert wegen eines „bösen Nord- Westwindes.“ Das zahlreiche Publikum muss wegen des Windes durchgefroren gewesen sein, jenen Wind, der auch den Klang verwehte. Das Konzert war allerdings ein finanzieller Erfolg. Der Gewinn betrug 19.000 Gulden (ca. 175.000 Euro) und die Orchester teilten diesen Betrag.2581
Den Berichten des Concertgebouw NV zufolge gab es ungefähr 30.000 Besucher. De Telegraaf schätzte auf ca. 24.000. In dem Programmheft schrieb Mengelberg: „Die harmonische Entwicklung von Körper und Geist ist die vornehmste jeder Erziehung. Eine junge Generation, die nur einseitig in physischer Hinsicht entwickelt ist, wird ihren Pflichten nicht nachkommen können. Deshalb müssen Sport und geistige Bildung Hand in Hand gehen. Die kulturellen Werte einer Nation dürfen nicht im Besitz einiger bleiben, sondern gehören dem ganzen Volk. Davon zeugt gerade die Musik. Sie ist vor allem die Kunst der Gemeinschaft.“ Auffallend ist die Übereinstimmung mit einem Artikel aus dem Völkischen Beobachter vom Januar 1934, den Mengelberg mit Zustimmung las und in dem nachdrücklich auf das Zusammenspiel von gesundem Geist und einem gesunden, beispielsweise durch Sport trainierten Körper verwiesen wurde.2582
Nach dem Konzert gab es ein Souper, bei dem u. a. Minister Marchant am Tisch saß. Mengelberg bekam einen Gipsabguss einer Büste überreicht, angefertigt von Gerrit van der Veen. Die Initiative hierzu kam von der Redaktion der Zeitung De Kunst. Wahrscheinlich von Chefredakteur N. H. Wolf, einem großen Bewunderer von Mengelberg.2583 Das Amsterdamsch Studenten Corps brachte nach dem Souper eine „Fackelehrung“ und Mengelberg und Marchant gingen nach Mitternacht noch ins Vereinsgebäude der Corps-Societät und blieben dort bis in den frühen Morgen.
Zur Erinnerung an den Beethoven-Zyklus erhielt Mengelberg später von den „Stammgästen“ einen schönen Füllfederhalter mit Intarsienmalerei und dem stilisierten Kopf von Beethoven, mit dem von Mengelberg auf der Rückseite. Auf dem Füllfederhalter stand eingraviert: „Alle Menschen werden Brüder.“2584 Die Übergabe fand allerdings erst am 17. März 1934, nach der Aufführung der Missa Solemnis statt.2585 Vielleicht waren es die Proben für diese Aufführung der Missa Solemnis, wozu dem Musikwissenschaftler Prof. Dr. Jos Smits van Waesberghe ein außermusikalisches Detail in Erinnerung blieb: Die große Bedeutung der kommenden Aufführung, wovon Mengelberg die Mitglieder der Toonkunst überzeugen wollte. Bei der letzten Probe hatte er gesagt: „meine Damen und Herren, wenn Sie morgen aufstehen, wenn Sie morgen zur Arbeit gehen, denken Sie dann an eine Sache, an das wichtigste Ereignis des Tages: Heute Abend wird im Amsterdamer Concertgebouw die Missa Solemnis von Beethoven aufgeführt!“ Er vermittelte damit laut Smits eine psychische Spannung, welche die Chormitglieder tagsüber gefühlt haben müssen: Dass ihnen am Abend ein großes Ereignis bevorstand.2586
Die Organisation des Stadion-Konzerts lieferte einen wichtigen Impuls für die Einrichtung der Concertgebouwvrienden, deren erster Vorsitzender Diplomingenieur Dr. Josephus Jitta wurde. Dieser wollte Wiederholungen des Stadionkonzerts und auch andere Freiluftveranstaltungen organisieren. Mengelberg stimmte zu, aber das Concertgebouw hatte wegen des dürftigen künstlerischen Ergebnisses nichts dafür übrig.2587
Stadionkonzerte so wie das von 1934 wurden nicht mehr organisiert. Im Dezember 1935 wurde der Vorstand von Mengelberg über Pläne zu einem „Monsterkonzert“ in den Nieuwe Markthallen in Amsterdam informiert, einem Ort, von dem er glaubte, mit ein paar Veränderungen ein Konzert geben zu können. Die Markthallen an der Jan van Galenstraat wurden 1934 für den Lebensmittelgroßhandel gebaut.2588 Dort gäbe es Platz für 10.000 bis 12.000 Zuhörer. Für diese Gelegenheit beabsichtigte man, dass zudem fünf Chöre und zwei Orchester mitwirken würden. Das Programm stand schon fest: 9. Symphonie von Beethoven und die Hymne op Amsterdam von Rudi Mengelberg.2589 Darüber erschien noch ein Artikel in Het Volk, aber die Pläne wurden nicht realisiert.
Professor in Utrecht, 1934
Im Juni 1934 wurde bekannt, dass Mengelberg zum außerordentlichen Professor an die Universität Utrecht von der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst für „allgemeine Musikwissenschaften berufen werden sollte, soweit diese die Grundlage der reproduktiven Tonkunst ist.“2590 Dazu erklärte Marchant später, dass er wegen der Professur „vermittelt“ habe und auch für die Zuweisung des großen Offizierkreuzes in dem Orde van Oranje-Nassau, um damit zu erreichen, dass Mengelberg wieder in den Niederlanden dirigieren würde.2591
Die 1947 abgegebene Erklärung von Marchant dazu wirkte ziemlich befremdlich. Von der Professur und mit Sicherheit von der Auszeichnung wusste Mengelberg, als er in der Schweiz weilte, nichts. Vielleicht beabsichtigte Marchant zu demonstrieren, dass er Mengelberg nach seiner Rückkehr mit der Professur und hohen Auszeichnung an die Niederlande binden wollte.
Marchant kannte Mengelberg seit schon langer Zeit. Er war ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und großer Bewunderer von Mengelberg und dem Concertgebouworkest. Laut Marchant fühlte sich Mengelberg gegenüber ausländischen Kollegen zurückgesetzt.2592 Möglicherweise wusste er das, da er mit Mengelberg gelegentlich sprach, aber vielleicht auch über Mengelbergs Schwester Mootje, die mit dem Juristen H. W. J. M. de Jong verheiratet war und neben ihm in der Cornelis Jolstraat in Scheveningen wohnte. Marchant wusste allerdings auch gut Bescheid über Mengelbergs Frustration über die inzwischen beendete Steuerangelegenheit. Bei der damit verbundenen Lösung hatte er schließlich auch eine Rolle gespielt.
Marchant wollte Mengelberg mit dem Titel „Professor“ ehren. In den Niederlanden war dieser im Gegensatz zu anderen Ländern an die Professur gebunden und war nur über einen universitären Lehrauftrag möglich. Marchant berief deshalb den allgemeinen Sekretär der Toonkunst, Paul Cronheim ein und teilte ihm mit, dass er mithilfe Toonkunst eine „Rijks-Hoogleraarschap in de musicologie“ einrichten wolle, für die Mengelberg im Gegenzug zum außerordentlichen Professor ernannt würde. Jeder begriff, dass es dabei nicht primär um die Musikwissenschaft ging. Laut Cronheim wurde der Vorschlag ausführlich und offen besprochen, von der Maatschappij, aber auch an der Universität in Utrecht. Es wurde einstimmig beschlossen, dem Wunsch des Ministers gerecht zu werden. Man glaubte, dass der Musikkultur und langfristig der Hochschulausbildung damit gedient sei. Der Einsatz schien sich zu lohnen. Die Professur von Dr. Albert Smijers, der schon bereits 1930 außerordentlicher Professor war, wurde gemäß dem Wunsch von Marchant zum 4. Mai in eine normale Professur umgewandelt. Mengelberg wurde zum außerordentlichen Professor ernannt.
Laut Eduard Reeser (1908–2002), Emeritus in Utrecht, war die Berufung von Mengelberg ein „Kuhhandel“ und eine sehr „ärgerliche Affäre“, um Mengelberg zu ehren und der Senat der Universität wollte nichts von der Berufung wissen.2593 Cronheim hielt die geringschätzende Haltung der akademischen Kreise gegenüber dieser Ernennung für ungerechtfertigt. „Sicherlich wäre es unter den gegebenen Umständen gegenüber Mengelberg, um den es hier ausschließlich ging, unangebracht, eine Haltung einzunehmen, die wenig übereinstimmte mit dem Respekt, auf den ein Künstler ebenso Anspruch hat wie ein Vertreter der Wissenschaft.“2594
Für die Antrittsrede, die Mengelberg halten musste, wurde Rudi eingeschaltet. Via Tilly bat Willem ihn, zu schreiben, „dass ich fest davon ausgehe, dass er meine große Prof.-Rede für mich aufsetzt und am besten – rechtzeitig – natürlich gegen ein gutes Honorar. Ich werde natürlich die endgültige Form noch gemeinsam mit ihm festlegen.“2595 Willem gab die Richtung vor und Rudi musste die endgültige Form in seinem Sinne ausarbeiten, genau wie bei der Rede für die Columbia University 1928. Die Antrittsrede unter dem Titel De taak en de studie der reproductieve Toonkunst (Aufgabe und Studium der reproduktiven Tonkunst) hielt Mengelberg am 3. Dezember 1934 und einen Tag später wurden die gedruckten Exemplare verschickt. Die Darlegung von Mengelberg lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Der Unterschied zwischen schaffender und reproduzierender Tonkunst ist im Laufe des 20. Jahrhunderts immer größer geworden. Das kommt durch ein neues gesellschaftliches Phänomen, das Musikleben. Das besteht aus einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die sich der Musik verbunden fühlt: Musiker, Dilettanten und Interessierte. In diesem Kontext spielt der reproduzierende Künstler eine entscheidende Rolle. Tatsächlich bildet er die Gemeinschaft und hält sie aufrecht. Er ist Vermittler zwischen Kunstwerk und Publikum, leistet in diesem Sinne eine pädagogische und soziale Arbeit.
Nach 1800 befreit sich die Musik von einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Dabei spielt Beethoven eine zentrale Rolle, die nicht mehr im Auftrag arbeitet, sondern sich direkt an den Menschen wendet. Der Komponist schreibt für eine imaginäre Gesellschaft, die im Konzertsaal Gestalt annimmt. Das ist die eigentliche Frucht der Französischen Revolution und beherrscht das Musikleben bis heute. Die Individualität des Künstlers wird zum höchsten Gesetz.
Der neue Geist in der Tonkunst richtet sich auch direkt an die Vergangenheit und Wiederbelebung von Bachs Schaffen, wovon vor allem die Aufführung der Matthäus-Passion zeugt. Genau wie unsere Augen und Ohren entwickeln sich auch Instrumente und wir hören anders als im 18. oder 19. Jahrhundert. Eine Rekonstruktion der historischen Aufführungspraxis hat geschichtlichen Wert, aber es fehlt die ästhetische Wirkung und das Moment der Ergriffenheit. Die Kenntnis über historische Aufführungspraxis ist nur nötig, um ein Werk besser verstehen zu können.
Die Vergangenheit lehrt uns, dass sich eine Aufführungspraxis aus dem Studium der Musikwerke entwickelt und nicht umgekehrt. Der Dirigent Hans von Bülow war der Erste, der eine Aufführungspraxis für die Musik von Beethoven entwickelte, die der Musik gerecht wurde. Wie lange hat es gedauert, bis für die Werke von Berlioz und Wagner eine Aufführungspraxis entstand, die der Musik gerecht wurde? Ich selbst habe das mit der Musik von Mahler und Debussy erfahren. Die Komponisten stellten uns vor technische Probleme, deren Lösung sie selbst nicht kannten und die nach jahrelangen Studien gefunden wurde. Wer also die Wiederbelebung der alten Aufführungspraxis fordert, begreift das Wesen musikalischer Darbietung nicht.
Mendelssohn hat die Kraft von Bachs Kunst abseits der Liturgie dargestellt, und die Erkenntnisse seiner Zeit entsprechend umgesetzt. Damals war diese Praxis gut, weil sie die Augen für Bachs Kunst öffnete.
Geist und Form einer Komposition sind bestimmend für die Wiedergabe der Musik. Die Darbietungen sollen sich allerdings immer voneinander unterscheiden, weil die Interpretation immer wieder von anderen geleistet wird, für ein anderes Publikum, in unterschiedlichen Räumlichkeiten und zu unterschiedlichen Anlässen und in gänzlich anderen Zeiten.
Die musikalische Reproduktion stützt sich auf zwei Pfeiler:
- 1. das absolute Gesetz des Kunstwerks und
- 2. das relative Verhältnis von Ort, Zeit, Aufführenden und Publikum.
Für die Aufführung einer Komposition gelten vier Vorschriften:
- 1. jeden Ton und jede Angabe in der Partitur so genau wie möglich zu spielen,
- 2. jede Note und jede Angabe so schön wie möglich zu spielen,
- 3. vertiefen und sich bewusst machen, was zwischen den Noten steht und
- 4. Freiheit des Vortrags, genannt improvisando, basierend auf der Eingebung des Moments.
Die ersten zwei Vorschriften verlangen technische Meisterschaft. Die dritte fordert Entwicklung und Aktivität von Geist und Gefühl. Das vierte Gebot, das Moment des improvisando, ist eigentlich das kreative Element. Das schlägt eine unsichtbare Brücke zum Publikum.
Details
- Seiten
- XVI, 696
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631929698
- ISBN (ePUB)
- 9783631929704
- ISBN (Hardcover)
- 9783631929711
- DOI
- 10.3726/b22531
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (April)
- Schlagworte
- Geschichte Konzertgebouworchester Amsterdam Gustav Mahler Musikgeschichte der Niederlande Musikleben 1. Weltkrieg Musikleben 2. Weltkrieg Musikleben New York Richard Strauss Biografie
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 712 S., 11 farb. Abb., 33 s/w Abb., 6 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG