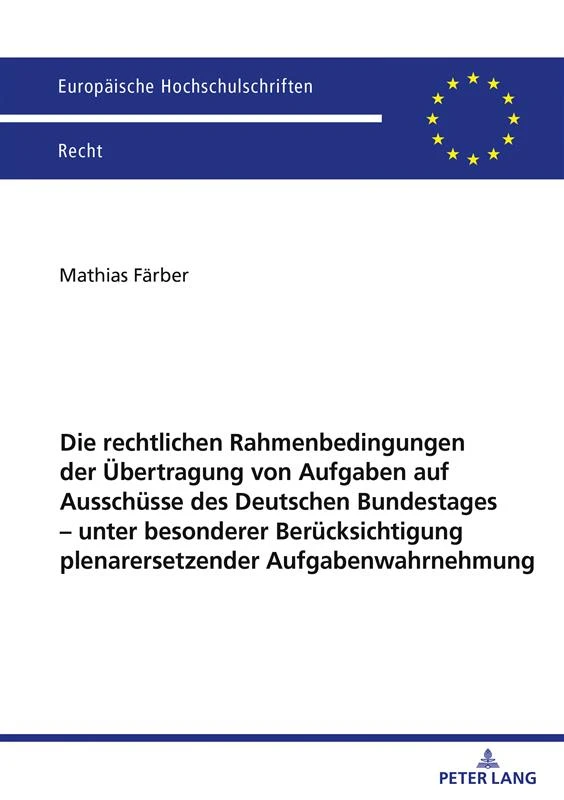Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse des Deutschen Bundestages – unter besonderer Berücksichtigung plenarersetzender Aufgabenwahrnehmung
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Abdeckung
- Titelseite
- Copyright-Seite
- Hingabe
- Vorwort
- Inhalt
- Kapitel 1: Einleitung und Problemaufriss
- A. Einleitung
- B. Historische Entwicklung des Ausschusswesens in Deutschland
- I. Ressortorientierung der Bundestagsausschüsse
- II. Tendenz der Verlagerung parlamentarischer Aufgaben in die Ausschüsse – von der Vorbereitung der Beschlüsse des Plenums zur plenarersetzenden Tätigkeit?
- C. Verfassungsrechtliche Problematik der (plenarersetzenden) Aufgabenwahrnehmung durch Ausschüsse – Gang der Untersuchung
- D. Ausschüsse des Deutschen Bundestages – Rechtsgrundlagen, Rechtsnatur und Grundsatz der Diskontinuität
- I. Begriff des „Ausschusses“ – Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes und der Begrifflichkeiten
- II. Rechtsgrundlagen fakultativer Ausschüsse
- III. Obligatorische Ausschüsse
- 1. Rechtliche Grundlage der Einsetzung obligatorischer Ausschüsse
- 2. Einsetzung obligatorischer Ausschüsse durch den Bundestag oder lediglich Neubestimmung der personellen Besetzung?
- a) Zum verfassungsrechtlichen Grundsatz der Diskontinuität
- b) Institutionelle oder nur personelle Diskontinuität bei obligatorischen Ausschüssen?
- IV. Zwischenergebnis und weiteres Vorgehen
- Kapitel 2: Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen auf Ausschüsse
- A. Begriff der Delegation und Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen auf Ausschüsse des Bundestages
- I. Begriff der Delegation
- II. Abgrenzung zwischen Delegationen durch den Bundestag und Begründung von Ausschusskompetenzen durch den Verfassungsgeber
- 1. Illustration am Beispiel der Untersuchungsausschüsse nach Art. 44 GG
- 2. Zwischenergebnis
- III. Arten der Delegation
- 1. Differenzierung anhand der Konsequenzen – ausschließliche und konservierende Delegation
- 2. Horizontale versus vertikale Delegation
- a) Horizontale Delegation
- b) Vertikale Delegation
- B. Erscheinungsformen der vertikalen Delegation bei Ausschüssen des Deutschen Bundestages
- I. Inhaltliche Differenzierungskriterien für die vertikale Delegation auf Ausschüsse
- 1. Delegation vorbereitender Aufgaben und Tätigkeiten
- 2. Delegation plenarersetzender Aufgaben auf Ausschüsse des Bundestages
- II. Differenzierungen anhand der rechtlichen Grundlage einer Delegation
- 1. Zuweisung von Kompetenzen an Ausschüsse unmittelbar durch das Grundgesetz – das Beispiel des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union nach Art. 45 GG
- 2. Delegation durch Geschäftsordnung, Gesetz oder Beschluss
- C. Zwischenergebnis
- Kapitel 3: Grenzen der Delegation von Kompetenzen auf Ausschüsse durch den Bundestag aus der grundgesetzlichen Kompetenzordnung?
- A. Verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Befugnisse des Deutschen Bundestages, Delegationsmöglichkeiten und Mehrheitsprinzip
- I. Der Beschluss als primäre Handlungsform des Deutschen Bundestages
- II. Das Mehrheitsprinzip unter dem Grundgesetz und seine unterschiedlichen Ausformungen bei der Beschlussfassung des Deutschen Bundestages
- III. Delegationsmöglichkeiten unter dem Grundgesetz
- 1. Explizite Regelung des Art. 45 GG
- a) Inhalt der nach Art. 45 S. 2 GG delegierbaren Kompetenzen
- b) Zulässigkeit der damaligen Verfassungsänderung
- 2. Rechtslage in ungeregelten Fällen
- a) Delegation von Kompetenzen und das Mehrheitsprinzip des Art. 42 Abs. 2 GG
- b) Delegation von Kompetenzen und das Mehrheitsprinzip des Art. 121 GG
- c) Praktische Konsequenzen für die Delegation konkreter Kompetenzen
- d) Praktische Konsequenzen für die Delegation von Gesetzgebungsbefugnissen auf Ausschüsse
- B. Grundsätzliches Verbot plenarersetzender Delegation im Bereich der Gesetzgebung?
- I. Delegationsverbot aus Art. 77 GG in Verbindung mit weiteren Bestimmungen des Grundgesetzes
- II. Systematische Argumente und historische Hintergründe
- III. Zwischenergebnis
- IV. Sonderfall Haushaltsgesetz: Grundsätzliches Verbot plenarersetzender Delegation im Bereich von Budgetrecht und haushaltspolitischer Gesamtverantwortung?
- 1. Verabschiedung des Haushaltsgesetzes
- 2. Entscheidungen mit Bezug zur haushaltspolitischen Gesamtverordnung
- 3. Freigabe von Haushaltsmitteln durch den Haushaltsausschuss
- C. Zwischenergebnis
- Kapitel 4: Gleichheit der Abgeordneten als Grenze der Delegation von Kompetenzen auf Ausschüsse
- A. Repräsentationsprinzip und Gleichheit der Abgeordneten – Art. 38 GG als Delegationsgrenze?
- I. Das Prinzip der parlamentarischen Repräsentation
- 1. Begriff der Repräsentation
- a) Idealistische Konzepte der Repräsentation
- b) Realistische Konzepte der Repräsentation
- c) Zwischenergebnis
- 2. Parlamentarische Repräsentation unter dem Grundgesetz
- B. Gleichheit der Abgeordneten und Übertragung vorbereitender Aufgaben auf Ausschüsse
- I. Spiegelbildliche Ausschussbesetzung und Gleichheit der Abgeordneten – Gleichheit der Abgeordneten durch Gleichheit der Fraktionen?
- 1. Fraktionsspiegelbildliche Besetzung vorbereitend tätiger Ausschüsse und Gleichheit fraktionsangehöriger Abgeordneter
- a) Gleichheit der Fraktionen, aber Dispositionsbefugnis der Mehrheit? – BVerfGE 70, 324 „Haushaltskontrolle der Nachrichtendienste“
- b) Zwischenergebnis
- 2. Fraktionsspiegelbildliche Besetzung vorbereitend tätiger Ausschüsse und Gleichheit fraktionsloser Abgeordneter
- a) Fraktionslose Abgeordnete und fraktionsspiegelbildliche Ausschussbesetzung am Beispiel der Wüppesahl-Entscheidung
- b) Fraktionslose Abgeordnete in parlamentarischen Gruppen und fraktionsspiegelbildliche Ausschussbesetzung am Beispiel der Entscheidung PDS/Linke Liste
- c) Fraktionslose Abgeordnete in parlamentarischen Gruppen und fraktionsspiegelbildliche Ausschussbesetzung am Beispiel der Entscheidung Fraktions- und Gruppenstatus
- aa) Fraktionsstatus als Voraussetzung zur Teilnahme an der Ausschussbesetzung und Festsetzung einer Fraktionsmindeststärke durch Geschäftsordnungsrecht
- aaa) Verfassungsrechtliche Begründung besonderer Fraktionsrechte
- bbb) Festsetzung einer Fraktionsmindeststärke durch Geschäftsordnung
- bb) Festsetzung der Ausschussgröße durch den Bundestag
- cc) Bestimmung des Zählverfahrens für die Ausschussbesetzung durch die Mehrheit des Bundestages
- dd) Zwischenergebnis
- II. Zwischenergebnis zur Gleichheit der Abgeordneten und (fraktions-) spiegelbildlichen Besetzung vorbereitender Ausschüsse
- C. Gleichheit der Abgeordneten und die Übertragung plenarersetzender Kompetenzen auf Ausschüsse
- I. Delegation plenarersetzender Kompetenzen auf Ausschüsse am Beispiel der Entscheidung EFSF/StabMechG
- II. Grenzen der Gleichheit der Abgeordneten bei der Beschlussfassung
- III. Spiegelbildliche Besetzung plenarersetzend tätiger Ausschüsse und Gleichheit der Abgeordneten
- 1. Prüfungsmaßstab einzelner Organisationsmaßnahmen
- 2. Ausschussstärke
- 3. Bestimmung des Zählverfahrens
- 4. Zwischenergebnis
- IV. Zwischenergebnis zur spiegelbildlichen Besetzung plenarersetzender Ausschüsse
- D. Formale Anforderungen an die rechtliche Natur einer Delegation
- I. Position des Bundesverfassungsgerichts
- II. Eigene Position
- Kapitel 5: Das Öffentlichkeitsprinzip als Grenze der Delegation von Kompetenzen auf Ausschüsse
- A. Öffentlichkeit der Verhandlungen des Deutschen Bundestages und (Nicht-)Öffentlichkeit der Ausschussberatungen
- I. Inhalt und Bedeutung des Prinzips der Öffentlichkeit der Verhandlungen des Deutschen Bundestages
- II. Inhalt und Bedeutung des Prinzips der (Nicht-)Öffentlichkeit der Ausschussberatungen
- III. Hintergrund der Öffentlichkeit der Plenarsitzungen und Nichtöffentlichkeit der Ausschusssitzungen
- B. Konsequenzen eines Verstoßes gegen das Öffentlichkeitsprinzip bei Verhandlungen des Deutschen Bundestages
- C. Öffentlichkeitsprinzip als Grundlage eines Delegationsverbotes?
- D. Zwischenergebnis
- Kapitel 6: Besondere verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für eine Ausschusstätigkeit im grundrechtsrelevanten Bereich: Der Petitionsausschuss nach Art. 45c GG
- A. Historische Entwicklung des Petitionswesens
- B. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Petitionsausschusstätigkeit
- I. Rahmenbedingungen aus dem Petitionsgrundrecht des Art. 17 GG
- II. Besondere verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen im grundrechtsrelevanten Bereich aus systematischen Gründen
- III. Art. 45c GG und die Kompetenzen des Petitionsausschusses – Übertragung von Behandlungs- oder Entscheidungskompetenz?
- 1. Art. 45c GG als Grundlage einer Entscheidungskompetenz des Petitionsausschusses
- 2. Art. 45c GG als Grundlage einer Delegationsbefugnis
- IV. Funktionsfähigkeit des Bundestages als verfassungsimmanente Schranke des Petitionsgrundrechts
- V. Zwischenergebnis zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Petitionsverfahrens
- C. Petitionsverfahren des Deutschen Bundestages und dessen verfassungsrechtliche Zulässigkeit
- I. Petitionsverfahren des Bundestages
- 1. Vorprüfung durch den Ausschussdienst
- 2. Aufbereitung der Eingaben durch den Ausschussdienst
- 3. Behandlung von Petitionen im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages
- 4. Beschluss über die Petitionen im Deutschen Bundestag
- 5. Kritik am derzeitigen Petitionsbehandlungsverfahren
- II. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Petitionsverfahrens
- 1. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Kompetenzen des Ausschussdienstes unter dem Gesichtspunkt der Delegation
- 2. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Kompetenzen des Ausschussdienstes unter dem Gesichtspunkt des Gesetzesvorbehaltes
- 3. Kontroverse zum Umfang der Kompetenzen des Ausschussdienstes
- 4. Zwischenergebnis zu den Kompetenzen des Ausschussdienstes
- D. Zwischenergebnis
- Kapitel 7: Fazit
- Literaturverzeichnis
Mathias Färber
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
der Übertragung von Aufgaben
auf Ausschüsse des Deutschen
Bundestages – unter besonderer
Berücksichtigung plenarersetzender
Aufgabenwahrnehmung

Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Bielefeld, Univ., Diss., 2024
D 361
ISSN 0531-7312
ISBN 978-3-631-92855-4 (Print)
E-ISBN 978-3-631-92856-1 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-92857-8 (E-PUB)
DOI 10.3726/b22466
© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne (Schweiz)
Verlegt durch Peter Lang GmbH, Berlin (Deutschland)
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Für Eva Kristin
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2024 von der Juristischen Fakultät der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. Sie ist im Wesentlichen während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bielefelder Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Angelika Siehr, LL.M. (Yale) entstanden.
Mein herzlicher Dank gilt meiner Doktormutter Frau Prof. Dr. Angelika Siehr, die mir die Freiheit ließ, das Thema dieser Arbeit eigenständig zu entwickeln. Für ihre stete Unterstützung und wertvolle konstruktive Kritik bin ich sehr dankbar.
Herrn Prof. Dr. Andreas Fisahn danke ich für die äußerst zügige Erstellung des Zweigutachtens.
Meinen Freunden danke ich für ihre fortwährende Unterstützung in den verschiedenen Stadien der Arbeit, sei es durch inhaltliche Diskussionen, sorgfältiges Lektorat oder Anteilnahme an den Höhen und Tiefen des Entstehungsprozesses dieser Arbeit.
Ein besonderer Dank gilt meiner Familie und insbesondere Eva Kristin, die mich bei der Anfertigung dieser Arbeit stets unterstützt haben.
Inhalt
Kapitel 1: Einleitung und Problemaufriss
B. Historische Entwicklung des Ausschusswesens in Deutschland
I. Ressortorientierung der Bundestagsausschüsse
II. Rechtsgrundlagen fakultativer Ausschüsse
III. Obligatorische Ausschüsse
1. Rechtliche Grundlage der Einsetzung obligatorischer Ausschüsse
a) Zum verfassungsrechtlichen Grundsatz der Diskontinuität
b) Institutionelle oder nur personelle Diskontinuität bei obligatorischen Ausschüssen?
IV. Zwischenergebnis und weiteres Vorgehen
Kapitel 2: Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen auf Ausschüsse
1. Illustration am Beispiel der Untersuchungsausschüsse nach Art. 44 GG
1. Differenzierung anhand der Konsequenzen – ausschließliche und konservierende Delegation
2. Horizontale versus vertikale Delegation
B. Erscheinungsformen der vertikalen Delegation bei Ausschüssen des Deutschen Bundestages
I. Inhaltliche Differenzierungskriterien für die vertikale Delegation auf Ausschüsse
1. Delegation vorbereitender Aufgaben und Tätigkeiten
2. Delegation plenarersetzender Aufgaben auf Ausschüsse des Bundestages
II. Differenzierungen anhand der rechtlichen Grundlage einer Delegation
2. Delegation durch Geschäftsordnung, Gesetz oder Beschluss
I. Der Beschluss als primäre Handlungsform des Deutschen Bundestages
III. Delegationsmöglichkeiten unter dem Grundgesetz
1. Explizite Regelung des Art. 45 GG
a) Inhalt der nach Art. 45 S. 2 GG delegierbaren Kompetenzen
b) Zulässigkeit der damaligen Verfassungsänderung
2. Rechtslage in ungeregelten Fällen
a) Delegation von Kompetenzen und das Mehrheitsprinzip des Art. 42 Abs. 2 GG
b) Delegation von Kompetenzen und das Mehrheitsprinzip des Art. 121 GG
c) Praktische Konsequenzen für die Delegation konkreter Kompetenzen
d) Praktische Konsequenzen für die Delegation von Gesetzgebungsbefugnissen auf Ausschüsse
B. Grundsätzliches Verbot plenarersetzender Delegation im Bereich der Gesetzgebung?
I. Delegationsverbot aus Art. 77 GG in Verbindung mit weiteren Bestimmungen des Grundgesetzes
II. Systematische Argumente und historische Hintergründe
1. Verabschiedung des Haushaltsgesetzes
2. Entscheidungen mit Bezug zur haushaltspolitischen Gesamtverordnung
3. Freigabe von Haushaltsmitteln durch den Haushaltsausschuss
Kapitel 4: Gleichheit der Abgeordneten als Grenze der Delegation von Kompetenzen auf Ausschüsse
A. Repräsentationsprinzip und Gleichheit der Abgeordneten – Art. 38 GG als Delegationsgrenze?
I. Das Prinzip der parlamentarischen Repräsentation
a) Idealistische Konzepte der Repräsentation
b) Realistische Konzepte der Repräsentation
2. Parlamentarische Repräsentation unter dem Grundgesetz
B. Gleichheit der Abgeordneten und Übertragung vorbereitender Aufgaben auf Ausschüsse
Details
- Pages
- 262
- ISBN (PDF)
- 9783631928561
- ISBN (ePUB)
- 9783631928578
- ISBN (Softcover)
- 9783631928554
- DOI
- 10.3726/b22466
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (April)
- Keywords
- spiegelbildliche Ausschussbesetzung Gleichheit der Abgeordneten parlamentarische Repräsentation Minderheitenrechte plenarersetzende Delegation Aufgaben Ausschüsse Bundestag Staatsrecht Grenzen der Delegation Delegationsverbote
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 262 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG