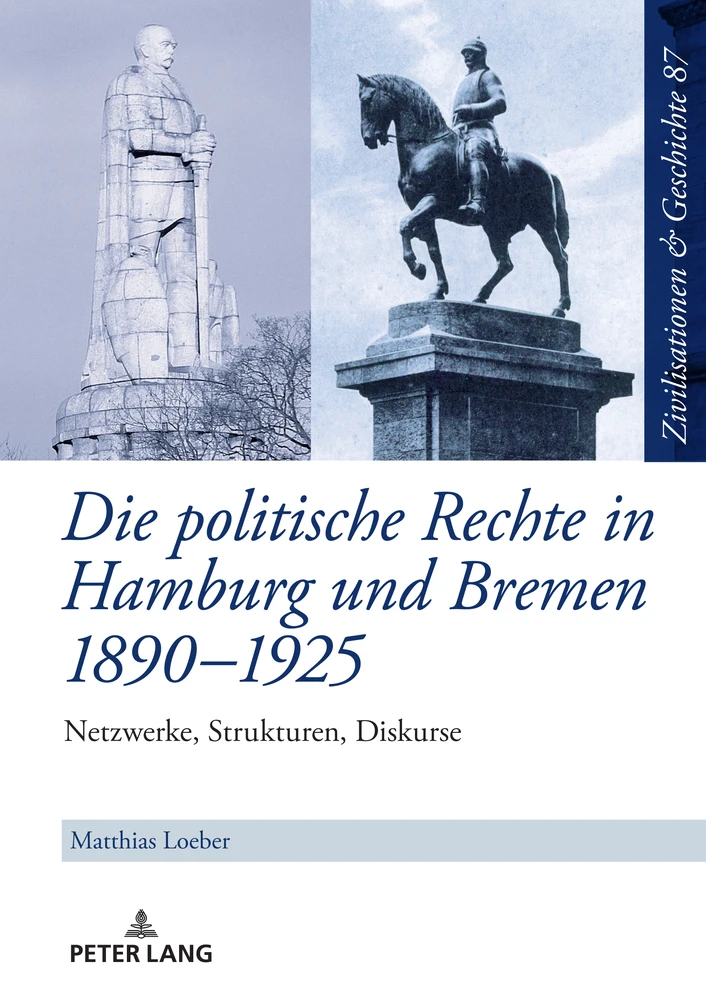Die politische Rechte in Hamburg und Bremen 1890–1925
Netzwerke, Strukturen, Diskurse
Summary
Um auf den digitalen Anhang zuzugreifen, gehen Sie auf den folgenden Link : https://supplementaryresources.blob.core.windows.net/4337687-loeber/Digitaler-Anhang.zip
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methoden, Theorien und Definitionen
- 3. Die Hansestadt Bremen: Politische Entwicklung 1890–1925
- 4. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Bremen: Historische Netzwerkanalyse
- 5. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Bremen: Sozialgeschichtliche Aspekte
- 6. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Bremen: Die politische Arbeit des nationalen Vereinswesens
- 7. Die Hansestadt Hamburg: Politische Entwicklung 1890–1925
- 8. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Hamburg: Historische Netzwerkanalyse
- 9. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Hamburg: Sozialgeschichtliche Aspekte
- 10. Vereine und Verbände der Rechten in Hamburg und ihr Mitwirken an der Politik der Stadt
- 11. Vereine und Verbände der politischen Rechten in Hamburg und Bremen: Analyse der politischen Semantik
- 12. Zusammenfassung und Ausblick
- 13. Abkürzungsverzeichnis
- 14. Tabellenverzeichnis
- 15. Quellen- und Literaturverzeichnis
- 16. Personenregister
1. Einleitung
„Nationalism is power hunger tempered by self-deception. Every nationalist is capable of the most flagrant dishonesty, but he is also – since he is conscious of serving something bigger than himself – unshakeably certain of being in the right.“1
Mit diesen Worten charakterisierte der britische Schriftsteller George Orwell (bürgerlich Eric Arthur Blair) eine für ihn wesentliche Grundlage nationalistischen Denkens. Orwell verfasste sein Essay „Notes on Nationalism“ 1945, nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Binnen einer Generation waren zum zweiten Mal Millionen von Menschen im Geiste von Nationalismus, Expansionismus und Chauvinismus getötet worden.
Was der demokratisch-sozialistische Autor intuitiv als Selbsttäuschung überspitzte – unter dem Begriff des Doublethink wurde es vier Jahre später ein zentrales Element seines bekanntesten Romans Nineteen Eighty-Four – ist im Kern zutreffend.
In seiner vielzitierten Schrift Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism betonte Benedict Anderson 1983 den Konstruktcharakter des Nationalismus.2 Er charakterisierte ihn als geistiges Produkt der Neuzeit und bezeichnete die Nation als eine vorgestellte politische Gemeinschaft: „Vorgestellt ist sie deswegen, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert.“3 Die Idee der Nation als einer Gemeinschaft von Gleichen sei im 19. und 20. Jahrhundert die Grundvoraussetzung dafür gewesen, „daß Millionen von Menschen für so begrenzte Vorstellungen weniger getötet haben als vielmehr bereitwillig gestorben sind.“4
Die ideengeschichtlichen Wurzeln des Nationalismus liegen in den Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts in Frankreich und Nordamerika. Grundlage seiner Erfolgsgeschichte war, dass er im Zuge des Niedergangs vormoderner dynastischer und territorialer Herrschaft wie auch des Verlustes religiöser Ordnungskategorien neue Integrations- und Legitimationsnarrative schuf.5 Wenn der Nationalismus auch zumeist auf Traditionen, auf die vermeintliche Wiedererweckung einer großen Vergangenheit pochte, so war er doch ein durchweg modernes Phänomen.6 Der Soziologe Rainer Lepsius hat, der Prämisse von Nationen als gedachten Ordnungen folgend, vier Typen des Nationenkonstrukts definiert:
- 1. Die Volksnation basiere auf dem Anspruch eines ethnisch homogenen Volkes. Dieses stehe letztlich in seiner Relevanz über Staatsform und Rechtsprechung, da nur das Volk Träger der Nation sein könne. Somit legitimiere das Konzept der Volksnation ggf. auch illiberale Herrschaftsformen, sofern diese vom Anspruch ethnischer Homogenität getragen seien. Das Konzept der Volksnation sei im Kern exklusiv. Es gehe von vermeintlichen Urzuständen reiner Ethnien oder Menschenrassen aus. Da die determinierenden Faktoren uneindeutig und hochgradig konstruiert seien, müsse das Konzept der Volksnation kulturelle, sprachliche und vermeintlich historische Faktoren mit einbeziehen und unterliege einem gesellschaftlich beeinflussten Wandel.
- 2. Die Kulturnation definiere ihre Angehörigen über die kulturelle Zusammengehörigkeit. Das Konzept sei im deutschen Sprachraum insbesondere nach dem Zerfall des Heiligen Römischen Reiches 1806 präsent gewesen, da ein zusammenhängendes deutsches Staatswesen nicht mehr bestand. Als unpolitisches Konzept könne jenes der Kulturnation neben anderen nationalistischen Ordnungsvorstellungen bestehen, solange diese beispielsweise die territoriale Nichtübereinstimmung von Herrschaftsgebiet und Kulturnation definierten.
- 3. Die Klassennation sei ein spezifisch in der Deutschen Demokratischen Republik gebräuchlich gewesenes Konstrukt, das die Existenz des realsozialistischen Staates in Abgrenzung vom kapitalistischen Westdeutschland legitimieren sollte.
- 4. Die Staatsbürgernation beziehe ihre Legitimation von den ihr angehörenden Staatsbürgern, welche sich im demokratischen Prozess eine eigene Regierung geben und von dieser mit gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Das Modell der Staatsbürgernation stelle heute den Normalfall moderner demokratisch organisierter Nationalstaaten dar.7
So wie die Nation ein Konstrukt und ein Resultat der politischen Vorstellungswelt des Nationalismus ist, so handelt es sich bei den von Lepsius aufgestellten Arten von Nationen um Idealtypen. In der historischen Realität wurde in der Regel nicht mit diesen Begriffen operiert, zumal die Nationalismen und die aus ihnen hervorgehenden Nationen zumeist Elemente mehrerer der hier genannten Kategorien aufwiesen.
Das Aufkommen des Nationalismus und der Prozess der Nationalstaatswerdung im deutschen Sprachraum weichen in einigen Punkten von denen der anderen europäischen Großmächte ab, worin sich die immer wieder intensiv diskutierte These eines deutschen Sonderwegs in die Moderne begründete.8 Während beispielsweise in Frankreich und den entstehenden Vereinigten Staaten die Nationalstaatengründung mit dem Ende der bzw. der Loslösung von der traditionellen dynastischen Herrschaft realisiert wurde, verzögerte sich im deutschen Sprachraum das Aufkommen des Nationalismus, wie auch die Gründung eines nationalstaatlich definierten Herrschaftsbereichs. Hans-Ulrich Wehler teilte diesen Prozess in drei Phasen ein:
- 1. Im Umfeld der Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts habe sich im deutschen Sprachraum eine nationalistische Befreiungsideologie als intellektuelles Phänomen herausgebildet. Diese sei zunächst nur kulturell motiviert, nach dem Niedergang des Heiligen Römischen Reiches auf die Entstehung eines einheitlichen deutschen Staatswesens konzentriert gewesen, habe sich aber von Beginn an auch durch äußere Feindbilder, insbesondere antifranzösische Affekte definiert.
- 2. Bis zum Beginn der Revolution von 1848/49 habe sich der Nationalismus zur Massenbewegung entwickelt und sei in breiten Bevölkerungsschichten durch Turn- und Gesangsvereine oder akademische Korps vertreten worden.
- 3. Mit dem Scheitern der bürgerlichen Revolution geriet auch der deutsche Nationalismus in eine Krise, bevor er Ende der 1850er Jahre, nun vermehrt kleindeutsch-preußisch geprägt, wieder hervorgetreten sei und im Zuge der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 und der Gründung des Deutschen Kaiserreiches vorerst sein Ziel erreicht habe.9
War der Nationsbegriff im deutschen Sprachraum zunächst ein überwiegend kultureller, der sich z.B. sprachlich definierte, wurde er im Zuge der sogenannten Einigungskriege zunehmend machtpolitisch und im Sinne der Volksnation ethnisch aufgeladen. Insbesondere das in dieser Hinsicht ungeklärte Verhältnis zur deutschsprachigen und als ethnisch deutsch wahrgenommenen Habsburgermonarchie blieb widersprüchlich. Nation und Staat waren im nationalistischen Verständnis nicht deckungsgleich.10 Vor diesem Hintergrund ist im Nationalismus des Deutschen Kaiserreichs bereits wenige Jahre nach dessen Gründung ein semantischer Wandel zu verzeichnen.
„Im Hinblick auf die ‚gedachte Ordnung‘ der Nation warf die Gründung des Deutschen Reiches ebenso viele Probleme auf, wie sie löste. Mit der Reichsgründung war die Nationsbildung keineswegs abgeschlossen, vielmehr markierte sie den Anfang eines neuen Nationsbildungsprozesses, der durch das Spannungsverhältnis zwischen den Vorstellungen der Reichsnation und der Volks- bzw. Kulturnation geprägt war.11
Die Nationalstaatengründung war in Deutschland obrigkeitlich erfolgt, sie war das Resultat preußischer Machtpolitik. Entsprechend war der seit der Reichsgründung in weiten Bevölkerungsschichten verbreitete Nationalismus militaristisch geprägt.12 Ihm inhärent war ein „Gestus anmaßender Überheblichkeit gegenüber anderen Nationen, vor allem dem besiegten Frankreich“.13 Der Nationalismus wurde Staatsdoktrin, Reich und Nation wurden als Einheit verstanden und mit der Hohenzollernmonarchie gleichgesetzt. Während die Reichspolitik Bismarcks ab Ende der 1870er Jahre zunehmend konservative Positionen übernahm, fanden ethnisch definierte Nationskonzepte im Deutschen Reich größere Verbreitung als etwa im benachbarten Frankreich – was vor dem Hintergrund der im ethnischen Sinne unvollständigen Nationsgründung zu Spannungen führen musste.14 Diese Forcierung der Volksnation bei gleichzeitig offenen Widersprüchen – etwa dem ungeklärten Verhältnis zu den deutschsprachigen Österreichern oder der Existenz sprachlicher Minderheiten im Deutschen Reich – waren ein Motor der Radikalisierung nationalistischer Inhalte und Zielsetzungen seit den 1880er Jahren. Gleichermaßen beeinflussten der aufkommende Imperialismus und die Hinwendung der bismarckschen Politik zum Kolonialismus Mitte der 1880er Jahre den Wandel nationalistischer Gedankenwelten. Mit dem Ende der Amtszeit des Reichskanzlers, auf dessen Person die Reichsverfassung wesentlich zugeschnitten war, entstand ein Machtvakuum, das keiner seiner Nachfolger auszufüllen vermochte. Zugleich suchte der verstärkt auftretende Radikalnationalismus in dieser politisch unklaren Lage nach Ausdrucksformen.15 In dieser Zeit ist die Gründung einer Reihe von großen, als Massenorganisationen initiierten nationalen Agitationsvereinen zu verorten, von denen der 1891 gegründete Alldeutsche Verband am radikalsten auftrat.16 Rainer Hering definierte diese Agitationsverbände als zumeist bildungsbürgerliche Interessenverbände, die sich der konkreten Durchsetzung ihrer machtpolitischen, expansionistischen und imperialistischen Ziele annahmen.17
Die Hansestädte Hamburg und Bremen gehörten wie ihre Schwesterstadt Lübeck als Stadtstaaten dem Deutschen Kaiserreich an. Als bürgerliche Handelsrepubliken verfügten sie über keine monarchisch-dynastische Tradition und hatten sich noch im frühen 19. Jahrhundert überwiegend partikularistisch verhalten oder waren zumindest als Partikularisten wahrgenommen worden.18 Dennoch fanden die Hansestädte in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend auch ideell ihren Weg in den entstehenden deutschen Nationalstaat. Der wirtschaftliche Erfolg wie auch die Flotten- und Kolonialbegeisterung verfestigten die Identifikation mit dem 1871 proklamierten Kaiserreich.19 Wenn auch Reichspatriotismus und proborussische Haltung in Hamburg und Bremen nach 1871 das Handeln bestimmten, so verfügten die Nordsee-Hansestädte, wie auch die an der Ostsee gelegene Schwesterstadt Lübeck, mit dem Bezug auf die hansische Vergangenheit, mit dem Selbstbild des Hanseatentums über eine eigene historische Tradition. Das Bild einer Oberschicht, die sachlich und zurückhaltend agierte, geschäftlich erfolgreich, zugleich nüchtern und bescheiden vorging, prägte das Selbstverständnis in den Hansestädten und ist bis in die Gegenwart Teil des Selbst- wie Fremdbildes der städtischen Eliten an Elbe und Weser – das ökonomisch schwächere Lübeck verlor dagegen 1937 die Eigenstaatlichkeit an Preußen.20
Bei aller Identifikation mit dem deutschen Nationalstaat hatten die Hansestädte unweigerlich eine partikulare historische Tradition und mitunter divergierende Interessen, welche durch die Bedürfnisse von Überseehandel und maritimer Wirtschaft geprägt waren.
Dennoch deutet einiges darauf hin, dass der radikale Nationalismus seit den 1890er Jahren auch in den Hansestädten Hamburg und Bremen eine bedeutende Rolle spielte. So verfügte der Alldeutsche Verband in Hamburg über seine reichsweit zweitgrößte Ortsgruppe, prominente Akademiker und Kaufleute gehörten seinem Vorstand an.21 Eine Reihe von großen radikalantisemitischen Organisationen, darunter der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV) und der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund (DVSTB), waren in Hamburg gegründet worden und gingen aus den dortigen Netzwerken der politischen Rechten hervor.22 Die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), 1918 als „hurried amalgam“23 zur Neuorganisation der politischen Rechten gegründet, war in Hamburg von Beginn an stramm völkisch-antisemitisch orientiert.24
Die Hansestadt Bremen wies, wie zu zeigen sein wird, bemerkenswerte Aktivitäten der nationalen Agitationsvereine, insbesondere des Deutschen Flottenvereins (DFV) und der Deutschen Kolonialgesellschaft (DKG) auf. Nach 1918 trat eine radikal völkisch agierende neue politische Rechte auf, die enge Verbindungen in die Heimatschutzbewegung, vor allem aber in die paramilitärischen Wehrverbände und radikal rechte Geheimgruppen aufwies.25
Während die überregionale Geschichte des Radikalnationalismus der wilhelminischen Ära wie auch die Organisationsgeschichte einzelner Gruppen der (radikalen) Rechten bereits zum Teil erforscht sind, fehlt es noch gänzlich an übergreifenden Studien zum politisch rechtsstehenden Milieu in den Hansestädten – obwohl dessen Erforschung unbedingt lohnenswert erscheinen muss.26
1.1. Vorgehen und Fragestellung
Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen Überblick über die politische Kultur des rechtsstehenden, nationalistischen Lagers der beiden Hansestädte Hamburg und Bremen aufzustellen. Die Arbeit forciert den Zeitraum ab 1890, der, wie hier dargelegt, als Phase des Aufkommens des Radikalnationalismus im Deutschen Reich zu verstehen ist. Es wird danach gefragt, in welchem Umfang dieser Radikalnationalismus an Elbe und Weser Fuß fassen konnte. Bewusst wird die Zäsur von 1918 mit dem Ende des Kaiserreiches überschritten, um danach fragen zu können, wie sich die politische Rechte nach Kriegsniederlage, Demokratisierung und Pluralisierung der Gesellschaft reorganisierte. Wenn auch ein Blick bis über die abermalige Zäsur der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 sinnvoll und wünschenswert erschiene, kann dies im Umfang der vorliegenden Studie nicht geleistet werden. So endet der Untersuchungszeitraum zur Mitte der 1920er Jahre, jener Phase der einstweiligen Stabilisierung der Verhältnisse in der ersten deutschen Republik.27
Da es bislang an übergreifenden Untersuchungen zur politischen Rechten der beiden Städte fehlte, wird hier ein bewusst breiter Zugang gewählt. Generell spielte sich die politisch rechte Radikalisierung der 1890er Jahre weniger in den Reichstagsparteien als im Vereins- und Verbändewesen ab. Dies gilt in verstärktem Maße für die Hansestädte, in deren Parlamenten politische Parteien bis 1918 mit Ausnahme der Sozialdemokratie kaum eine Rolle spielten. Es wird deshalb hier der Blick schwerpunktartig auf das politisch rechtsstehende Vereins- und Verbändewesen gerichtet. Dabei werden nicht nur die nationalen Agitationsvereine, als Exponenten des neuen Radikalnationalismus, untersucht. Im verhältnismäßig eng verbundenen politischen Geschehen der Stadtstaaten fanden sich, wie zu zeigen sein wird, enge Überschneidungen zwischen verschiedenen Gruppen der politischen Rechten, etwa zwischen den erwähnten Agitationsvereinen, dem Heimatschutz, dem Kriegervereinswesen, aber auch der radikalantisemitischen Völkischen Bewegung. Anstatt sich also auf einzelne Organisationen oder Arten von Gruppierungen zu beschränken, wird hier der Versuch unternommen, einen übergeordneten Blick auf die politische Rechte der Hansestädte aufzubauen. Dazu wird die vorliegende Studie auf die Methoden der historischen Netzwerkanalyse zurückgreifen und in quantitativer Arbeitsweise zu ermitteln versuchen, welche Personen und Organisationen in der politischen Rechten der Hansestädte eine Rolle spielten. Hierdurch wird der Untersuchung eine Struktur gegeben, werden die zu untersuchenden Gruppierungen kategorisiert.
Auf dieser Grundlage wird ermittelt, welche Bevölkerungsteile in den jeweiligen Organisationen dominierten, welche soziale Zusammensetzung die Vereine aufwiesen und wie mitgliederstark sie waren. Es wird dann versucht, die politische Praxis der untersuchten Vereine und Verbände zu analysieren. Auch soll danach gefragt werden, wie diese Gruppierungen ihre Ziele und Vorstellungen vertraten, wie sie sich nach außen repräsentierten.
Da für beide Hansestädte Grundlagenarbeiten noch fehlen, werden die genannten Untersuchungsschritte für beide Städte nacheinander durchgeführt und in einem abschließenden Resümee vergleichend zusammengebracht.
Auf den vorangegangenen Seiten wurde beschrieben, wie der Nationalismus zum wirkmächtigen ideengeschichtlichen Konstrukt wurde und die Nationalstaatenbildungen des 18. und 19. Jahrhunderts evozierte. Mit einem solchen Verständnis folgt diese Arbeit einem genuin konstruktivistischen Geschichtsbild, wie es die Neue Kulturgeschichte vertritt.28 Vor diesem Hintergrund soll in einem letzten Untersuchungsschritt die politische Semantik der Gruppen der politischen Rechten der Hansestädte genauer analysiert werden. Im Zuge der Recherchen sind eine Reihe von immer wiederkehrenden inhaltlichen Topoi aufgetreten, die sowohl in Hamburg als auch in Bremen in erstaunlicher Ähnlichkeit vertreten wurden. Es wird hier darum gehen, diese semantischen Motive aufzuzeigen, zu erläutern und somit danach zu fragen, was deren Funktion im politisch rechten, nationalistischen Denken war.
So verfolgt diese Studie das Ziel, in möglichst großem Umfang nach den Akteur:innen der politischen Rechten, nach ihrem konkreten Handeln, wie auch nach den von ihnen erzeugten politischen Sinnstiftungsangeboten zu fragen.
Es liegt auf der Hand, dass im Rahmen dieser Arbeit kein allumfassendes Bild der politischen Rechten beider Hansestädte aufgebaut werden kann – schon die heterogene Quellenlage und der Umfang der Studie verhindern dies. Sehr wohl kann diese Arbeit jedoch eine fundierte Grundlage für die kontinuierliche, systematische weitere Erforschung und Ausdifferenzierung des Gegenstandes aufstellen.
1.2. Quellenlage
Forschungen zur Arbeit von Vereinen, Verbänden und politischen Gruppierungen stehen grundsätzlich vor der Herausforderung potenziell unsystematischer oder selektiver Überlieferung. Anders als im Falle staatlicher Stellen wie Behörden ist eine archivische Sammlung zu einzelnen Organisationen nicht vorauszusetzen. Dennoch kann sich diese Arbeit im Kern auf unveröffentlichte Archivunterlagen stützen, vorrangig aus dem Staatsarchiv Hamburg (StAH), dem Staatsarchiv Bremen (StAB) und den Standorten des Bundesarchivs (BArch).
Seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zum 1. Januar 1900 mussten neugegründete Vereine in die bei den Amtsgerichten angesiedelten Vereinsregister eingetragen werden. Für Vereine, welche zuvor gegründet worden waren, galt und gilt diese Regelung nicht.29 Die Vereinsregister, so weit sie in Hamburg und Bremen überliefert sind, geben einen Überblick über einzelne Organisationen, deren Vorstandsmitglieder und Satzungen.30 Organisationen, die nicht unter das Vereinsrecht fielen, etwa inoffizielle Zusammenschlüsse, tauchen hier jedoch ebensowenig auf, wie Vereine alten Rechts.
Neben den Vereinsregistern ermöglicht eine Reihe von Beständen in den Staatsarchiven der beiden Hansestädte eine systematische Analyse. Im Staatsarchiv Hamburg ist dies vor allem die Überlieferung der Politischen Polizei.31 Diese Abteilung der Hamburger Polizeiverwaltung wurde 1890 nach Auslaufen der Sozialistengesetze neu organisiert. Bis zur Auflösung und Neuaufstellung durch den Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat 1918 überwachte sie politische Organisationen, legte Pressesammlungen an und protokollierte Gespräche politischen Inhalts in Versammlungsorten und Lokalitäten. Zwar war die Politische Polizei für die Überwachung der Aktivitäten aller politischer Lager zuständig, gegenüber rechtsgerichteten Organisationen verhielt sie sich jedoch zurückhaltender als gegenüber der Arbeiterbewegung.32 Dennoch ist der Bestand für den Untersuchungsgegenstand von elementarer Bedeutung, zumal die Mitarbeiter der Behörde in der Regel Listen über Vorstandsmitglieder und chronologische Verzeichnisse der Aktivitäten auch für rechtsstehende Gruppen anlegten. Dies ist beispielsweise besonders einschlägig für die Kriegervereine, die überwiegend vor 1900 gegründet wurden und somit nicht unter das Vereinsrecht nach dem BGB fielen. Allein 56 Akten im Teilbestand der Politischen Polizei zu Hamburger Kriegervereinen konnten hier berücksichtigt werden.33 Insgesamt wurden hier 95 Akten der Politischen Polizei über rechtsstehende Vereinigungen herangezogen. Mit der Zeit der Reorganisation dieser Polizeieinheit 1918 endet deren Überlieferung fast vollständig. Ein vergleichbar systematisch angelegter Bestand zu Vereinen und Verbänden existiert im Staatsarchiv Hamburg für die Zeit nach 1918 leider nicht. Die Vereinsarchive einzelner Organisationen sind vom Staatsarchiv in der dortigen Bestandsgruppe 6 bewahrt worden. Es handelt sich dabei in der Regel um von den Vereinen selbst abgeliefertes, potenziell selektiv bearbeitetes Material.34 In ähnlicher Weise funktionieren die Nachlässe einzelner Vereinsaktiver sowie einschlägige Firmenarchive in der gleichen Bestandsgruppe. Auch im Falle dieser Unterlagen muss die Möglichkeit einer vorherigen Dokumentenauswahl durch die Deponenten berücksichtigt wurden.35
Neben diesen vereinseigenen Beständen bestehen in den Überlieferungen der Hansestadt Hamburg sowie ihrer ehemaligen preußischen Nachbargemeinden und -städte Korrespondenzen zwischen einzelnen Organisationen und den jeweiligen Stadtverwaltungen.36
Eine Auswahl relevanter Auszüge aus historischen Periodika bieten die sachbezogenen Pressesammlungen des Hamburger Staatsarchivs, die hier ebenfalls berücksichtigt werden.37
Generell ist festzuhalten, dass die für den Hamburger Forschungsgegenstand einschlägige Archivüberlieferung für die Zeit vor 1918 deutlich stärker ausgeprägt ist als für die Jahre der Weimarer Republik. So sind viele prominente Organisationen der republikfeindlichen Rechten nach 1918 in den Archivquellen kaum nachzuvollziehen. Systematisch angelegte Bestände wie jener der Politischen Polizei fehlen gänzlich.38
Eine gegenteilige Tendenz zeigt die Überlieferung zum Bremer Forschungsgegenstand im dortigen Staatsarchiv. So ist in Bremen für die Zeit des Kaiserreichs neben dem Vereinsregister nur der Bestand 3-V.2 der Senatsregistratur heranzuziehen, welcher die Korrespondenz von Vereinen, Parteien, Gewerkschaften und Organisationen mit dem Bremer Senat dokumentiert. In den Akten befinden sich die Schriftwechsel mit einzelnen Vereinen, Organisationen oder Komitees in chronologischer Reihenfolge, je nach Zeit des Bestehens der jeweiligen Gruppierung seit der Zeit des Kaiserreichs mitunter bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik.39 Insgesamt 44 Akten dieses Bestandes wurden ausgewertet. Analog zur Überlieferung der Hamburger Politischen Polizei existiert hier ein eigener Teilbestand zum Kriegervereinswesen mit seinen diversen Stadtteil- und Waffengattungsvereinen. Daneben bestehen Akten über die Interaktion mit den nationalen Agitationsvereinen und der Heimatschutzbewegung.40
Anders als in Hamburg ist die Überlieferung der Politischen Polizei in Bremen bis 1918 nur fragmentarisch erhalten. Organisationen des nationalen Bürgertums bzw. der politischen Rechten wurden, so weit die Überlieferung die Beurteilung zulässt, kaum überwacht. Die wenigen vorhandenen Unterlagen dokumentieren hier nur die Anmeldung von Veranstaltungen.41
Demgegenüber bietet der Bestand der nach 1918 neu aufgestellten Nachrichtenstelle der Polizeidirektion Bremen die Möglichkeit zur systematischen Annäherung an die Erforschung politisch rechter und radikal rechter Gruppen. Reaktionäre Organisationen, Wehrverbände und paramilitärische Gruppen wie auch Parteien der äußeren politischen Rechten wurden beobachtet. Neben Versammlungsberichten finden sich in diesem Bestand Pressesammlungen, Verhörprotokolle und Korrespondenzen mit den Sicherheitsorganen des Reiches.42
Neben diesen beiden zentralen Beständen verfügen auch im Staatsarchiv Bremen einzelne Gruppierungen über Vereinsarchive, die zumeist von deren Aktiven abgeliefert und somit ebenfalls potenziell selektiv bearbeitet wurden. Gleiches gilt für die Nachlässe ehemaliger Aktiver des politisch rechten Vereinswesens.43 Wie auch in Hamburg konnte für den Bremer Untersuchungsgegenstand auf vom dortigen Staatsarchiv angelegte Sammlungen von Pressezeugnissen und Flugschriften einzelner Organisationen und Personen zurückgegriffen werden.44
In der Überlieferung der Staatsarchive Hamburg und Bremen fällt somit ein Ungleichgewicht auf: Während die Hamburger Unterlagen für die Zeit vor 1918 stärker ausgeprägt und systematischer zu erarbeiten sind, verfügt das Bremer Staatsarchiv über umfassendere Bestände für die Zeit der Weimarer Republik. Durch gezielte Recherche in weiteren Archiven wurde diese Diskrepanz so weit wie möglich ausgeglichen. So konnten etwa aus dem Archiv der Handelskammer Bremen (AHK) Unterlagen über die Aktivitäten der nationalen Agitationsvereine Bremens in wilhelminischer Zeit herangezogen werden.45
Für beide Forschungsbereiche einschlägig waren zudem Unterlagen des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde. Für die dortigen Recherchen wurde in der Weise vorgegangen, dass gezielt nach allen für die Hansestädte bereits bekannten Organisationen gesucht wurde. Dabei wurde insbesondere der Versuch angestellt, das Ungleichgewicht in der Überlieferung auszugleichen. Auf diese Weise konnte das Bild komplettiert und der Frage nachgegangen werden, ob die jeweils untersuchte Organisation tatsächlich in einer der Städte weniger aktiv, oder ob nur die Überlieferung lückenhaft war. Insbesondere für die Erforschung völkischer Gruppierungen, die, wie beispielsweise der Deutschbund, eher im Verborgenen agierten, waren hier das fragmentarische Vereinsarchiv des Alldeutschen Verbandes wie auch der Nachlass des völkischen Akteurs Friedrich Lange einschlägig.46 Gewinnbringend waren zudem, etwa im Falle der regionalen Aktivitäten der rechtsextremen Terrorgruppe Organisation „Consul“, die Beobachtungs- und Prozessunterlagen der Reichsbehörden. Verbotsverfügungen und die Beschwerden gegen ebenjene gehören in den gleichen thematischen Bereich und geben Auskunft über die radikale Rechte der Weimarer Jahre.47 Auch zu vergleichsweise gut dokumentierten Organisationen, etwa der Deutschen Kolonialgesellschaft oder der Deutschnationalen Volkspartei konnten aus den Vereinsbeständen des Bundesarchivs ergänzende Unterlagen herangezogen werden.48 Eine auskunftsreiche Quelle zur historischen Pressearbeit ist daneben die Pressesammlung des Reichslandbundes, die Akten über diverse Akteure und Organisationen der politischen Rechten enthält.49
Die archivische Überlieferung bildet eine solide Grundlage zur Beantwortung der Frage nach den beteiligten Personen und bietet somit einen Überblick über die Tätigkeiten der hier organisierten Gruppen. Diese Grundlage wird ergänzt durch die von den untersuchten Organisationen herausgegebenen Publikationen. So veröffentlichten die Landesverbände der großen nationalen Agitationsvereine wie auch die größeren regionalen Kriegervereine Jahresberichte.50 Aus dem Umfeld der nationalen Verbände und des Heimatschutzes existieren Denkschriften und Monografien zu Spezialthemen, die hier herangezogen werden konnten.51
Die größeren für den Untersuchungsgegenstand relevanten Vereine, Parteien und Organisationen brachten eigene Periodika heraus. Neben einem Nutzen für die Ergänzung der politischen Ereignisgeschichte sind diese von besonderem Wert für die Analyse der politischen Semantik im letzten Teil dieser Arbeit. Einschlägig sind die Alldeutschen Blätter des Alldeutschen Verbandes ab 1894,52 die Mitteilungen des Deutschen Flottenvereins ab 1898 und Die Flotte ab 190053 als Periodika des Deutschen Flottenvereins sowie die Deutsche Kolonialzeitung, die ab 1884 erschien und ab 1888 Organ der Deutschen Kolonialgesellschaft war.54 Die Kriegervereine verfügten mit der Parole des Deutschen Kriegerbundes über ein überregionales Medium, das aber tendenziell weniger beliebt war als die Mitteilungsblätter der regionalen Landesverbände und Einzelvereine.55 Letztere wurden, sofern sie aufzufinden waren, berücksichtigt.56 Neben den überregionalen Periodika größerer Massenverbände, etwa der Deutsche Handels-Wacht des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes ab 1896,57 konnten hier auch regionale Blätter der radikalen Rechten berücksichtigt werden. Eine Reihe von Organisationen unterhielten in den Hansestädten eigene Zeitschriften, so etwa die Abwehr und das Deutsche Blatt der verschiedenen antisemitischen Wahlvereine in Hamburg,58 oder Das Rathaus als wöchentliches Periodikum der Bremer DNVP ab 1920. Während diese Pressezeugnisse die Interna der Vereinsarbeit und die semantische Ausgestaltung ihrer politischen Vorstellungen dokumentieren, wird die regionale Tagespresse, wie sie z.B. in den oben erwähnten Pressesammlungen überliefert ist, herangezogen, um Veranstaltungen und öffentliche Aktivitäten der untersuchten Gruppen sowie deren Resonanz in der Stadt zu analysieren. Die Hansestadt Hamburg wies einen „beeindruckenden medialen Pluralismus“ auf, der sich in einer Gesamtzahl von über 190 Zeitungen und Zeitschriften im Verlauf des 19. Jahrhunderts äußerte.59 Die älteste und renommierteste Zeitung der Stadt, der Hamburger Correspondent habe das nationalliberale Großbürgertum des späten wilhelminischen Reiches repräsentiert, in den Weimarer Jahren habe die Zeitung der DVP nahe gestanden. Das ursprünglich konservativ ausgerichtete Hamburger Fremdenblatt habe mit einer Auflage von bis zu 150.000 Exemplaren dagegen zunehmend linksliberale Positionen vertreten und sich nach 1918 bei der DDP angesiedelt. Exponiert rechts ausgerichtet seien dagegen die Hamburger Nachrichten gewesen, die offenbar Verbindungen zum Alldeutschen Verband aufwiesen.60 Ab 1890 übte Altreichskanzler Otto von Bismarck über den Redakteur Hermann Hofmann direkten Einfluss auf das Blatt aus.61 Als radikal rechtes Blatt trat die Hamburger Warte Friedrich Carl Holtz’ auf. Dieser positionierte seine Wochenzeitung in der Zeit ab 1918 explizit antisemitisch.62 Mit dem Hamburger Echo verfügte die SPD bzw. MSPD über eine eigene Tageszeitung mit einer Auflage von rund 75.000 Exemplaren vor 1914. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs war das Echo die bezogen auf die Auflage reichsweit zweitgrößte Tageszeitung der Arbeiterbewegung und wurde nur vom Vorwärts übertroffen.63 Im äußeren linken politischen Spektrum existierte ab 1918/19 die Rote Fahne, aus der die Hamburger Volkszeitung hervorging. Beide waren zunächst der USPD zugeordnet. Nach der Spaltung der Partei fusionierte die Volkszeitung mit der Kommunistischen Arbeiterzeitung zur Tageszeitung der Hamburger KPD.64
In Bremen existierten um die Wende zum 20. Jahrhundert fünf Tageszeitungen mit einer Auflage von zusammen rund 85.000 Exemplaren. Der handwerklich- mittelständische Bremer Courier wurde 1906 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Auflagenstärkste Zeitung waren die Bremer Nachrichten, die vor Beginn des Ersten Weltkriegs mit 50.000 Exemplaren die Gesamtauflage der Bremer Presse proportional klar dominierten. Sie traten politisch in der Zeit des Kaiserreichs nicht merklich hervor und sprachen eine breite Leserschaft an.65 In den Weimarer Jahren verstanden sie sich als Organ der drei großen bürgerlichen Parteien, bevor sie sich ab Ende der 1920er Jahre zunehmend nach rechts öffneten.66 Die Weser-Zeitung war die Zeitung der wirtschaftlichen Elite. Sie hatte den höchsten Verkaufspreis bei der kleinsten Auflage und repräsentierte Handel, maritime Wirtschaft sowie Schwerindustrie.67 Ende 1917 wurde sie durch ein Konsortium Bremer Handelsvertreter übernommen und ganz auf die Linie des radikalen Annexionismus der neugegründeten Deutschen Vaterlandspartei gebracht.68 In dieser Zeit teilte die Weser-Zeitung ihren Chefredakteur mit dem Bremer Tageblatt. Dieses hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein tendenziell politisch rechtes Profil, in der Kriegszeit vertrat es dezidiert chauvinistische Positionen.69 Während das Tageblatt 1920 eingestellt wurde und im Folgejahr in der DVP-, später DNVP-nahen Bremer Zeitung aufging, habe die Weser-Zeitung sich wieder auf wirtschaftsliberale Forderungen besonnen.70
Die zweitgrößte Auflage der Bremer Presselandschaft hatte die Bremer Bürger-Zeitung als Organ der Sozialdemokratie. Im Ersten Weltkrieg positionierte sie sich wiederholt auf Linie der Parteilinken und wurde durch die Reichsführung der Partei zur Räson gerufen.71 In der revolutionären Phase nach Kriegsende wurde das Blatt durch die radikale Linke zeitweise verboten. Mit der Bremer Arbeiterzeitung der USPD fusionierte es 1922 zur Bremer Volkszeitung.72 Weiter links im politischen Spektrum existierten von 1918 bis 1920 Der Kommunist als Bremer Periodikum und Die Rote Fahne als regionales KPD-Organ.73 Mitte der 1920er Jahre lag die Auflage der Bremer Nachrichten bei einer Bevölkerung von rund 300.000 Einwohnern bei ca. 70.000 Exemplaren, gefolgt von der Bremer Volkszeitung mit 18.000 Stück und der Bremer Zeitung mit einer Auflage von etwa 18.000.74 Im Folgenden werden die Zeugnisse der Tagespresse Hamburgs und Bremens auch herangezogen, um die Beurteilung der Aktivitäten der verschiedenen rechtstehenden Gruppen in den politisch unterschiedlich ausgerichteten Zeitungen zu analysieren.
Durch die Kombination aus der Untersuchung unveröffentlichten Archivguts und publizistischer Quellen sollen die Aktivitäten der politisch rechtsstehenden Gruppen möglichst umfassend erschlossen werden. Im nächsten Abschnitt erfolgt ein Überblick über bisher erfolgte für den Gegenstand dieser Arbeit relevante Forschungsarbeiten.
1.3. Forschungsstand
In dieser Studie wird eine verhältnismäßig große und heterogene Gruppe von Organisationen der politischen Rechten in zwei politischen Systemen und zwei verschiedenen Regionen untersucht. Entsprechend vielfältig sind die Forschungsstränge, die in dieser Arbeit zusammenlaufen. Es soll an dieser Stelle der Versuch unternommen werden, wesentliche inhaltliche Felder und Positionen der für diese Studie relevanten Forschungsliteratur zu benennen.
Die weit größte Aufmerksamkeit unter den hier untersuchten Gruppierungen haben in der Vergangenheit zweifelsohne die großen nationalen Agitationsvereine der wilhelminischen Ära, der Deutsche Flottenverein (DFV), die Deutsche Kolonialgesellschaft (DKG), der Deutsche Wehrverein (DWV) und der Alldeutsche Verband (ADV) sowie ferner der Reichsverband gegen die Sozialdemokratie und der Deutsche Ostmarkenverein erfahren.
Eine erste intensive Auseinandersetzung mit dem Deutschen Flottenverein erfolgte durch Eckart Kehr noch in der Zeit der Weimarer Republik. Seine 1927 bei Friedrich Meinecke verfasste, 1930 veröffentlichte Dissertation untersucht die deutsche Flottenrüstungspolitik der wilhelminischen Ära und in diesem Zusammenhang auch die Rolle des DFV. Kehr verfocht in Umkehrung der etablierten geschichtswissenschaftlichen Lehrmeinung den Primat der Innenpolitik: Territoriale Expansion, Flottenrüstung und Weltmachtstreben deutete er als Ventile für innenpolitische Spannungen, auswärtige imperialistische Politik als auf die Innenpolitik abzielenden Sozialimperialismus.75
Bedingt durch seine Emigration in die Vereinigten Staaten, seinen frühen Tod und die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 geriet Kehrs Werk weitgehend in Vergessenheit. Die Bielefelder Sozialgeschichte um Hans-Ulrich Wehler entdeckte das Schaffen des progressiven Historikers in den späten 1960er Jahren wieder, gab dessen Schriften neu heraus und übernahm seine Prämissen zum Primat der Innenpolitik und zum Sozialimperialismus.76 Zu den Grundannahmen der Bielefelder Schule dieser Zeit gehörte damit einhergehend das Theorem des deutschen Sonderwegs, die Vorstellung, dass das Deutsche Reich eine von der politischen Normalentwicklung abweichende Nationalstaatenbildung durchlaufen hätte. Durch das Ausbleiben einer erfolgreichen bürgerlichen Revolution, die Konservierung vormoderner Privilegien des ländlichen Adels und fehlende Parlamentarisierung sei das Deutsche Kaiserreich nicht reformierbar oder modernisierbar gewesen. Der Sozialimperialismus im Sinne Kehrs sei als Antwort auf die deshalb entstandenen Probleme zu verstehen.
Zu den schärfsten Kritikern der Theoreme Wehlers gehörte der britische Historiker Geoff Eley. Gemeinsam mit David Blackbourn monierte er das Festhalten an der Sonderwegs-Theorie in der deutschen Geschichtswissenschaft. Wenn die beiden Autoren auch die genannten rückständigen Elemente der politischen Kultur durchaus anerkannten, so betonten sie doch, dass die Sonderwegs- Theorie das Deutsche Kaiserreich lediglich als Negativfolie zum politischen Konkurrenten England verstehe.77 Entsprechend anders fiel auch Eleys Verortung der nationalen Agitationsvereine aus. Diese seien nicht als obrigkeitliches Ablenkungsmanöver zu verstehen, sondern vielmehr als Ausdruck der Mobilisierung breiter nationalistisch denkender Kreise im Bürgertum. Sie stellten weniger ein politisches Ventil denn eine Alternative zur exklusiven Honoratiorenpolitik des Deutschen Kaiserreichs dar.78
Wegweisend war in der Folge Roger Chickerings Studie zum Alldeutschen Verband von 1984. Chickering übernahm Eleys Kritik an der Bielefelder Forschung, löste sich aber von der Idee einer Massenmobilisierung durch die Agitationsvereine. Er setzte auf einen im Kern kulturhistorischen Ansatz: So untersuchte er die politische Semantik des ADV unter den Gesichtspunkten von Sinnkonstruktion und Auswirkung auf dessen Mitglieder.79
Folgte Axel Grießmer 2000 in seiner Studie über die nationalen Verbände als Massenorganisationen noch deutlich den Annahmen und Schwerpunkten Eleys, indem er die Verbände als Pioniere der neu entstehenden Massenpolitik verstand, so sind die Studien der jüngeren Vergangenheit methodisch deutlich näher bei Chickering angesiedelt.80
Rainer Hering untersuchte die politische Semantik des ADV und seiner Hamburger Ortsgruppe vor dem Hintergrund der Theoreme Benedict Andersons zur Konstruktion der Nation als „Imagined Community“.81 Peter Walkenhorst analysierte 2007 zentrale Inhalte des radikalen Nationalismus in Deutschland, wobei er ebenfalls kulturhistorische Methoden anwandte und sich zugleich von der engen Konzentration auf einzelne Organisationen löste.82 Sebastian Diziol behandelte in seiner zweibändigen Dissertation das Wirken des Deutschen Flottenvereins, wobei er seine Studie explizit der Kulturgeschichte des Politischen zuordnete und die politische Semantik und Sinnstiftung des DFV anhand von dessen publizistischem Werk analysierte.83 Zudem sind in den letzten Jahren eine Reihe von biografischen Untersuchungen über Aktive der nationalen Verbände wie auch Studien über Einzelaspekte im Wirken dieser Gruppen erschienen, die methodisch ebenfalls überwiegend der kulturhistorisch arbeitenden neuen Politikgeschichte zuzuordnen sind.84
In den genannten Forschungsarbeiten dominieren eindeutig Untersuchungen zu ADV und DFV. Während die Deutsche Kolonialgesellschaft und der Deutsche Wehrverein beispielsweise durch Eley und Grießmer mit bearbeitet wurden, sind sie insgesamt weit weniger gut erforscht. Eine erste monografische Untersuchung zum DWV veröffentlichte Marilyn Shevin-Coetzee 1990 in englischer Sprache.85 Als monografische Grundlagenschrift zur Deutschen Kolonialgesellschaft existiert lediglich Imre Josef Demhardts 2002 im Selbstverlag veröffentlichte Magisterarbeit.86
Neben den nationalen Agitationsvereinen ist auch die Völkische Bewegung87 auf übergeordneter Ebene vergleichsweise gut erforscht. Zu nennen ist hier vorrangig die langjährige Forschungsarbeit Uwe Puschners und seines akademischen Umfeldes. Nach seiner Habilitationsschrift über die Völkische Bewegung von 2001 haben Puschner und Kolleg:innen unzählige Einzelschriften zu Gruppierungen und Akteuren dieses politischen Spektrums wie auch zur Definition des Völkischen veröffentlicht und damit im deutschen Sprachraum weitestgehende Deutungshoheit gewonnen. Puschner verstand die Völkische Bewegung in einer engen Begriffsdefinition als Feld von heterogenen Gruppen mit teilweise divergierenden Ansichten, die aber durch einige zentrale ideologische Eckpunkte, wie z.B. einen rassenideologischen, antisemitischen Volksbegriff, verbunden gewesen seien.88 Während Puschners Überlegungen zur Völkischen Bewegung bis in die Gegenwart zur Grundlage einer Vielzahl weiterer Forschungen geworden sind, bot Stefan Breuer 2008 einen alternativen Zugang zur Völkischen Bewegung. Er näherte sich dieser sozialpsychologisch an und verstand sie als bürgerlichen Reflex auf die Phänomene der Moderne. Während Breuer so durchaus gewinnbringend die psychosozialen Hintergründe der Entstehung der Völkischen Bewegung zu beleuchten vermochte, verfehlte er in der ideologischen Definition und Eingrenzung des Völkischen jene Trennschärfe, die Puschners enge, inhaltliche Definition des Völkischen fordert.89
Die in Nordwestdeutschland prominente Heimatschutzbewegung, die auch in dieser Untersuchung berücksichtigt wird, ist in einer Reihe von Monografien und Artikeln erforscht worden. Besonders hervorgehoben wurden dabei das zivilisations- und urbanitätskritische Moment der Bewegung wie auch ihre ideologische Nähe zu völkischen Theoremen.90
Weniger umfangreich bearbeitet wurde das für diese Studie ebenfalls relevante Kriegervereinswesen im Deutschen Kaiserreich und den Jahren der Weimarer Republik. Thomas Rohkrämer erforschte hier 1990 Wegweisendes, indem er die politischen Sinnstiftungsangebote der deutschen Kriegervereine des Kaiserreichs analysierte und diese als „Militarismus der ‚kleinen Leute‘“ verstand.91 Auf seine umfassende Studie folgten kaum weitere übergreifende Forschungsarbeiten, durchaus aber Regionalstudien. Thematisch einschlägig ist hier Ludwig Arndts Monografie über Militärvereine in Norddeutschland von 2008. Arndt forciert vor allem die Dokumentation von Uniformen und Abzeichen. Seine Studie ist von heimatkundlich-dokumentarischem Charakter, liefert aber einige wichtige ereignishistorische Erkenntnisse für den Untersuchungszeitraum und die untersuchte Region.92 Neue Ergebnisse bringt Benjamin Schultes jüngst erschienene Studie über den Kyffhäuserbund in der Weimarer Republik. Indem er sich auf diese bislang nicht untersuchte Phase des Dachverbandes der deutschen Kriegervereine konzentriert, ist er in der Lage, dessen Bedeutungsverlust als semantischer Bezugspunkt und seine Versuche, mit der neuen politischen Lage und dem verlorenen Ersten Weltkrieg umzugehen, nachzuzeichnen.93
Neben den hier bezeichneten Forschungspositionen zu größeren Zusammenhängen innerhalb der politischen Rechten des Deutschen Kaiserreichs und der Republik von Weimar, ist eine Reihe von thematisch relevanten organisationsgeschichtlichen Forschungsarbeiten über einzelne Gruppierungen der politischen Rechten erschienen. Diese sind in ihrer Untersuchung der einzelnen Vereinigungen mitunter inhaltlich isoliert, stellen aber Grundlegendes und für diese Arbeit Bedeutsames fest. So leistete Volker Berghahn bereits 1966 Grundlagenarbeit zur Geschichte des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten.94 1968 folgte Reimer Wulff mit einer fundierten organisationsgeschichtlichen Arbeit zur Deutschvölkischen Freiheitspartei.95 1970 veröffentlichte Uwe Lohalm die bis heute einzige umfassende Monografie zum Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund.96 Im Folgejahr ermittelte Gabriele Krüger wesentliche Grundlagen der Aktivitäten der Marinebrigade Ehrhardt, aus welcher die Organisation „Consul“ und der Nationalverband Deutscher Soldaten hervorgingen.97 Heinz Hagenlücke stellte in seiner wegweisenden Monografie von 1997 die Geschichte der Deutschen Vaterlandspartei umfassend dar.98
Den genannten Forschungsarbeiten ist gemein, dass sie vorrangig die reichsweiten Aktivitäten bzw. die Arbeit einzelner Personen, zumeist der überregionalen Führung verschiedener Organisationen, beleuchten. Konkrete Untersuchungen zur Aktivität der politisch rechten Gruppen in den hier zu bearbeitenden Hansestädten sind dagegen bisher nur in geringem Umfang erschienen, wie auch Grundlagenstudien zu ihrem Milieu nicht angestellt wurden. So fehlte bislang jede „übergreifende Darstellung zur Geschichte der politischen Rechten und ihrer sozialen und mentalen Verankerung in der Hansestadt“, wie Rainer Hering für Hamburg feststellt.99 Gleiches ist für die Situation in Bremen zu attestieren.
Eine kleine Zahl von Forschungsarbeiten zu einzelnen Organisationen, politischen Topoi oder Personen in der politischen Rechten der Hansestädte kann hier zumindest herangezogen werden. Dietrich Kersten untersuchte bereits 1963 die Position der Hamburger Kaufmannschaft zur Kriegszieldebatte des Ersten Weltkriegs, wobei er auch die Rolle von DFV, DKG und Alldeutschen mit einbezog.100 Thematisch eng verbunden war Ekkehard Böhms Studie von 1972 zum Zusammenhang zwischen Flottenrüstung und hansestädtischem Überseehandel. Böhms besonderes Verdienst lag darin, bereits die frühen Jahre des Deutschen Kaiserreichs ab 1879 mit einzubeziehen und so auch die Wurzeln der Flottenrüstungspläne und ihrer Rezeption in den Hansestädten umfassender zu betrachten.101 Reinhard Behrens untersuchte 1973 die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in Hamburg, wobei er treffend herausarbeitete, dass diese seit ihrer Gründung ein völkisch-radikales Profil aufwies und sich stets rechts der Reichs-DNVP positionierte.102
Verhältnismäßig gut erforscht ist der Parteiantisemitismus in Hamburg, der dort in den 1890er Jahren zeitweise eine merkliche Rolle spielte, Abgeordnete in die Bürgerschaft entsenden konnte und in Hamburg wie auch in Schleswig-Holstein auf Landesebene gut organisiert war. Kurt-Gerhard Riquarts erarbeitete 1975 die grundlegende Organisationsgeschichte der Antisemitenparteien des Kaiserreichs in Hamburg und Schleswig-Holstein.103 In ihrer mit ausführlichen Quellenzitaten reich ausgestatteten Studie über den Antisemitismus in der Hamburger Presse des Kaiserreichs thematisierte Daniela Kasischke-Wurm ebenfalls vorrangig den Parteiantisemitismus in Hamburg und dessen politisches Vermächtnis im Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und im Alldeutschen Verband.104 Rainer Hering wies 2003 in seiner hier bereits erwähnten Studie über den ADV auf dessen Tätigkeiten in Hamburg hin. In Hamburg habe sich dessen reichsweit zweitgrößte Ortsgruppe befunden, der Verband habe rege Aktivitäten entwickelt. Hering betonte, dass eine weitere Beschäftigung mit der politischen Rechten der Hansestadt dringend geboten sei.105 Sebastian Diziols zuvor erwähnte Dissertation über den DFV geht auf die Arbeit des Flottenvereins in den Küstenregionen und den Hansestädten ein, wobei er zu der Erkenntnis kam, dass die nationale Flottenbegeisterung eher in küstenfernen Regionen auf Resonanz getroffen sei, der Verband in den Hansestädten hingegen weniger Einfluss gewonnen habe.106
Für die Arbeit zum Hamburger Untersuchungsgegenstand sei noch erwähnt, dass eine Reihe von großen und einflussreichen Organisationen der politischen Rechten ihren Hauptsitz in der Stadt hatten. Neben dem Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund, dessen Forschungsgeschichte hier bereits erwähnt wurde, gilt dies insbesondere für die antisemitische Angestelltenorganisation des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes (DHV). Forschungen zur Gesamttätigkeit des DHV, so Iris Hamels Grundlagenarbeit von 1967 wie auch darauf folgende Studien, bezogen sich immer zumindest implizit auch auf die Arbeit des DHV vor Ort in Hamburg.107
Organisationsgeschichtliche Forschungen über die politische Rechte in Bremen sind kaum vorhanden. Implizit werden relevante Aspekte aber in einzelnen Arbeiten behandelt. Klaus Schwarz forschte zu den Tätigkeiten des antisemitischen Philologen Richard Rüthnick in der Zeit der Weimarer Republik und dessen Konflikten mit seinem früheren Weggefährten Richard von Hoff in der Zeit des Nationalsozialismus. Dabei benannte Schwarz erstmals die Mitgliedschaften und politischen Aktivitäten des rechten Multifunktionärs.108 Leben und Wirken Richard von Hoffs sowie dessen Aktivitäten in der Völkischen Bewegung hat der Verfasser dieser Studie in mehreren Publikationen dargelegt.109
Marcus Meyer beschäftigte sich mit der politischen Positionierung protestantischer Geistlicher in Bremen. Er analysierte die aggressive chauvinistische Rhetorik ihrer Predigten während des Ersten Weltkriegs und stellte für die Zeit der Weimarer Republik die hohe Affinität der meisten Bremer Pastoren zur DNVP fest.110 Er forschte zudem zum Verhältnis der Völkischen Bewegung zur Freimaurerei in Bremen, wobei er überraschende Verknüpfungen zwischen der politischen Rechten und den Logen aufzeigte.111
Mit Spannung zu erwarten ist die publizierte Fassung der unlängst abgeschlossenen Dissertation Henning Müllers an der Universität Hamburg. Müller setzt sich umfassend mit völkischen Gruppierungen des Elbe-Weser-Dreiecks der 1920er und frühen 1930er auseinander, wobei er auch Netzwerke der politischen Kultur und Hamburg und Bremen miteinbezieht.112
Es kann an dieser Stelle auf einzelne Studien aus der historischen Bürgertumsforschung zurückgegriffen werden. Mitunter wurden in der Forschung spezifisch hansestädtische Aspekte behandelt, wobei auch hier noch grundlegende Desiderate bestehen.113 Tobias von Elsner bearbeitete die nationalistische Festkultur in Hamburg während der wilhelminischen Ära und analysierte dabei die schrittweise Einstellung der Hanseaten auf den Reichsnationalismus.114 Analog dazu untersuchte Malte Ritter 2003 den gleichen Gegenstand für die Hansestadt Bremen.115 Andreas Schulz beschäftigte sich mit dem im deutschen Sprachraum vorherrschenden Bild des hansestädtischen Bürgertums im 19. Jahrhundert.116 Hartmut Berghoff und Roland Müller verglichen das Bremer Wirtschaftsbürgertum in transnationaler Arbeitsweise mit dem Wirtschaftsbürgertum im englischen Bristol.117 Das Selbstverständnis der Bremer Kaufmannschaft untersuchte zudem Franklin Kopitzsch anlässlich des 550-jährigen Bestehens der Handelskammer in Bremen.118 Dietmar Molthagen und Philipp Münch arbeiteten ideengeschichtlich zum Selbstverständnis des Hamburger Bürgertums im Ersten Weltkrieg.119 Gunnar Zimmermann beschäftigte sich mit bürgerlicher Erinnerungskultur am Beispiel des Vereins für Hamburgische Geschichte.120 Lu Seegers untersuchte den Begriff des Hanseatischen und dessen Nutzung in den verschiedenen politischen Systemen des 20. Jahrhunderts. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Begriff des Hanseatischen als Identifikationsmoment flexibel eingesetzt werden konnte, dass seine politische Konnotation vor dem Hintergrund des jeweiligen politischen Systems variierte.121
In der jüngeren Vergangenheit sind wiederholt Arbeiten über den Ersten Weltkrieg, die Novemberrevolution und deren Auswirkungen an Elbe und Weser erschienen. Janina Fuge thematisierte die politische Färbung der Gedenkkultur in Hamburg nach dem Ersten Weltkrieg und forcierte diesbezüglich das Spannungsfeld zwischen Hanseatentum und Reichspatriotismus.122 In diesem Zusammenhang erforschte sie zudem den Umgang mit Opfertopoi nach dem Krieg und die Rezeption des Versailler Friedensvertrages in der Elbstadt.123 Uwe Schulte-Varendorf untersuchte die Hamburger Hungerunruhen von Juni 1919 und analysierte dabei auch deren politische Vereinnahmung, unter anderem durch den Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund.124 Ein umfassender Sammelband des Museums für Hamburger Geschichte dokumentierte 2018 die Novemberrevolution an der Elbe und betonte dabei zugleich deren Auswirkungen im Bürgertum.125 Eine im gleichen Jahr erschienene Aufsatzsammlung untersuchte Weltkrieg und Revolution in Blankenese und hob insbesondere die Reaktion des dortigen Großbürgertums auf die Umwälzungen und dessen Reorganisation hervor.126
Das Bremer Universitätsprojekt Aus den Akten auf die Bühne veröffentlichte 2014 einen Band über den Ersten Weltkrieg in Bremen und erarbeitete darin auch Patriotismus und expansionistische Ideen im dortigen Bürgertum. 2018 folgte ein umfassender Band über die Novemberrevolution in Bremen, der gleichermaßen das Verhalten bürgerlicher Kreise untersuchte. Beide Bände enthalten für den hier vorliegenden Forschungsgegenstand einschlägige Artikel.127
In gleicher Weise lieferte ebenfalls 2018 ein Ausstellungsband des Bremer Focke-Museums einige neue Erkenntnisse über die Geschichte Bremens in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution. Gewinnbringend sind hier die Aufsätze über die Niederschlagung der Bremer Räterepublik, politische Kontinuitäten aus der Zeit des Kaiserreichs und in diesem Zusammenhang über den Flaggenstreit in den Weimarer Jahren.128
Es zeigt sich, dass die vorliegende Arbeit eine Reihe von Forschungssträngen aufnehmen kann, dass aber zugleich keine übergreifenden Studien zur politischen Rechten der beiden Hansestädte bestehen. So ist bislang nicht gefragt worden, welche soziale Trägerschaft Nationalismus, Expansionismus, Antisemitismus und Imperialismus in den Hansestädten hatten. Auch an übergreifenden Untersuchungen des politischen Handelns, der politischen Semantik und inhaltlicher Sinnstiftungsangebote der politischen Rechten beider Hansestädte fehlt es bislang. Die vorliegende Arbeit strebt deshalb an, die bislang erfolgten Forschungen aus Organisationsgeschichte und Bürgertumsforschung, Ideen- und Kulturgeschichte aufzunehmen und für beide Hansestädte zur übergreifenden Betrachtung des Gegenstandes heranzuziehen.
1 Orwell, George: Notes on Nationalism, London 2018, S. 4.
2 Vgl. Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London u.a. 2006 (erstmals 1983).
3 Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Erweiterte Neuausgabe, Frankfurt a. M., New York 1996, S. 15.
4 Anderson: Die Erfindung der Nation, S. 17.
5 Vgl. Wehler, Hans-Ulrich: Nationalismus, Nation und Nationalstaat in Deutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, in: Welt – Stadt – Wissenschaft. Namhafte Wissenschaftler zu Gast in Bremen. Vorträge der Wittheit in den Jahren 1926 bis 1996, Jahrbuch 1997/98 der Wittheit zu Bremen, S. 133–138, hier S. 133–134. Vgl. dazu auch Weichlein, Siegfried: Nationalismus als Theorie sozialer Ordnung, in: Mergel, Thomas; Welskopp, Thomas (Hg.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theriedebatte, München 1997, S. 171–200, hier S. 172.
6 Vgl. Hobsbawm, Eric: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt am Main, New York 1992², S. 25 sowie Gellner, Ernest: Nations and Nationalism, Ithaca NY 1983, S. 48.
7 Vgl. Lepsius, Mario Rainer: Nation und Nationalismus in Deutschland, in: Winkler, Heinrich August (Hg.): Nationalismus in der Welt von heute (Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 8), Göttingen 1982, S. 12–27, hier S. 15–24.
8 Eine kompakte Zusammenfassung der Sonderwegsdebatte findet sich bei Winkler, Heinrich August: Der lange Weg nach Westen. Erster Band. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiche bis zum Untergang der Weimarer Republik. Sechste, durchgesehene Auflage, München 2005, S. 1–3.
9 Vgl. Wehler: Nationalismus, Nation und Nationalstaat in Deutschland, S. 135–137.
10 Vgl. Weichlein, S. 180.
11 Walkenhorst, Peter: Nation – Volk – Rasse. Radikaler Nationalismus im Deutschen Kaiserreich 1890–1914 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 176), Göttingen 2007, S. 46–47.
12 Vgl. ebd., S. 43–44.
13 Ullrich, Volker: Die Nervöse Grossmacht 1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. Erweiterte Neuausgabe, Frankfurt a. M. 20142, S. 25.
14 Vgl. ebd., S. 376.
15 Vgl. Walkenhorst, S. 60 und S. 68–69.
16 Vgl. Ullrich: Die Nervöse Grossmacht, S. 379.
17 Vgl. Hering, Rainer: Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890–1939 (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Darstellungen 40), Hamburg 2003, S. 89–91.
18 Vgl. hierzu Schulz, Andreas: Weltbürger und Geldaristokraten. Hanseatisches Bürgertum im 19. Jahrhundert, in: HZ 259 (1994) 3, S. 637–670.
19 Zur Übernahme des Reichsnationalismus in den Hansestädten vgl. Elsner, Tobias von: Kaisertage. Die Hamburger und das Wilhelminische Deutschland im Spiegel öffentlicher Festkultur (Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 471), Frankfurt am Main u.a. 1991, zugl. Phil. Diss. Hamburg 1990 sowie Ritter, Malte: Die Bremer und ihr Vaterland. Deutscher Nationalismus in der Freien Hansestadt (1859–1913), Berlin 2004, zugl. Phil. Diss. Bremen 2003.
20 Vgl. Seegers, Lu: Deutungen des Hanseatischen im 20. Jahrhundert, in: Petermann, Kerstin; Rasche, Anja; Weilandt, Gerhard (Hg.): Hansische Identitäten (Coniunctiones 1), Petersberg 2018, S. 221–231, hier S. 222.
21 Die Sozialstruktur des Alldeutschen Verbandes ist kompakt zusammengefasst in Hering, Rainer: Academics and Radical Nationalism. The Pan-German League in Hamburg and the German Reich, in: Jones, Larry Eugene (Hg.): The German Right in the Weimar Republic. Studies in the History of German Conservatism, Nationalism and Antisemitism, New York u.a. 2014, S. 108–133.
22 Zur Gründungsgeschichte des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes in Hamburg vgl. Hamel, Iris: Völkischer Verband und nationale Gewerkschaft. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband 1893–1933 (Veröffentlichungen der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg 6), Frankfurt am Main 1967. Zur Gründung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes und zur Beteiligung des DHV-Mitbegründers Alfred Roth vgl. Lohalm, Uwe; Ulmer, Martin: Alfred Roth und der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund. „Schrittmacher für das Dritte Reich“, in: Schmidt, Daniel; Sturm, Michael u.a. (Hg.): Wegbereiter des Nationalsozialismus. Personen, Organisationen und Netzwerke der extremen Rechten zwischen 1918 und 1933 (Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte 19), Essen 2015, S. 21–35.
23 Eley, Geoff: Reshaping the German Right. Radical Nationalism and Political Change after Bismarck, New Haven und London 1980, S. 343.
24 Vgl. Behrens, Reinhard: Die Deutschnationalen in Hamburg 1918–1933, Phil. Diss. Hamburg 1973.
25 Erste Erkenntnisse in diesem Bereich sind zusammengefasst in Loeber, Matthias: Richard von Hoff. Der spätere NS-Bildungssenator als völkischer Ideologe, in: Bremisches Jahrbuch 96 (2017), S. 144–160 und in Schwarz, Klaus: Das zensierte Bremische Jahrbuch von 1936, in: Bremisches Jahrbuch 65 (1987), S. 107–123.
26 Vgl. hierzu den Abschnitt 1.3 zum Forschungsstand.
27 Zur relativen Stabilisierung der Weimarer Republik ab 1924 vgl. Peukert, Detlev: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne, Frankfurt am Main 1987, S. 14.
28 Vgl. hierzu Landwehr, Achim: Kulturgeschichte, in: Bösch, Frank; Danyel, Jürgen (Hg.): Zeitgeschichte – Konzepte und Methoden, Göttingen 2012, S. 313–328.
29 Vgl. Reichert, Bernhard: Handbuch Vereins- und Verbandsrecht, 12. vollständig überarbeitete Auflage, Köln 2010, S. 1081.
30 Vgl. StAH 231-10. Vereinsregister sowie StAB 4,75/7. Vereinsregister.
31 Vgl. StAH 331-3. Politische Polizei.
32 Vgl. hierzu Hering, Rainer: Das Sozialistengesetz und der Überwachungsstaat. Die Politische Polizei in Hamburg, in: Beutin, Heidi; Beutin, Wolfgang; Malterer, Holger; Mülder, Friedrich (Hg.): 125 Jahre Sozialistengesetz. Beiträge der öffentlichen wissenschaftlichen Konferenz vom 28.–30. November 2003 in Kiel (Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte 45), Frankfurt am Main u.a. 2004, S. 87–97, hier insb. S. 90–91.
33 Vgl. StAH 331-3 KV. Politische Polizei. Kriegervereine.
34 Vgl. z.B. StAH 614-2/1. Politische Vereinigungen. Deutscher Flottenverein oder 614-1/25. Kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Vereinigungen. Kameradschaftsbund der 76er zu Hamburg.
35 Vgl. z.B. StAH 622-1/65. Familienarchiv Lorenz-Meyer, StAH 622-1/239. Familienarchiv Westerich, StAH 621-1/10. Firmenarchiv. L. Friedrichsen & Co. sowie StAH 621-1/72 Firmenarchiv Blohm & Voss. Das Staatsarchiv Hamburg verzeichnet das genannte Firmenarchiv in der hier verwendeten Schreibweise, während der Firmeninhaber für seinen Nachnamen offiziell die Schreibweise Friederichsen verwendete. Diese Unterscheidung wird in der vorliegenden Studie übernommen.
36 Vgl. z.B. StAH StAH 111-1 Nr. 85086. Senat. Eingabe der Vereinigten Hamburg-Altonaer Ortsgruppen des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes wegen Einführung des Fortbildungsschulzwanges für kaufmännische Gehilfen und Lehrlinge unter 18 Jahren, StAH 422-15 Nr. E c 4. Polizeibehörde Wandsbek. Deutscher Flottenverein, StAH 424-3 Nr. 705. Magistrat Altona. Schleswig-Holsteinischer Landesverein für Heimatschutz, StAH 430-4 XII C 92b. Magistrat Harburg. Bund Jungdeutschland.
37 Vgl. z.B. StAH 731-8 Nr. A 507. Zeitungsausschnittsammlung. Heimatschutz im Hamburgischen Staatsgebiet, StAH 731-8 Nr. A 767. Zeitungsausschnittsammlung. Raab, Friedrich, StAH 731-8 Nr. A 906. Zeitungsausschnittsammlung. Deutsche Kolonialgesellschaft.
38 So ist beispielsweise über den Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, nur in wenigen Vorgängen etwas zu erfahren, z.B. StAH 111-1 Nr. 30697. Senat. Überfälle auf Mitglieder des „Jung-Stahlhelm“ in Bergedorf.
39 So hat der Bestand StAB 3-V.2 Nr. 202 Senatsregistratur. Deutscher Flottenverein eine Laufzeit von der Gründung der Bremer Ortsgruppe des Vereins bis in die NS-Zeit, gleichermaßen StAB 3-V.2 Nr. 538. Senatsregistratur. Deutsche Kolonialgesellschaft. Die Unterlagen der Heimatschutzbewegung reichen dagegen vom ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er und 1960er Jahre, z.B. StAB 3-V.2 Nr. 358 Senatsregistratur. Bund Heimatschutz, sowie StAB 3-V.2 Nr. 403. Senatsregistratur. Verein für niedersächsisches Volkstum.
40 Vgl. z.B. StAB 3-V.2 Nr. 202 Senatsregistratur. Deutscher Flottenverein, StAB 3-V.2 Nr. 852. Senatsregistratur. Deutscher Wehrverein, StAB 3-V.2 Nr. 1162. Senatsregistratur. Plattdütscher Vereen Bremen.
41 So in StAB 4,14/1-XII.A.2.c.19. Politische Polizei. Deutsche Kolonialgesellschaft.
Details
- Pages
- 818
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631927823
- ISBN (ePUB)
- 9783631927830
- ISBN (Hardcover)
- 9783631927816
- DOI
- 10.3726/b22424
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (March)
- Keywords
- Hansestädte Hamburg Bremen Kulturgeschichte Netzwerkforschung Regionalgeschichte Kolonialismus Imperialismus Nationalismus
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 818 S., 15 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG