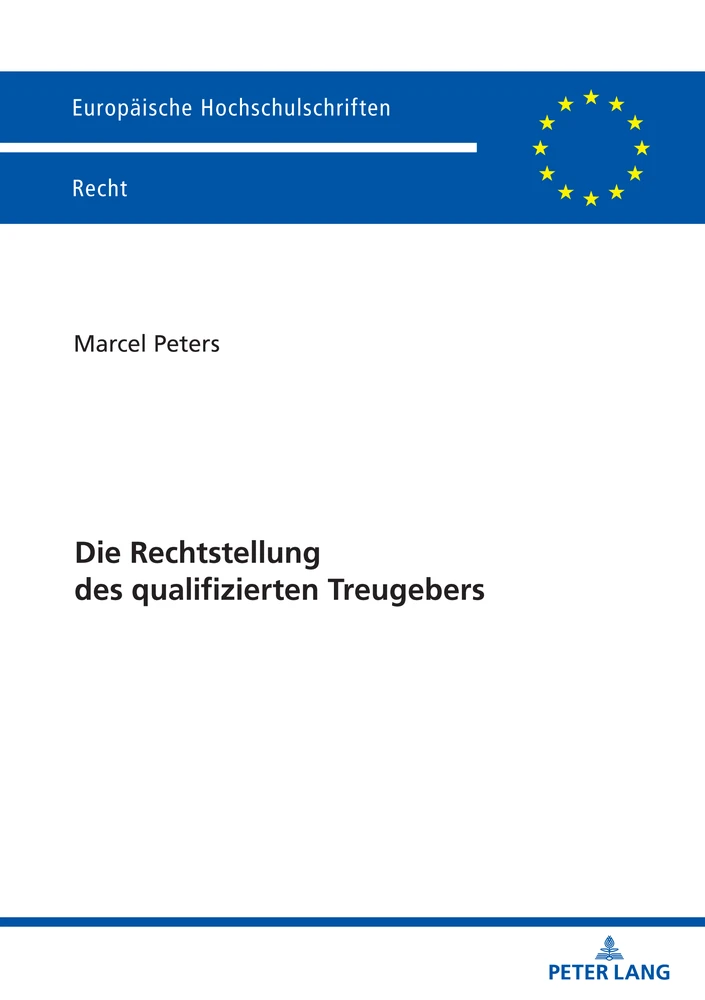Die Rechtstellung des qualifizierten Treugebers
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- § 1 Einführung und Grundlagen
- A. Untersuchungsgegenstand
- B. Die Anteilstreuhand als Form der mittelbaren Unternehmensbeteiligung im deutschen Recht
- I. Zur Treuhand im deutschen Recht
- II. Die treuhänderische Beteiligung an einer Gesellschaft
- III. Andere Formen der mittelbaren (Unternehmens-) Beteiligung
- 1. Einfache und qualifizierte stille Beteiligung
- 2. Einfache und qualifizierte Unterbeteiligung
- 3. Einfacher und qualifizierter Anteilsnießbrauch
- § 2 Die qualifizierte Treuhand in Rechtsprechung, Rechtswissenschaft, Kautelarpraxis und im KAGB – ein Überblick
- A. Zum Begriffsverständnis
- B. Kautelarpraxis
- I. Überblick über häufige Gestaltungen
- 1. Konstruktion der Beteiligung
- 2. Umfassende oder teilweise Gleichstellung
- 3. Weitere Regelungen in Gesellschafts- und Treuhandvertrag
- 4. (Keine) eigene Gesellschaft zwischen den Treugebern
- II. Motive für die qualifizierte Treuhand als Beteiligungsform
- C. Entwicklung in der Rechtsprechung und der Rechtswissenschaft
- D. Die qualifizierte Treuhand im Kapitalanlagegesetzbuch
- § 3 Dogmatische Vorüberlegungen – Die unmittelbare mittelbare Beteiligung
- A. Möglichkeiten der Einbeziehung des Treugebers in das Rechte- und Pflichtengefüge der Gesellschaft
- B. Derivative Rechtstellung
- I. Formen und allgemeine Zulässigkeit einer derivativen Berechtigung
- 1. Exkurs: Das Abspaltungsverbot als Schranke der Gestaltungsfreiheit
- a) Abspaltung als Problem der Dritteinflussnahme
- b) Einheitlichkeit der Mitgliedschaft
- 2. Dingliche Übertragung von Mitgliedschaftsrechten an den Treugeber
- 3. Einräumung einer bloßen Ausübungsbefugnis
- a) Ausübung im fremden Namen: Vertretung
- aa) Zulässigkeit der Vertretung bei der Ausübung von Mitgliedschaftsrechten
- bb) Zulässigkeit einer unwiderruflichen und verdrängenden Vollmacht
- b) Ausübung im eigenen Namen: Ermächtigung und Legitimationszession
- 4. Bestellung eines beschränkt dinglichen Rechts
- II. Derivative Berechtigung einer Vielzahl von Treugebern
- III. Derivative Pflichtenstellung
- C. Originäre Rechtstellung
- I. Treugeber als Mitglied eines (virtuellen) Innenverbands?
- II. Die Beteiligung des qualifizierten Treugebers am gesellschaftsrechtlichen Innenverhältnis als Verbandsmitgliedschaft eigener Art
- 1. Die gesellschaftsrechtliche Qualifikation der Treugeberrechtstellung
- 2. Die Verbandsmitgliedschaft eigener Art des Treugebers
- a) Zuordnung von Rechten und Pflichten als Gestaltung des gesellschaftsrechtlichen Innenverhältnis
- b) Begründung der Verbandszugehörigkeit
- c) Abhängigkeit von mittelbarer und unmittelbarer Beteiligung – die unmittelbare mittelbare Beteiligung
- d) Mitgliedschaft eigener Art und die Vereinbarung mit dem Rechtsform- und gesellschaftsrechtlichen Typenzwang
- 3. EXKURS: Die Verbandsmitgliedschaft eigener Art des Anteilsnießbrauchers
- a) Ausgangslage: Wenige Vorgaben des Sachenrechts
- b) Gesellschaftsrechtliche Begründung sonstiger Rechte des Nießbrauchers
- c) Folgerungen dieses Verständnisses für den Nießbrauch
- D. Zwischenergebnis
- § 4 Fragen zur Begründung der qualifizierten Treugeberbeteiligung
- A. Formelle Anforderungen an die Begründung der qualifizierten Treugeberbeteiligung
- I. Organisationsrechtliche Gestaltung im Statut der Gesellschaft
- II. Beitritt des Treugebers
- III. Publizitätserfordernisse / Registereintragungen
- B. Der Minderjährige als qualifizierter Treugeber
- C. Anwendung der Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft
- I. (Keine) Anwendung auf die einfache Anteilstreuhand
- II. Qualifizierte Treuhand
- D. Klauselkontrolle
- § 5 Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht bei der qualifizierten Treuhand
- A. Herleitung und Geltungsgrund der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht
- B. Treuepflichtbindung von qualifizierten Treugebern
- I. Treuepflicht bei originärer Rechtstellung
- II. Treuepflicht bei derivativer Rechtstellung
- 1. Lösungen über das allgemeine Zivilrecht
- 2. Eigene Treupflichtbindung des derivativ berechtigten Treugebers
- C. Einzelne Anwendungsbereiche
- I. Verschwiegenheitspflicht
- II. Geschäftschancenlehre / Wettbewerbsverbot
- III. Sanieren oder Ausscheiden
- IV. Spezielle Sachverhalte durch die Treuhandbeteiligung
- § 6 Unmittelbare Teilhabe an der Willensbildung, Leitung und Vertretung des Verbandes
- A. Teilnahme an der Gesellschafterversammlung
- B. Stimm- und Zustimmungsrechte
- I. Stimmrecht aus § 152 Abs. 1 Satz 3 KAGB
- II. Originäres oder derivatives Stimmrecht?
- III. Grenzen der Stimmrechtseinräumung
- 1. Kernbereichsschutz des Treuhänders und Belastungsverbot
- 2. Begrenzung durch das Prinzip der Selbstorganschaft?
- IV. Zustimmungsrechte
- 1. Fakultative Einräumung von Zustimmungsrechten
- 2. Obligatorische Zustimmungsvorbehalte
- V. Stimmverbote
- C. Beschlussmängelklagen
- I. Allgemeine Feststellungsklage
- II. Anfechtungs- und gesellschaftsrechtliche Nichtigkeitsfeststellungsklage
- D. Organschaftliche Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis
- I. Kapitalgesellschaft
- II. Personengesellschaft
- 1. Geschäftsführung (Innenverhältnis)
- 2. Vertretung (Außenverhältnis)
- E. Informationsrechte
- I. Allgemein
- II. Auskunftsanspruch bezüglich der Identität der Mitbeteiligten
- 1. Grundlage des Auskunftsanspruches
- 2. Übertragung auf qualifizierte Treuhandgestaltungen
- 3. Darlegung eines konkreten Informationsinteresses?
- 4. Abdingbarkeit und Recht auf Anonymität?
- 5. Passivlegitimation
- 6. Grenzen des Auskunftsrechts
- 7. Datenschutzrechtliche Zulässigkeit
- § 7 Haftung des qualifizierten Treugebers
- A. Mittelbare Haftung
- I. Bestehen eines Freistellungsanspruches im Treuhandverhältnis
- II. Erfasste Verbindlichkeiten
- 1. Allgemein
- 2. Verlustausgleichsansprüche und Haftung für Altverbindlichkeiten
- a) Nach- und Verlustausgleichshaftung nach allgemeinen Regeln
- b) Nach- und Verlustausgleichshaftung in der Investment-KG
- III. Abtretbarkeit und Pfändbarkeit des Freistellungsanspruches
- IV. Verjährung
- V. „Schwächen“ der mittelbaren Haftung
- 1. Subsidiarität
- 2. Keine Ausfallhaftung für Mittreugeber
- 3. Durchsetzungshindernisse bei Störungen im Treuhandverhältnis
- a) Kein genereller Einwendungsverzicht des qualifizierten Treugebers
- b) Keine Durchsetzungshindernisse bei fehlerhafter Beteiligung
- B. Unmittelbare Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern
- I. Meinungsbild in Rechtsprechung und Literatur
- 1. Akzessorische Außenhaftung analog § 721 Satz 1 BGB bzw. § 126 Satz 1 HGB
- 2. Direkte Anwendung der §§ 721 Satz 1 BGB bzw. 126 Satz 1 HGB
- 3. Subsidiäre Haftung des Treuhänders
- 4. Rechtschein- und Deliktshaftung
- II. Stellungnahme
- 1. Keine Haftung als Gesellschafter
- 2. Keine Analogie mangels Regelungslücke
- a) Treugeber als Kreditgrundlage der Gesellschaft?
- b) Keine besonderen Zurechnungsgründe aus der qualifizierten Treugeberstellung
- aa) Einräumung von Vermögensrechten
- bb) Einräumung von Verwaltungsrechten
- c) Gleichlauf von Innen- und Außenhaftung?
- d) Ausnahme für Treugeberkommanditisten?
- III. Zwischenergebnis zur Außenhaftung
- C. Unmittelbare Haftung gegenüber der Gesellschaft
- I. Vereinbarte unmittelbare Innenhaftung
- 1. Verdrängende oder doppelte Haftung?
- 2. Umfang der vereinbarten Innenhaftung
- II. Zwingende unmittelbare Innenhaftung
- 1. Personengesellschaft
- a) Grundsatz
- b) Schadenersatzpflichten
- c) Besonderheiten bei der Kapitalgesellschaft & Co. KG
- 2. Kapitalgesellschaft
- a) Gründerhaftung
- b) Kapitalaufbringung
- aa) §§ 14, 19, 24 GmbHG
- bb) Einlageverpflichtung im Aktienrecht
- cc) Vorbelastungs- und Verlustdeckungshaftung
- c) Kapitalerhaltung
- aa) §§ 30, 31 GmbHG
- (1) Verstoß gegen § 30 GmbHG
- (2) Primärverantwortlichkeit nach § 31 Abs. 1 GmbHG
- (3) Anspruchsbeschränkung, § 31 Abs. 2 GmbHG
- (4) Ausfallhaftung nach § 31 Abs. 3 GmbHG
- bb) §§ 57, 62 AktG
- d) Schadenersatzansprüche
- D. Unmittelbare Haftung gegenüber Gesellschaftern und Mittreugebern
- § 8 Insolvenz der Gesellschaft
- A. Insolvenzantragspflicht
- B. Treugeberdarlehen (Eigenkapitalersatz)
- § 9 Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literatur
§ 1 Einführung und Grundlagen
A. Untersuchungsgegenstand
Treuhandkonstruktionen sind ein in der Praxis nicht selten genutztes Instrument bei der Gestaltung gesellschaftsrechtlicher Beteiligungen.1 Die Anteilstreuhand2 als Form der mittelbaren Unternehmensbeteiligung3 findet sich überwiegend bei (geschlossenen) Publikumsgesellschaften,4 zumeist in der Rechtsform der GmbH & Co. KG5, zuweilen aber auch bei der OHG oder GbR,6 seltener im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaften.
Im Zusammenhang mit Treugeberbeteiligungen häufig anzutreffende Einzweckgesellschaften dienen zumeist der rechtlichen Verselbständigung einer Investition in hochpreisige Wirtschaftsgüter7 wie Immobilien, Schiffe, Flugzeuge oder Energieanlagen. Einst vor allem als sogenannte Abschreibungsgesellschaften aus steuerrechtlichen Gründen konzipiert, erfreuen sich diese, auch nachdem der Gesetzgeber die Möglichkeit der Steuerersparnis durch Verlustzuweisung in hohem Maße eingeschränkt hat8, weiterhin einiger Beliebtheit.9 Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahre 2008 gerieten viele dieser Fonds in wirtschaftliche Schwierigkeiten. So verwundert es nicht, dass einige Jahre später Streitigkeiten im Zusammenhang mit solchen Gesellschaften vermehrt Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen waren10 und es bis heute sind. Jene Entscheidungen haben der Fortentwicklung des in Deutschland nicht explizit normierten Rechts der Treuhand an Gesellschaftsanteilen durch Rechtsprechung und Wissenschaft neuen Schub gegeben.11 Diese Arbeit soll dazu einen weiteren Beitrag leisten. Sie greift dabei die Problematiken um eine spezielle, aber weit verbreitete und vom Gesetzgeber vor einigen Jahren ausdrücklich für geschlossene Investmentkommanditgesellschaften angeordnete12 Ausgestaltung der Beteiligungstreuhand, der sogenannten qualifizierten Treuhand, heraus.
Die qualifizierte Treugeberbeteiligung ist nach hiesigem Begriffsverständnis dadurch gekennzeichnet, dass der Treugeber über seine Rechtsbeziehung zum Treuhänder hinaus unmittelbar in den Rechts- und Pflichtenkreis des Verbandsverhältnisses einbezogen wird.13 Durch entsprechende Vertragsgestaltungen, im Falle der treuhänderischen Investmentkommanditbeteiligung durch gesetzliche Anordnung,14 wird der grundsätzlich geltende Trennungsgrundsatz15, das heißt die Trennung von Treuhand- und Gesellschaftsverhältnis, wenigstens aufgeweicht. Ausgehend von der Frage, welche rechtskonstruktiven Möglichkeiten für jene Einbeziehung in das Verbandsverhältnis bestehen – eine Art allgemeiner Teil dieser Arbeit – soll anschließend untersucht werden, inwiefern eine Annäherung der Rechtstellung qualifizierter Treugeber mit der eines unmittelbar beteiligten Gesellschafters zulässig oder – bei einer Gesamtbetrachtung der Gestaltung im Einzelfall – aufgrund allgemein zivilrechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Wertungen und Prinzipien gar zwingend ist. Darüber hinaus stellt sich für jede Rechts- oder Pflichtenposition die Frage, ob der Treugeber bei entsprechenden Gestaltungen den Treuhänder in seiner Position verdrängt oder ergänzt.16
B. Die Anteilstreuhand als Form der mittelbaren Unternehmensbeteiligung im deutschen Recht
I. Zur Treuhand im deutschen Recht
Die Treuhand stellt im deutschen Recht kein allgemeines Rechtsinstitut dar und es gibt weder einen gesetzlichen noch einen allgemein anerkannten Treuhandbegriff.17 Ob der Vielzahl von Gestaltungen, die bereits als treuhänderische Rechtsverhältnisse bezeichnet wurden, scheint die Treuhand einer aussagekräftigen allgemeingültigen Definition auch kaum zugänglich zu sein.18 Gleichwohl hat sich selbst der Gesetzgeber verschiedentlich des Begriffes bedient, etwa in § 847a ZPO, § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO, § 1 Abs. 2 Satz 2 RVG, § 41 Abs. 4 Nr. 3 GWB oder § 152 Abs. 1 KAGB.
Maßgeblich für dasjenige, was zumeist als Treuhandverhältnis bezeichnet wird, ist (i) das Vorhandensein eines Treugebers auf der einen, (ii) mindestens eines Treuhänders auf der anderen Seite, (iii) das den Gegenstand der Treuhand bildende Treugut, welches irgendein Vermögensgegenstand sein kann, und (iv) die Verpflichtung des Treuhänders, aufgrund der im Innenverhältnis wirkenden Treuhandabrede mit dem Treugut auf eine bestimmte Art und Weise zu verfahren.19 Überwiegend wird es als charakteristisch angesehen, dass bei einer treuhänderischen Gestaltung die dem Treuhänder im Außenverhältnis zustehende Rechtsmacht größer ist als das durch den Treuhandvertrag schuldrechtlich begrenzte „rechtliche Dürfen“.20 Die hier einzig interessierende fiduziarische Treuhand ist in Abgrenzung zu einer Vollmachts- oder Ermächtigungstreuhand zudem dadurch gekennzeichnet, dass der Treuhänder in Bezug auf das Treugut Vollrechtsinhaber wird oder bleibt.21 Je nachdem, ob das Treugut dem Treuhänder vom Treugeber übertragen, vom Treuhänder für den Treugeber originär erworben wird, oder der Treuhänder für ein ihn bereits dinglich zugeordnetes Treugut erklärt, dieses zukünftig für Rechnung des Treugebers halten zu wollen, spricht man entsprechend von Übertragungs-, Erwerbs- oder Vereinbarungstreuhand.22
Das Halten und Verwalten des Treuguts durch den Treuhänder für den Treugeber ist regelmäßig als Geschäftsbesorgung zu qualifizieren.23 Das deutsche Recht hält für rechtsgeschäftlich24 begründete Treuhandverhältnisse mit dem Auftrags- und Geschäftsbesorgungsrecht passende Normen bereit, die Anwendung finden, sofern die Vertragsparteien keine expliziten Regelungen getroffen haben.25 Dies gilt insbesondere für die bedeutsamen Ansprüche des Treugebers auf Auskunft gemäß § 666 BGB,26 auf Herausgabe des Treuguts nach Beendigung des Treuhandverhältnisses gemäß § 667 BGB,27 für den Aufwendungsersatzanspruch des Treuhänders aus § 670 BGB28 sowie für das von § 665 BGB vorausgesetzte Weisungsrecht des Treugebers29.
Wie ein eigenes Rechtsinstitut wird die Treuhand dagegen behandelt, soweit dem Treugeber wegen des ihm wirtschaftlich zuzuordnenden Treuguts im Falle der Insolvenz des Treuhänders ein Aussonderungsrecht30 eingeräumt, oder ihm bei einer Einzelzwangsvollstreckung gegen den Treuhänder in das Treugut ein Interventionsrecht31 zugestanden wird.
II. Die treuhänderische Beteiligung an einer Gesellschaft
Bei der Anteilstreuhand besteht das Treugut in einem Gesellschaftsanteil beziehungsweise der Mitgliedschaft als Zusammenfassung aller sich aus dem Verbandsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten.32 Gegenstand der Anteilstreuhand können grundsätzlich Beteiligungen an Gesellschaften jeder Rechtsform, auch stille und Unterbeteiligungen, sein.33 Teilweise werden nicht frei übertragbare Anteile pauschal ausgenommen.34 Richtig ist jedenfalls, dass die fehlende Übertragbarkeit einer Beteiligung Auswirkungen auf die Durchführung eines Treuhandvertrages haben kann. Das liegt bei der Übertragungstreuhand aufgrund des Erfordernisses einer dinglichen Übertragung des Treuguts auf der Hand. Für die Erwerbs- und Vereinbarungstreuhand kann für die hiesige Untersuchung dahinstehen, ob eine treuhänderische, das heißt wirtschaftliche Übertragung von (rechtsgeschäftlich) vinkulierten Beteiligungen einer Zustimmung der Gesellschaft oder Gesellschafter bedarf35 und welche Rechtsfolgen sich beim Fehlen dergleichen ergeben36. Der qualifizierten Treuhand ist eine solche Zustimmung ob der hier verwendeten Definition37 immanent.38
III. Andere Formen der mittelbaren (Unternehmens-) Beteiligung
Von der Treuhand sind andere, teils gesetzlich geregelte Formen der mittelbaren Beteiligung an einem Gesellschaftsanteil zu unterscheiden:39 Die mittelbare Beteiligung an einem Gesellschaftsanteil kann auch dadurch begründet werden, dass der Anteil zum Gegenstand eines Nießbrauchs oder einer Unterbeteiligung gemacht wird. Zu differenzieren ist ferner zwischen mittelbarer Beteiligung an einem Gesellschaftsanteil und an einem Unternehmen. Handelt es sich um einen Anteil an einer unternehmenstragenden Gesellschaft, liegt mit der mittelbaren Anteilsbeteiligung zugleich eine mittelbare Unternehmensbeteiligung vor. Letztere kann jedoch auch dadurch begründet werden, dass eine Unternehmung selbst ganz oder teilweise zum Gegenstand eines Treuhandverhältnisses oder eines Nießbrauchs gemacht wird.40 Darüber hinaus stellt auch die stille Gesellschaft gemäß §§ 230 ff. HGB einen Fall der mittelbaren Unternehmensbeteiligung dar.41
Wie bei der qualifizierten Treuhand wird bisweilen auch bei der stillen Gesellschaft, dem Anteilsnießbrauch oder der Unterbeteiligung die Trennung der jeweiligen Rechtsverhältnisse durch atypische Gestaltung überwunden, der oben genannte Trennungsgrundsatz mithin durchbrochen. Man kann insgesamt von qualifizierten mittelbaren Beteiligungen sprechen.
1. Einfache und qualifizierte stille Beteiligung
Die stille Gesellschaft ist keine besondere Gesellschaftsform, sondern bezeichnet die vermögensmäßige Beteiligung an dem Handelsgewerbe eines anderen, § 230 Abs. 1 HGB. Gesellschaftsrechtlich liegt eine Innengesellschaft des bürgerlichen Rechts, genauer, eine nicht rechtsfähige Gesellschaft nach den §§ 705, 740 ff. BGB zwischen dem Beteiligten und dem Inhaber des Handelsgewerbes vor.42 Betreibt eine Gesellschaft das Handelsgewerbe, kontrahiert der stille Gesellschafter also mit der unternehmenstragenden Handelsgesellschaft selbst.43 Deshalb liegt zwar eine mittelbare Unternehmensbeteiligung vor, nicht jedoch eine mittelbare Gesellschaftsbeteiligung. Zu unterscheiden ist somit stets die nach außen auftretende Handelsgesellschaft von der zwischen dieser und dem Beteiligten geschlossenen Innengesellschaft. Auch insofern gilt grundsätzlich der oben erwähnte Trennungsgrundsatz.
Während die Rechtstellung des Stillen durch die §§ 230 ff. HGB, ergänzend durch die §§ 705, 740 ff. BGB, grundsätzlich geregelt ist, lässt die Privatautonomie Spielraum für die Gestaltung der Innenbeziehung zwischen stillem Gesellschafter und Unternehmensträger.44 Bei (jedenfalls strukturellen) Abweichungen von der gesetzlichen Ausgestaltung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Mindestmerkmale, wird gemeinhin von einer atypischen stillen Gesellschaft gesprochen.45 Im Steuerrecht sind damit vor allem solche Gestaltungen gemeint, die dem Stillen im genügenden Maße Initiativmöglichkeiten einräumen und unternehmerisches Risiko zuweisen, sodass er als Mitunternehmer i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG anzusehen ist.46
Werden dem stillen Gesellschafter Informations-, Kontroll- und Mitwirkungsrechte in der unternehmenstragenden Außengesellschaft eingeräumt, was grundsätzlich für möglich gehalten wird,47 stellen sich die gleichen Fragen wie bei der hier zu behandelnden qualifizierten Treuhand. So werden beispielsweise ebenfalls das Erfordernis und die Herleitung einer Außenhaftung48 oder, im Falle der stillen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die Anwendung der Eigenkapitalersatzregeln49 diskutiert.
2. Einfache und qualifizierte Unterbeteiligung
Im Gegensatz zur stillen Gesellschaft handelt es sich bei der Unterbeteiligung um eine Beteiligung an einem Gesellschaftsanteil, nicht an einem Handelsgeschäft.50 Plastisch ausgedrückt geht es um eine (stille) Beteiligung an der Beteiligung.51 Weil nach außen nur der Hauptbeteiligte auftritt, liegt im Verhältnis zwischen dem Haupt- und Unterbeteiligten ebenfalls eine Innen-GbR vor.52 Wegen der Vergleichbarkeit mit einer stillen Gesellschaft können neben den §§ 705, 740 ff. BGB aber auch die §§ 230 ff. HGB analog zur Anwendung kommen.53
Auch im Falle der Unterbeteiligung gilt für das Verhältnis zwischen Hauptgesellschaft und Innengesellschaft, letztere bestehend aus dem Anteilsinhaber (Hauptbeteiligter) sowie dem Unterbeteiligten, der Trennungsgrundsatz.54 Obwohl es mangels gesetzlicher Regelungen zumindest keine (gesetzes-) „typische“ Unterbeteiligung geben kann, wird in manchen Fällen von einer atypischen Unterbeteiligung gesprochen.55 So beispielsweise bereits dann, wenn der Unterbeteiligte durch schuldrechtliche Abreden wirtschaftlich wie ein unmittelbar beteiligter Gesellschafter gestellt wird.56 Gerade bei Gestaltungen dieser Art kann die Abgrenzung zur Treuhand schwierig sein.57 Maßgebliches Abgrenzungskriterium ist, ob der vermeintliche Treuhänder/Hauptbeteiligte den Gesellschaftsanteil nach außen ausschließlich im fremden Interesse und auf fremde Rechnung hält.58 In diesem Fall fehlte es an einer gemeinsamen Zweckverfolgung, sodass das Innenverhältnis nach Auftrags- statt nach Gesellschaftsrecht zu beurteilen und daher von einer treuhänderischen Beteiligung auszugehen ist.59 Gleichwohl schließen Anteilstreuhand und Unterbeteiligung nicht zwingend einander aus.60
Eine atypische Gestaltung derart, dass von einer „qualifizierten“ Unterbeteiligung gesprochen werden kann, liegt in den Fällen lediglich schuldrechtlicher Gleichstellungsabreden mangels Durchbrechung des Trennungsgrundsatzes noch nicht vor. In Anlehnung an das hiesige Begriffsverständnis61 für die qualifizierte Treuhand bedarf es der Begründung unmittelbarer Rechte und Pflichten des Unterbeteiligten in und gegenüber der Hauptgesellschaft.62 Zu denken ist etwa an die Einräumung von Geschäftsführungsrechten zugunsten des Unterbeteiligten durch den Gesellschaftsvertrag der Hauptgesellschaft oder die explizite Anordnung einer Mithaftung.63
3. Einfacher und qualifizierter Anteilsnießbrauch
Eine weitere Möglichkeit der mittelbaren Unternehmensbeteiligung ist die Bestellung eines Nießbrauchs. Die Bestellung eines Nießbrauchs am Unternehmen selbst stellt eine Art Unternehmensüberlassung auf Zeit dar, hat den Wechsel der Unternehmensträgerschaft zur Folge und ist damit nicht als mittelbare Unternehmensbeteiligung einzuordnen.64 Davon zu unterscheiden ist der Nießbrauch an einem Gesellschaftsanteil. Diese Form der mittelbaren Gesellschafts- und zumeist auch Unternehmensbeteiligung ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Der Anteilsnießbrauch wird als Nießbrauchbestellung an einem Recht i.S.v. § 1068 BGB nach heute ganz herrschender Meinung als sachen- und gesellschaftsrechtlich zulässig erachtet.65 Belastetes Recht ist in dem Fall die Mitgliedschaft.66
Steht seit der Anerkennung der Verkehrsfähigkeit eines Personengesellschaftsanteils dessen Belastung mit einem Nießbrauch jedenfalls § 1069 Abs. 2 BGB nicht mehr entgegen,67 wurde die Nießbrauchbestellung an einem Personengesellschaftsanteil als Ganzem teilweise dennoch aufgrund des in § 711a BGB normierten Abspaltungsverbots für unzulässig gehalten.68 Der Streit um die Auswirkungen des Abspaltungsverbots hat sich nunmehr auf eine andere Ebene verlagert. Auf dieser wird gefragt, welche einzelnen Rechte aus der Mitgliedschaft dem Nießbraucher zur Nutzung überlassen werden können, mithin welchen Inhalt der Anteilsnießbrauch hat oder haben kann.69
Der Vergleich zwischen dem Anteilsnießbrauch und der qualifizierten Treuhand ist deshalb besonders interessant, weil dem Nießbrauch aufgrund seiner gesetzlich vorgesehenen dinglichen Wirkung das „qualifizierende“ Element immanent ist. Die dingliche Berechtigung am Gesellschaftsanteil begründet für sich genommen schon die Einbeziehung des Nießbrauchers in den Gesellschaftsverband.70 Allein aus diesem Grund wird überwiegend angenommen, dass die wirksame Bestellung eines Anteilsnießbrauchs nicht ausschließlich vom Willen des Nießbrauchers und Anteilsinhabers abhängen könne, sondern in jedem Fall eine zumindest vorweggenommene Zustimmung der anderen Verbandsmitglieder bedürfe.71 Welche Rechtstellung der Anteilsnießbraucher im Verhältnis zum Anteilsinhaber, zu den anderen Verbandsmitgliedern, zur Gesellschaft sowie zu außenstehenden Dritten (Stichwort: Haftung im Außenverhältnis) einnimmt, ist Gegenstand kontroverser Diskussionen.72 Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Rechtstellung zumindest grundsätzlich der Gestaltung zugänglich ist – und zwar, trotz des im Sachenrecht geltenden Typenzwangs, auch über das Verhältnis zwischen dem Anteilsinhaber als Besteller und dem Nießbraucher hinaus.73 Insofern ist an späterer Stelle zu klären, ob die Annahme einer verdinglichten Rechtsposition als Folge eines Verfügungsgeschäfts zugunsten eines qualifizierten Treugebers auch im Rahmen der Treuhand die Durchbrechung des Trennungsgrundsatzes dogmatisch zu begründen vermag.74
1 Breuer, MittRhNotK 1988, 79; MüKo/Schäfer, BGB, § 705 Rn. 90.
2 Sofern in dieser Arbeit von einem (Gesellschafts-) Anteil gesprochen wird, sind damit zur Vereinfachung mitgliedschaftliche Beteiligungen an sämtlichen Verbänden, seien es Personengesellschaften oder Körperschaften, gemeint.
3 Zu dieser Klassifizierung siehe sogleich, S. 26.
4 Armbrüster, S. 37; Dogan, S. 82; Hopt/Roth, HGB, § 105 Rn. 87; Seitz, S. 72.
5 Zur Wahl dieser Rechtsform bei geschlossenen Fonds Lüdicke/Arndt/Bost/Halfpap, Geschlossene Fonds, S. 6 ff.; Dogan, S. 83 f.
6 MüKo/K. Schmidt, HGB, vor § 230 Rn. 79; MüKo/Schäfer, BGB, § 705 Rn. 90.
7 Lüdicke/Arndt/Bost/Halfpap, Geschlossene Fonds, S. 5.
8 Vgl. Brandis/Heuermann/Bode, EStG, § 15 Rn. 264; ausführlich dazu Ehmke, Steueranwalt 2006/2007, 119 (119 f.; 129 ff.).
9 Ebenso Dogan, S. 85 f.
10 So auch die Feststellung von Tebben, Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2010 (2011), 161 (162); vgl. auch Dogan, S. 25.
11 Vgl. Schäfer, Gutachten, S. 111.
12 Siehe § 152 Abs. 1 Satz 3 KAGB.
13 Zum Begriffsverständnis ausführlicher sogleich unten, § 2A, S. 33 f.
Details
- Seiten
- 302
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631926543
- ISBN (ePUB)
- 9783631926550
- ISBN (Paperback)
- 9783631926529
- DOI
- 10.3726/b22341
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Februar)
- Schlagworte
- Publikumsgesellschaften Fonds Investmentkommanditgesellschaft Anteilstreuhand Treuhand
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 302 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG