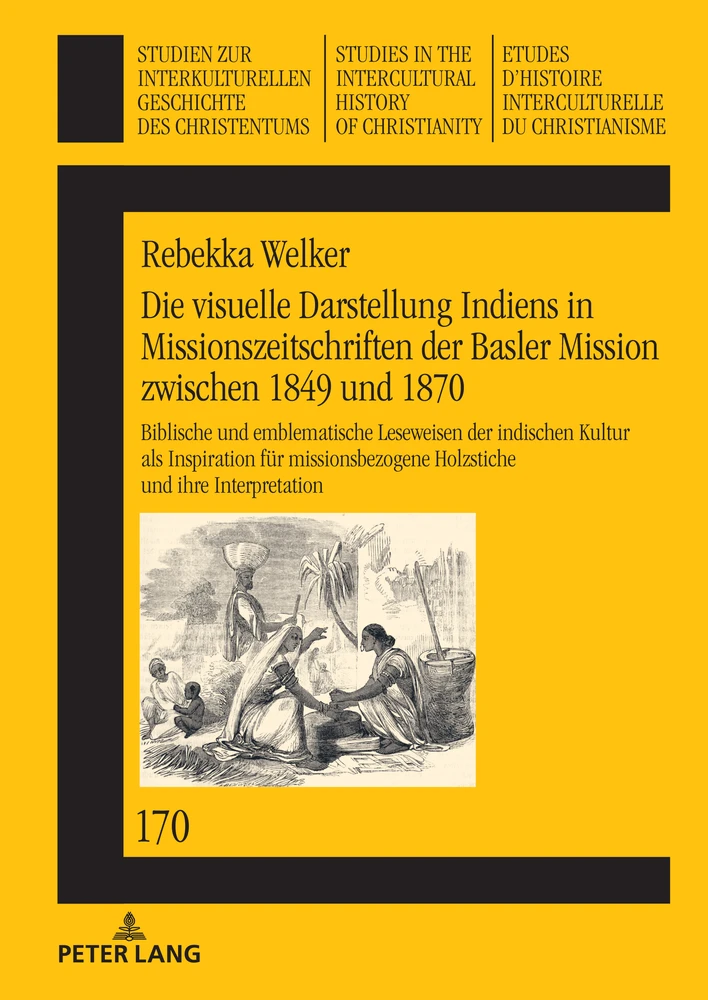Die visuelle Darstellung Indiens in Missionszeitschriften der Basler Mission zwischen 1849 und 1870:
Biblische und emblematische Leseweisen der indischen Kultur als Inspiration für missionsbezogene Holzstiche und ihre Interpretation
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1. Bibelbezogene Darstellungen Indiens
- 1.2. Das Thema der Arbeit und die Zusammenfassung des Forschungsstands
- 1.3. Ziel der Arbeit und methodisches Vorgehen
- 1.4. Die Vorstellung der Bild- und Schriftquellen
- 1.5. Gliederung der Arbeit und die Hauptfragestellung
- Kapitel 2: Kulturelle, medienspezifische und theoretische Grundlagen
- 2.1. Einführung in die Basler Mission und ihre Publikationen
- 2.1.1 Die wichtigsten Begriffe: Pietismus, Erweckungsbewegung, Evangelikalismus
- 2.1.2 Die Basler Mission im Kontext internationaler Erweckungsbewegungen
- 2.1.3 Die Verbindungen zwischen erweckten Christen in Basel, Deutschland, England und den USA
- 2.1.4 Die Charakteristika erweckter und evangelikaler Christen
- 2.1.5 Die Geschichte des Evangelischen Heidenboten und der Halbbatzenkollekte sowie die formalen Aspekte ihrer Bildphasen
- 2.2. Die Grafiker im Evangelischen Heidenboten und der Halbbatzenkollekte sowie die Technik des Holzstichs
- 2.2.1 Der Maler und Holzzeichner Joseph Austin Benwell
- 2.2.2 Der Grafiker J. Johnston
- 2.2.3 Technische Verfahren zur Erstellung von Grafiken für Missionszeitschriften
- 2.2.4 Kunsttheoretische Überlegungen zur Technik des Holzstichs
- 2.3. Theoretische Überlegungen zu Illustrationen
- 2.3.1 Die Frage nach der Gattung der Grafiken im EHB und der HBK
- 2.3.2 Die Theorie des „re-use“ und Illustrationen
- 2.3.3 Edward Saids Theorie zu Orientalismus
- 2.4. Die Strategien der Konstruktion eines Bildes von Indien im Evangelischen Heidenboten und der Halbbatzenkollekte
- 2.5. Die inhaltlichen Änderungen der Phasen im Evangelischen Heidenboten und der Halbbatzenkollekte
- 2.5.1 Die erste Bildphase des Evangelischen Heidenboten
- 2.5.2 Die zweite Bildphase des Evangelischen Heidenboten
- 2.5.3 Die dritte Bildphase des Evangelischen Heidenboten
- 2.5.4 Die inhaltlichen Charakteristika der Halbbatzenkollekte zwischen 1855 und 1870
- Kapitel 3: Das Emblem des Heidentums
- 3.1. Embleme und Sinnbilder im Evangelischen Heidenboten und in der Halbbatzenkollekte
- 3.2. Wasserbezogene Emblematik in Missionsliteratur über Indien
- 3.3. Embleme bei John Warner Barber und ihre Verbindung zur Geschichte des Emblems
- 3.4. Das Emblem des Heidentums bei Barber und das Mutter-Kindermord-Motiv
- 3.5. Die Darstellung von Grausamkeit als Ausdruck des Heidentums
- 3.6. Das Licht-Dunkelheit-Motiv bei der Darstellung des Heidentums und das Konzept des groben und feinen Heidentums
- 3.7. Fazit des 3. Kapitels
- Kapitel 4: Die Darstellungen von Götzen
- 4.1. Die Darstellung des indischen „Stierdienstes“ und seine Referenzen zum biblischen Goldenen Kalb der Israeliten in der Wüste
- 4.2. Gründe für stilistisch und ikonografisch von den Originalen abweichende Darstellungen von indischen Göttern
- 4.3. Götterbilder allein und in Interaktion mit Menschen am Beispiel der Ikonografie von Jagannātha
- 4.4. Das Niederwerfen vor Götterbildern
- 4.5. Das Niederknien vor und Berühren von Statuen sowie der Vergleich zum Katholizismus
- 4.6. Menschen als Götzen
- 4.7. Herstellungsprozess und Material von Götzen
- 4.8. Fazit des 4. Kapitels
- Kapitel 5: Indische Alltagsdarstellungen
- 5.1. Bilder des alltäglichen Lebens in Indien mit Bezug zur Alltagswelt des Lesers
- 5.2. Die Strategie der biblischen Aktualisierung durch Alltagsdarstellungen
- 5.3. Die angebliche Homogenität von Kulturen aus der Bibel und zeitgenössischen Kulturen des Ostens und ihre Auswirkung auf die Malerei und Grafik
- 5.4. Fazit des 5. Kapitels mit Blick auf das Werk Joseph Austin Benwells
- Kapitel 6: Die Ikonografien von Schlangen
- 6.1. Schlangenbeschwörer in alttestamentlichen Quellen und ihre interpretative Verbindung zur indischen Gegenwart
- 6.2. Die Dominanz der Schlange als Zeichen des Bösen
- 6.3. Die These der Universalität des Schlangenkults (Ophiolatreia) und ihre Auswirkungen auf die Interpretation indischer Schlangendarstellungen
- 6.4. Die Suche nach dem „Beweis“ des Sündenfalls in Form von erdachter und real existierender hinduistischer Ikonografie
- 6.5. Fazit des 6. Kapitels
- Kapitel 7: Die visuelle Darstellung des Erfolgs der Mission
- 7.1. Die Konversion als Zeichen des Erfolgs? – Eine visuelle Analyse
- 7.2. Die Darstellung der Predigt im heidnischen Gebiet
- 7.3. Die Darstellung des ersten Kontaktes zwischen indigenen Herrschern und Missionaren
- Exkurs: Die Darstellung des Schiffs und des Schiffbruchs
- 7.4. Das „Leben in Heiligung“: Verhalten, welches ein erweckter Christ zeigen muss
- 7.4.1 Die Integration der Bibel und des Bibellesens
- 7.4.2 Die Darstellung des Gebets
- 7.4.3 Darstellungen von indigenen Christen, die durch ihr Verhalten Zeugnis abgeben
- 7.5. Die Darstellung von eigener Architektur als Zeichen des Erfolges
- 7.5.1 So war es einst – so ist es jetzt (1. Aspekt)
- 7.5.2 Die erhöhte Position des Eigenen im Fremden (2. Aspekt)
- 7.5.3 Emblem des Hauses Gottes: die Menschen sind die Steine (3. Aspekt)
- 7.5.4 Die Nutzung der Licht-Dunkelheit-Symbolik (4. Aspekt)
- 7.5.5 Das Paradies als Architekturbeschreibung eigener Häuser (5. Aspekt)
- 7.5.6 Faktische Darstellung der Kirche bzw. des Gebäudes (6. Aspekt)
- 7.5.7 Beispiel für den emblematischen Gebrauch eines Hindutempels
- 7.6. Fazit des 7. Kapitels mit Blick auf das Werk von J. Johnston
- Kapitel 8: Fazit
- 8.1. Zusammenfassung der einzelnen Kapitel
- 8.2. Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Analysen der Strategien
- 8.3. Zusammenfassung der Motive und Motivgruppen
- 8.4. Beantwortung der Fragestellung
- Abbildungsverzeichnis
- Glossar
- Quellen und Literaturliste
Vorwort
Eigene Motivation
Die vorliegende Arbeit basiert auf der Doktorarbeit, die ich an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Fachbereich Orientalische Kunstgeschichte unter der Betreuung von Prof. Dr. Julia A. B. Hegewald im Jahre 2021 eingereicht und erfolgreich verteidigt habe. Einige Teile der Dissertation wurden im Nachhinein überarbeitet. Das Thema verbindet verschiedene Bereiche, die mich in meinem Studium der europäischen und asiatischen Kunstgeschichte sowie der Religionswissenschaft begleiteten. Einerseits war mir die christliche Ikonografie vertraut, welche mir schon als Studentin der europäischen Kunstgeschichte große Freude bereitete. Andererseits interessierte ich mich für die Ikonografie des Hinduismus und des Buddhismus in Indien und anderen asiatischen Ländern. Ich suchte immer wieder nach Verbindungen zwischen Indien und Europa, durch welche visuelle Medien entstanden, und fragte nach dem kulturellen Verständnis, welches sich in diesen Darstellungen spiegelte. Die westlichen Darstellungen von asiatischen Kulturen bildeten einen Schwerpunkt in meiner Lehrtätigkeit in der Abteilung für Asiatische und Islamische Kunstgeschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Durch diese fachlichen Interessen kristallisierte sich das Promotionsthema der vorliegenden Arbeit heraus.
Quellen, Material und Archive
Ein dreiwöchiger Forschungsaufenthalt im Archiv der Basler Mission in Basel inspirierte mich dazu, die bisher noch nicht mit kunsthistorischen Methoden analysierten Grafiken des Evangelischen Heidenboten und der Halbbatzenkollekte wissenschaftlich zu untersuchen. Andere Missionszeitschriften des 19. Jahrhunderts, die ich für diese Arbeit heranzog, sind digitalisiert und online einsehbar. Für diese Arbeit nutzte ich hauptsächlich die digitalen Datenbanken HathiTrust Digital Library, Internet Archive, Google Books sowie andere digitale Bibliotheken. Außerdem konnte ich einzelne Exemplare von wichtigem Quellenmaterial in den Curtius-Lesesaal der ULB Bonn per Fernleihe bestellen, dort vor Ort einsehen und Bilder abfotografieren.
Definitionen und Schreibweisen von Begriffen
Andere Autoren, wie z.B. Michael J. Altman, bleiben in ihrer Sprachnutzung und der Schreibweise nah am Quellenmaterial. Er schreibt z.B. „Hindoo“ anstelle von „Hindu“, weil dies die englische Schreibweise des 19. Jahrhunderts war (Altmann 2017). Ich werde in dieser Arbeit im Gegensatz dazu, die nach heutigem Stand korrekte diakritische Schreibweise für Wörter aus indischen Sprachen wählen. In den direkten Zitaten werden von den heutigen Rechtschreibregeln abweichende Schreibweisen unter Hinzufügung eines „[sic]“ zu finden sein.1 Das „[sic]“ wird auch hinter Rechtschreib- oder Grammatikfehlern in Zitaten gesetzt.
Generisches Maskulinum
Diese Arbeit nutzt das generische Maskulinum. Die Redakteure des EHB und die namentlich bekannten Grafiker waren männlich. Die Leser waren jedoch zu einem Großteil weiblich. Einzelne Autoren von missionsbezogener Literatur sind ebenfalls weiblichen Geschlechts. Weil in den hier analysierten Quellen jedoch selten ein „-innen“ hinzugefügt wurde, bleibt die Arbeit beim generischen Maskulinum im Plural.
Genutzte Abkürzungen
Da viele anonyme Quellen in dieser Arbeit genutzt wurden und nicht jede davon mit „Unbekannter Autor“ zitiert werden kann, gibt es Abkürzungen, die unter „Primärquellen ohne bekannten Autor und ihre Abkürzungen“ als erster Punkt im Kapitel „Quellen und Literatur“ aufgelistet sind.
Danksagung
Ich danke Prof. Dr. Julia A. B. Hegewald und Prof. Dr. Heinrich-Josef Klein für die Unterstützung bei dieser Arbeit. Ich danke den Mitarbeitern des Archivs der Basler Mission für ihre Hilfe und Tipps bei der Suche nach einem geeigneten Thema für die vorliegende Arbeit. Besonderer Dank gilt der Archivarin Andrea Rhyn, die mich auf die Idee brachte, nicht nur die Bilder im Evangelischen Heidenboten, sondern auch die Grafiken in der Halbbatzenkollekte wissenschaftlich zu untersuchen. Vom 6. bis 8.10.2016 erhielt ich viele Inspirationen für die vorliegende Arbeit im Rahmen des Symposiums „Menschen – Bilder – Eine Welt. Menschenbilder in Missionszeitschriften aus der Zeit des Kaiserreichs“, welches vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte und dem Institut für Mainzer Kirchengeschichte veranstaltet wurde.2 Ich bin den Herausgebern der Reihe Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums dankbar für die Aufnahme meiner Arbeit. Ebenso geht mein Dank an Paul Jenkins für ein inspirierendes Gespräch bei einem Kaffee. Ich danke im Besonderen der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft für die finanzielle Unterstützung bei dem Druck der vorliegenden Arbeit. Mein Dank gilt meinen Eltern und meinem Freund für die moralische und finanzielle Unterstützung. Für viele kleine und große Hinweise danke ich Sandra Schlange, Jahfar Shareef Pokkanali, Julia Holz, Oliver Kessler, Harald Grauer und all den Teilnehmern des Doktorandenkolloquiums. Für das Korrekturlesen danke ich Markus Schoenenborn, Herbert Schoenenborn, Hans-Dieter Reingen, Eva Becker und Alessandra Schumacher.
1 Im EHB (Evangelischen Heidenboten) und der HBK (Halbbatzenkollekte) wird z.B. das Genitiv -s- mit einem Apostroph vom Wort abgekürzt (z.B. Die Betten der Hindu’s [sic]) (EHB Februar 1862: 13).
2 Siehe unter Internetquellen Mainz (2016).
1. Kapitel: Einleitung
Evangelische Missionsgesellschaften des 19. Jahrhunderts nutzten grafische Techniken,1 um Berichte über Erfolge in Missionsgebieten zu illustrieren. Die eigenen Kolonien waren oft die bekanntesten Missionsgebiete europäischer Länder. Englands Kolonie Indien wurde im Jahre 1813 von der East India Company für englische Missionsgesellschaften geöffnet, zwanzig Jahre später auch für nicht-englische Gesellschaften. Evangelikale Christen aus englischsprachigen Ländern und erweckte Christen aus deutschsprachigen Ländern2 bildeten zusammen eine internationale Bewegung, die sich über die Mission austauschte oder sogar personell und strukturell zusammenarbeitete. Die Bilder und Geschichten in Missionszeitschriften zirkulierten daher zwischen England, Deutschland, der Schweiz und den USA.3
Die Basler Mission, gegründet 1815, schrieb in Zeitschriften über missionarische Tätigkeiten anderer Missionsgesellschaften schon seit 1816. Ab dem Jahr 1834 waren die Basler mit eigenen Missionsstationen in Indien vertreten. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Basler Mission und der Church Missionary Society sowie der auf die Verbreitung von erbaulicher Literatur spezialisierte Religious Tract Society führte dazu, dass viele Bilder und Geschichten über die Mission Indiens zwischen diesen drei Gesellschaften zirkulierten. Die Basler Mission nutzte seit 1846 Grafiken in ihrer Zeitschrift Der Evangelische Heidenbote (im Folgenden wird diese Zeitschrift mit EHB abgekürzt), um unterschiedliche Eindrücke von Menschen in den Missionsgebieten zu geben. Im Blättchen Dem Kollekte Verein für die Basler Mission, auch Heftchen für die Geber der Halbbatzenkollekte (im Folgenden wird dieses Blättchen mit HBK abgekürzt) genannt, welches ab 1855 erschien, wurde in noch größerem Umfang Bilder hinzugefügt. Diese Zeitschriften fanden eigene Wege, die fremden Kulturen4 der Missionsgebiete für ein westliches christliches Publikum darzustellen. Eine Möglichkeit, eine Brücke für den Leser zu bauen war es, die kulturellen Einzelheiten Indiens mit Elementen aus der Bibel zu vergleichen.
1.1. Bibelbezogene Darstellungen Indiens
Die Bilder in der Zeitschrift Der Evangelische Heidenbote und im Blättchen Dem Kollekte Verein für die Basler Mission zeigen im Zeitraum zwischen 1846 und 1870 Grafiken von Indien, von denen zehn im Jahre 1871 in dem Buch Rays from The East, or Illustrations of the Holy Scriptures, derived principally from the Manners, Customs, Rites, and Antiquities of Eastern Nations (RFTE) erscheinen. Dieses anonym verfasste Buch wurde von der Religious Tract Society herausgegeben und zeigt 25 Grafiken, die Menschen aus Indien, meist „Hindus“,5 die in erweckten und evangelikalen Kreisen dieser Zeit zu den „Heiden“6 gezählt werden, zeigen. Dies mag im ersten Moment verwundern, da Indien direkt nur durch den König Ahasveros (auch: Ahasteros), dessen Reich bis nach Indien reichte, im Buch Esther 1,1, erwähnt wurde. In Rays from the East werden sowohl bildlich als auch schriftlich nicht nur Indien, sondern auch 14 Darstellungen aus China7 genutzt, um Bibelsprüche zu illustrieren.
Das Vorhandensein der übrigen Bilder in diesem Buch erscheint im ersten Moment nachvollziehbarer: Das Buch zeigt altägyptische Musikinstrumente, da diese auch von den Israeliten des Alten Testaments genutzt wurden (RFTE 1871: 72). Ein Bild stellt sogar eine Zeichnung nach einer historischen Quelle dar (RFTE 1871: 73). Einzelne Bilder zeigen Illustrationen von Bibelgeschichten des Alten und Neuen Testaments.8 Wichtige Pilgerorte im Heiligen Land werden ebenfalls bildlich dargestellt (RFTE 1871: 66).
Die überwiegende Anzahl der Bilder des Buches zeigen Szenen der Völker, die geografisch in dem Gebiet leben, in dem sich die Geschichten der Bibel ereignen, um dem Leser einzelne kulturelle Aspekte der Bibel näherbringen. Dazu gehören Türken,9 Araber,10 Syrer, Armenier (RFTE 1871: 54), Ägypter (RFTE 1871: 115) und andere östliche Völker, welche, dargestellt mit ihren alltäglichen Gewohnheiten und Bräuchen, Bibelsprüche illustrieren.
Die Einleitung des Buches erläutert den Grund für die Nutzung solcher Darstellungen und Geschichten sowie für den Einsatz der Bilder, die Menschen bei Beschäftigungen in den Regionen Indiens (siehe Abb. 1) oder Chinas11 zeigen:

Abb. 1Ohne Titel (Zwei Frauen an der Mühle). In: Rays from the East. Rays from The East, or Illustrations of the Holy Scriptures. (1871), S. 31, Fotografie: Rebekka Welker.
The Holy Bible, in its structure, spirit, and details, is an Eastern book. In order fully to appreciate its descriptions, and to realize the force and beauty of its allusions, we must separate ourselves from the ordinary course of Western life, and take our place, in imagination, in the midst of Oriental scenery, and familiarize ourselves with the manners and usages of Eastern people
(RFTE 1871: vii).
Dieses Zitat zeigt, dass die Kulturen des Vorderen Orients und auch anderer Regionen Asiens zu einem gewissen Grad als homogen angesehen wurden. Der Autor sagt im weiteren Verlauf seiner Einleitung, dass die heutigen Gewohnheiten und Gebräuche im Gebiet des Bibelgeschehens ein „Faksimile“ für die Einwohner der historischen Kulturen aus der Bibel seien (RFTE 1871: vii). Dieser Ausdruck suggeriert eine enge Verbindung der als „östlich“ angesehenen Gebräuche der damaligen Gegenwart mit denen der Bibel. Diese Verbindung zwischen dem Vorderen Orient des 19. Jahrhunderts und den Menschen der Bibel wurde z.B. schon von Angelika Leitzke (2001: 22–23) beschrieben. Doch dass auch Indien zu diesem „Osten“ hinzugezählt wurde, wurde bisher in der Literatur noch nicht erwähnt oder analysiert. Das Zitat besagt, dass auch die Kultur Indiens dem Leser beim Erlernen von faktenbezogenem Bibelwissen helfen könne. Die Bilder illustrieren meist einzelne Elemente zeitgenössischer Kulturen, die in Reiseliteratur und Missionarsberichten genannt und dort oft mit dem Geschehen in der Bibel verglichen wurden. Auf diese Weise werden z.B. Statuen von heidnischen und indischen Göttern mit dem Konzept der „Götzen“ aus der Bibel gleichgesetzt.12
Ein weiteres Buch, welches dieses Konzept aufnimmt heißt The Indian Mirror. Illustration of Bible truth drawn from life in India13 (ab jetzt: The Indian Mirror oder TIM) aus dem Jahre 1878. Das Buch zeigt in 40 Kapiteln jeweils ein Bild einer Szene aus Indien, die verschiedene Verse aus dem Alten und Neuen Testament verdeutlichen sollen. Visuell werden nur indische Szenen dargestellt, während im Text weiterhin einzelne Beispiele aus verschiedenen östlichen Kulturen herangezogen werden.14 Zehn der 40 Bilder aus The Indian Mirror erschienen in Publikationen der Basler Mission 20 Jahre früher. Ein Beispiel für ein Bild in The Indian Mirror, welches auch im EHB und in RFTE erschien, ist Women grinding (Abb. 2).15
![Abb. 2J. Borders: Women grinding. In: The Indian Mirror. (1878 [2018]), S. 11.](https://cdn.openpublishing.com/images/preview-file?document_id=1490484&hash=68cec97f1d5b4ab7a681ff72b465b3b8&file=OEBPS/html/images/9783631920138_C001_Abb_002.jpg)
Abb. 2J. Borders: Women grinding. In: The Indian Mirror. (1878 [2018]), S. 11.
Reise- und Missionsberichte16 halfen dabei, die Bilder und ihre Erklärungstexte in Rays from the East, The Indian Mirror und auch im EHB und der HBK zu konstruieren. Dabei wurden besonders die Elemente aus den „östlichen“ Kulturen herausgenommen, welche mit kulturellen Einzelheiten der Bibel verbunden und verglichen werden konnten. Dieser pädagogische Ansatz ermöglichte es dem frommen17 Leser, sich vertieft mit der Bibel auf faktenbezogener historischer Ebene auseinanderzusetzen. Doch dieses Ansammeln von Faktenwissen durch die Kulturen des Ostens war kein Selbstzweck. Die Bibel galt als Quelle der religiösen Wahrheiten, auf denen der erweckte und evangelikale Leser18 sein Leben aufbauen sollte. Das faktische Bibelwissen bildete eine Grundlage für die spirituelle Interpretation der Bibel.
Durch die Verinnerlichung der Wahrheiten aus der Bibel pflegte der fromme Leser seine Beziehung zu Gott. Dieser Bestimmung konnten die Bilder von Indien in Missionszeitschriften sowie in Rays from the East und The Indian Mirror dienen. Christliche Wahrheiten wurden anhand von Bildern mit Szenen aus Indien durch eine sinnbildliche Interpretation gezeigt. Dafür wurde entweder das dargestellte Faktenwissen oder andere Elemente des Bildes genutzt. Der Begriff „Emblem“ oder „Sinnbild“ ist in diesem Kontext ein visuell-textliches Vorgehen, um eine moralische und religiöse Wahrheit auszudrücken, welche sich auf Glaubenssätzen und Weisheiten der Bibel stützt.19 Diese Arbeit untersucht diese religiöse, bibelbezogene Ikonografie Indiens in erweckten und evangelikalen christlichen Kreisen Deutschlands, der Schweiz, Englands und der USA in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
1.2. Das Thema der Arbeit und die Zusammenfassung des Forschungsstands
Die Arbeit analysiert, wie Indien visuell in Missionszeitschriften, erbaulichen Publikationen und anderer Literatur erweckter Christen im Zeitraum vom Anfang bis nach der Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt wird. Der Fokus liegt dabei auf den Bildern im EHB und der HBK zwischen 1846 und 1870, doch werden Bilder aus anderen Zeitschriften und Büchern zur Darstellung der Entwicklung von Ikonografien hinzugezogen, die in früheren und späteren Zeiten erstellt und/oder gedruckt wurden. Da in 1846 das erste Bild im EHB hinzugefügt wurde, ist dies das Anfangsdatum der vorliegenden Arbeit. Die Arbeit endet mit dem Jahre 1870 aus zwei Gründen. Erstens werden im Laufe der 1860er Jahre die Bilder im EHB immer ethnografischer, wodurch biblische und emblematische Interpretationen der Bilder abnahmen.20 Zweitens umfasst der Sammelband von Katharina Stornig und Judith Becker (2018), der u.a. einige Bilder des EHBs behandelt, Quellen die zeitlich mit dem deutschen Kaiserreich im Jahre 1871 beginnen.
Wie die einleitenden Beispiele aus Rays from the East und The Indian Mirror zeigten, wurde Indien durch die Linse der Bibel dargestellt. Dieser Ansatz führte zu eigenen Ikonografien und neuen Interpretationen, die in dieser Arbeit analysiert werden. Neben der Bibel sind es aber auch erbauliche Schriften, Reiseberichte21 und Berichte von Missionaren vor Ort in Indien, welche die Bilder und ihre beigefügten Texte in Missionszeitschriften prägten. All diese verschiedenen Quellen werden in dieser Arbeit herangezogen, um die Grafiken in Missionszeitschriften zu analysieren.
Während die kunsthistorische Sicht auf die Bilder in Missionszeitschriften ein Forschungsdesiderat darstellt und die in dieser Arbeit analysierten Bilder kunsthistorisch noch nicht oder nur an einzelnen Stellen22 analysiert wurden, gibt es missionsgeschichtliche, literaturwissenschaftliche, theologische und geschichtliche Publikationen zu dem Thema. Es folgen die für diese Arbeit wichtigsten Publikationen, welche den Forschungsstand des Themas der Arbeit zeigen.
Missionsgesellschaften und ihre Zeitschriften werden von Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen analysiert. In der Theologie wird jedoch besonders die Frage nach der interkulturellen Begegnung der Missionare in Form eines interreligiösen Dialogs gestellt (Nehring 2003: 18). Judith Beckers Arbeit Conversio im Wandel: Basler Missionare zwischen Europa und Südindien und die Ausbildung einer Kontaktreligiosität, 1834–1860 (2015) fragt nach den Konsequenzen der Begegnung zwischen Missionaren und Indern vor Ort. Für die Kulturwissenschaften hält Andreas Nehring fest, dass seit Anfang der 1980er Jahre bei der Betrachtung von Mission der Diskurs23 vorherrscht, welcher durch Edward Saids Analyse von Machtstrukturen mit Bezug auf Michel Foucault und Antonio Gramsci geprägt wurde (Nehring 2003: 18). Inwieweit Saids Theorie auf das in dieser Arbeit analysierte Quellenmaterial angewendet werden kann, wird in Unterkapitel 2.3.3 analysiert. Ein kunsthistorisches Werk, welches zwar keine Missionszeitschriften, aber benachbartes visuelles Material untersuchte, ist Much Maligned Monsters (1979) von Partha Mitter. Das Buch analysiert, wie Abbildungen von Skulpturen und Bildern indischer Götter in den Westen24 kamen, und spielt vor allem für die Analyse von Götterstatuen im 4. Kapitel eine Rolle. Dies zeigt, dass es sich bei der Aufarbeitung von Missionszeitschriften um ein interdisziplinäres Projekt handelt, bei dem die Methoden und Theorien der Kunstgeschichte bis dato noch keine große Rolle spielten.
Wichtige Quellen für die Analyse von Missionszeitschriften sind die Missionsgesellschaften selbst, welche für sie wichtige geschichtliche Grundlagen zur Mission selbst festhielten. Diese Literatur wird als Teil der Kirchengeschichte verstanden (Nehring 2003: 17). Bibelgesellschaften sind für diese Arbeit genauso bedeutend wie Missionsgesellschaften. Es wird auf Informationen aus Wilhelm Schlatters Geschichte der Basler Mission (1916) oder Sir William Jones The jubilee memorial of the Religious Tract Society (1850) zurückgegriffen. Neuere Literatur wie von der Nachfolgerin der Basler Mission namens Mission 21 wurde berücksichtigt (siehe Allemann 2015; Felber 2015; Felber & Wirthlin 2015; Lienau 2015).
Literaturlage zum Konzept des Hinduismus
Das 3. und 4. Kapitel dieser Arbeit analysiert, wie der Hinduismus25 emblematisch und motivisch in missionsbezogener Literatur dargestellt wird. Während es noch keine kunsthistorische Arbeit zur Darstellung gibt, haben Brian K. Pennington (2005), Geoffrey A. Oddie (2006) und Michael J. Altman (2017) zu dieser Fragestellung im Bereich der Geschichte bzw. Kulturwissenschaften dieses Phänomen analysiert. Die Ergebnisse dieser drei Wissenschaftler werden an einzelnen Stellen immer wieder hinzugefügt, denn sie geben wichtiges Hintergrundwissen zu einzelnen Bildanalysen dieser Arbeit. Der emblematische Charakter von Bildern des Heidentums oder ihre unterschiedlichen Ikonografien wurden jedoch bisher nicht wissenschaftlich untersucht.
Brian K. Penningtons These lautet, dass sich zwischen 1789 und 1832 ein Bild von einem Hinduismus als Weltreligion herausbildete, der neben dem Christentum, dem Islam und dem Buddhismus existierte (Pennington 2005: 3–4). Er sagt jedoch nicht, dass die Briten den Hinduismus erfunden hätten, und schließt sich damit Sumanta Banerjee an (Pennington 2005: 4–5). Er hebt hervor, dass die hinduistischen Inder agierten, auch wenn sie in einer unterlegenen Machtsituation gegenüber den Briten waren. So handelten sie jedoch selbstständig in diesem Kontext, um ihre „Religion“ Außenstehenden zu erklären (Pennington 2005: 6).26
Pennington legt in seinem Buch dar, wie durch die Church Mission Society, dem Missionar William Ward und Claudius Buchanan der Hinduismus als von Götzen, Grausamkeit und sexuellen Exzessen bestimmt angesehen wurde (2005: 94). Pennington zieht die Bilder aus den Missionary Papers und anderen missionarischen Büchern hinzu, die seine Thesen stützen.27 Eine kunsthistorische Analyse dieser Grafiken ist nicht Teil von Penningtons Arbeit. Somit ergibt sich auch nach der Lektüre dieses Buches ein Forschungsdesiderat für kunsthistorische Analysen der Bilder in Missionszeitschriften.
Geoffrey A. Oddie ist Historiker und fokussiert das koloniale Indien in vielen seiner Studien.28 In seinem Werk Imagined Hinduism. British Protestant Missionary Constructions of Hinduism, 1793–1900 (2006) zeigt Oddie sein breites Wissen von den unterschiedlichen Interpretationen eines als uniform angesehenen Hinduismus in Missionszeitschriften verschiedener Missionsgesellschaften. Er zeichnet einen Weg, wie zwischen 1789 und 1900 der Blickwinkel der protestantischen Missionare das Konzept des Hinduismus prägte, welches wiederum aus der Vorstellung des „Heidentums“ entstand (Oddie 2006: 13). Er analysiert, wie evangelikale Missionare die „Religion“29 der Inder sahen, und wie sie diese in Missionsjournalen präsentierten (Oddie 2006: 15, 17).
Oddies Buch gibt wichtiges Hintergrundwissen zu den Annahmen von evangelikalen Missionszeitschriften, welches in dieser Arbeit hinsichtlich seiner visuellen Informationen genauer untersucht wird. Der böse Charakter der „Götzen“ (Oddie 2006: 24–25), die Thematisierung von Sexualität (Oddie 2006: 26–28) und die Hervorhebung von Rationalität und Aufklärung gegenüber dem irrationalen Heidentum und somit auch dem Hinduismus (Oddie 2006: 28–30) sieht er als Gemeinsamkeit aller evangelikalen Ansichten zum Heidentum/Hinduismus. Somit weicht er leicht von Penningtons charakterisierender Triade des Hinduismus ab, die ihn als von Götzen, Grausamkeit und Sexualität geprägt beschreibt. Der erste dieser drei Aspekte spielt eine wichtige Rolle bei den hier analysierten Bildern und ihren Texten.30 Der zweite Aspekt ist im EHB und der HBK weniger wichtig und wird in Unterkapitel 3.5. analysiert. Die sexuellen Aspekte spielen jedoch aufgrund der Familienfreundlichkeit des EHB und der HBK darin keine Rolle.31 Bilder aus Missionszeitschriften unterstützen Oddies Argumentation, welche jedoch auf historischen und nicht auf kunsthistorischen Methoden beruht.32 Ein Kapitel seines Buches konzentriert sich auf die Darstellung des Hinduismus in Missionszeitschriften (2006: 204–230).
Als Ziele der Missionspublikationen nennt Oddie: (1). Menschen für den Gedanken der Mission in der Ferne zu begeistern, (2). Geld zu sammeln für die Mission, (3). Menschen für den Beruf des Missionars zu begeistern, (4). Die Leser sollten über Kultur und Religion des Missionslandes aufgeklärt werden. Hinsichtlich Indiens gab es noch ein politisches Ziel: (5). Die East India Company bzw. die englische Regierung sollte ihre tolerante Politik gegenüber dem Hinduismus in Indien ändern (Oddie 2006: 221). Diese Elemente spielen im EHB und der HBK auch eine Rolle. Die vorliegende Arbeit analysiert jedoch ein anderes, von Oddie für englisches Material nicht genanntes Ziel von Missionszeitschriften: die Erbauung des europäischen, christlichen Lesers. Edward Saids Buch Orientalism (1978) und die darauffolgende Diskussion des Konzeptes liegt auch Oddies Buch zugrunde. Eine genauere Analyse der Thesen von Edward Said und seiner Konsequenzen für diese Arbeit findet sich in Unterkapitel 2.3.3.
Neben den Werken von Pennington und Oddie ist auch Michael J. Altmans Werk Heathen, Hindoo, Hindu. American Representations of India auf historischer Ebene für die nicht visuellen Vorstellungen, die unter dem Begriff „Hinduismus“ fallen, von Bedeutung. Altman nutzt z.B. nicht das Wort „Hinduism“ wie Oddie, sondern „Hindu religion“, um die von ihm in diversen Zeitschriften gefundenen Begriffe „‘Hindoos’, ‘Gentoos’, ‘Brahmins’, ‘the Vedam’, ‘Vishnoo’, ‘Kreeshna’, ‘widow burning’ and ‘caste’“ einen Oberbegriff zu geben (Altman 2017: xi). Er untersucht in seinem Werk die Darstellung des „Hinduismus“ in US-amerikanischen Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert. Altman analysiert somit Quellen, welche die hinduistische Religion von Amerikanern für Amerikaner beschreiben. Dabei beginnt er mit Cotton Mathers Werk India Christiana von 1721 und endet mit dem World’s Parliament of Religions aus dem Jahre 1893 (Altman 2017: xi, 1).
Altmans Untersuchung fokussiert sich auf „weiße“ evangelikale Christen aus dem Nordosten der USA und wie diese die „Hindu-Religionen“ sahen (Altman 2017: xxi). Wie in Unterkapitel 2.1. gezeigt wird, gab es zwischen den erweckten Christen in Nordamerika, England und deutschsprachigen Ländern einen regen Austausch an Informationen, weshalb Altmans Erkenntnisse zum Teil auch auf europäische erweckte Christen übertragen werden können. Altman zieht, wie Pennington und Oddie, einzelne Bilder für seine Untersuchung heran. Doch sein Werk ist nicht primär kunsthistorisch.
Die Arbeiten von Hanna Acke
Der Titel des Buchs Missions and Media. The Politics of Missionary Periodicals in the Long Nineteenth Century von Felicity Jensz & Hanna Acke (2013), das auf einem Workshop aus dem Jahre 2010 aufbaut, könnte dem Leser den Anschein geben, dass darin schon ähnliche Sachverhalte diskutiert werden würden, wie in dieser Arbeit. Das Werk fokussiert sich jedoch auf die politische Dimension unterschiedlichster europäischer Missionszeitschriften im 19. Jahrhundert. In der vorliegenden Arbeit werden politische Fragestellungen nur an einzelnen Stellen hinzugezogen. Dazu gehört der politische Wille, den Hinduismus als grausam oder den Katholizismus als dem Hinduismus ähnlich darzustellen.33 Auch hinsichtlich des analysierten Materials thematisiert der Band von Jensz und Acke nicht die in dieser Arbeit analysierten Missionsgesellschaften oder Journale. Kunsthistorische Fragestellungen spielen keine Rolle. Lediglich Hanna Acke fügte zwei Bilder illustrativ ihrem Aufsatz hinzu (Acke 2013: 228–229).
Das Werk Sprachliche Legitimierung Protestantischer Mission (2015) von Hanna Acke bildet einen wichtigen Ausgangspunkt für diese Arbeit. Darin wird die pietistisch und evangelikal geprägte schwedische Missionsgesellschaft Svenska Missionsförbundet und ihre Zeitschrift Missionsförbundet analysiert. Die Beispiele von Acke erzählen von der Kongo- und der Chinamission. Acke analysiert, wie durch die Ansprache der Leserschaft von Berichten aus dem Missionsgebiet der Missionsgesellschaft Svenska Missionsförbundet zwischen den Missionaren und den „Freunden der Mission“ – damit sind die Leser und Unterstützer gemeint – zu Hause eine Verbindung oder „imagined community“ (Anderson 1991 [1983]) hergestellt werden kann. Dabei geht sie auf das Konzept der „Emotionalen Praktik“ von Monique Scheer ein (2015: 19, 186): Acke zeigt auf, wie Briefe durch die Erweckung von Emotionen eine Verbindung zwischen dem Leser und den Missionaren, Christen und auch Heiden in den Missionsgebieten schlagen sollen. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt bei den Bildern und den Interpretationen in ihren Texten im EHB und der HBK. Die für diese Arbeit formulierten Strategien umfassen verschiedene Konzepte, dank derer eine solche Brücke zwischen dem Leser und Menschen aus Indien in den hier analysierten Quellen geschlagen wird.34 Anders als Acke analysiert diese Arbeit jedoch hauptsächlich Bilder oder Bild-Text-Beziehungen.
Acke bezieht nur einzelne Drucke mit ein, die ab 1886 in der Missionszeitschrift Missionsförbundet (2015: 84–101) abgedruckt wurden. Sie sieht die Bilder als ein besonders wichtiges Werkzeug, um eine emotionale Bindung zwischen dem Leser und den Menschen in den Missionsgebieten zu gestalten. Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch diese Arbeit. Ihre Quellenanalyse zeigt jedoch auf, dass die von ihr analysierten Bilder die Augenzeugenschaft der Missionare vor Ort thematisierte (2015: 84). Da Ackes Bildbeispiele wesentlich später abgedruckt wurden als die hier besprochenen Bilder im EHB und der HBK, beruht ein Großteil dieser Grafiken auf Fotografien (2015: 65–86); einem Medium, dem die Strategie des Beweises zugesprochen wird. Ein weiterer Unterschied zu dem hier analysierten Bildmaterial beruht darauf, dass die Missionsförbundet besonders häufig Portraits abdruckte (2015: 86–87). Die größere Nutzung von auf Fotografien basierendem Material bei Ackes Analyse führte wahrscheinlich zu ihrer Interpretation, dass die Augenzeugenschaft bei den Bildern eine besonders große Rolle spielte. Dieser Aspekt wird im EHB in der dritten Bildphase bedeutender, wenn auch vermehrt Bilder, die auf Fotografien beruhen, abgedruckt werden (siehe Unterkapitel 2.5.). Ackes Ergebnisse können aber nicht direkt auf das Bildmaterial dieser Arbeit übertragen werden, weil die Grafiken, die auf Fotografien beruhen, nur am Rande in der vorliegenden Arbeit analysiert werden.
Ackes Arbeit ist für diese Arbeit wichtig, weil sie die Konstruktion einer Gemeinschaft, das Schlagen einer Brücke zwischen dem Leser und den entfernten Missionaren und Menschen aus Indien analysiert (Acke 2015: 173–222). Genauso wie bei ihrem Werk ist auch die Gemeinschaft, die durch den EHB und die HBK erschaffen wird, eine weiße westliche, bei der die Inder in den Missionsgebieten nur imaginiert teilnehmen (2015: 103). Während Acke jedoch von einer binären Einteilung der Welt in das Christentum und das Heidentum spricht, zeigt diese Arbeit auf, dass diese beiden Welten miteinander verbunden wurden.35 Außerdem sind die von Acke erarbeiteten emotionalen Praktiken nicht direkt mit denen zu vergleichen, die in dieser Arbeit als Strategien formuliert wurden.36
Der bereits erwähnte Andreas Nehring stützt seine Arbeit auf Berichte, Übersetzungen und Monographien von Leipziger Missionaren, die in englischen kolonialen Situationen zwischen 1840 und 1940 gearbeitet haben (2003: 19). Er untersucht die Begegnung zwischen den Leipziger Missionaren und den Tamilen auf religionswissenschaftlicher Ebene, wobei er für seine Analyse den Religionsvergleich mit dem Orientalismusdiskurs verbindet (2003: 22–53). Er erwähnt kurz die Darstellung in Missionszeitschriften (2003: 92–93), wobei er anmerkt, dass das Missionsblatt der Leipziger Mission vor 1844 erbaulicher Natur war, darauf seinen Charakter änderte und es mehr sachliche Informationen zur Mission gab. Eine ähnliche Beobachtung tätigt diese Arbeit auch für die Bilder zwischen 1846 und 1870 im EHB und der HBK. Anders als Nehring untersucht diese Arbeit jedoch im Detail, wie der erbauliche Charakter mit Bildern von Szenen aus Indien konstruiert wurde. Dabei stellt sie die Frage, mit welchen Strategien die Redakteure versuchten die Leser zu erbauen.
Julia Ulrike Macks Buch Menschenbilder: anthropologische Konzepte und stereotype Vorstellungen vom Menschen in der Publizistik der Basler Mission 1816–1914 analysiert auf Basis von Begriffsfeldern das Thema Menschenbilder (Mack 2013: 104). Anhand einer weiteren Publikation der Basler Mission, dem Evangelischen Missionsmagazin (EMM), zwischen 1816 und 1914 (Mack 2013: 75, 103), analysiert sie darüber hinaus die Konzepte des „Wilden“ (Mack 2013: 107–128), die Rolle der Frau (2013: 129–146), Bildung und Kultur (2013: 147–177), Sklaverei (2013: 179–200) sowie das Menschenbild im Allgemeinen (2013: 201–211). Dabei werden aber keine kunsthistorischen Methoden angewandt und auch keine Bilder in größere visuelle Zusammenhänge gesetzt. Die Arbeit nutzt die Bilder zur Untermauerung der durch Begriffsfeldanalysen (2013: 102) erarbeiteten Thesen.
In dem einleitenden Kapitel des Sammelbandes Menschen – Bilder – eine Welt: Ordnungen von Vielfalt in der religiösen Publizistik um 1900 weisen Katharina Stornig und Judith Becker darauf hin, dass man nach der Imagination des Eigenen ins Fremde und Exotische fragt (Stornig & Becker 2018: 14). Dieser Aspekt spielt in der vorliegenden Arbeit eine Rolle. Diese Arbeit analysiert das Bild-Text-Material außerdem unter folgendem Aspekt: „Die Herausgeberinnen und Herausgeber stellten die Abbildungen in bestimmte Kontexte und nutzen sie implizit und explizit als Medien oder Argumente zur Umsetzung, Erklärung, Illustration oder Legitimierung ihrer Anliegen“ (Stornig & Becker 2018: 17).37 Dieser Sammelband untersucht, wie Menschen zur Zeit des Kaiserreichs abgebildet werden und welche Muster der Repräsentation gewählt werden, um Gemeinschaft oder gesellschaftliche Ordnung auszudrücken (Stornig & Becker 2018: 19). Ein Aspekt, den Stornig und Becker hervorheben ist für die vorliegende Arbeit wichtig. Es entwickelte sich durch die Bilder aus Missionszeitschriften eine Vorstellung von Differenz der Völker zueinander, welche jedoch auf der Vorstellung der Gleichheit aller Menschen vor dem christlichen Gott beruhte (Stornig & Becker 2018: 19–20). Der Sammelband untersucht Bildmaterial ab dem deutschen Kaiserreich (ab 1871), während die vorliegende Arbeit im Kern Bilder bis zum Jahre 1870 untersucht. Festzuhalten bleibt, dass sich einige der Fragestellungen des Sammelbands mit der vorliegenden Arbeit überlappen. Einzelne Bilder des Sammelbands werden auch in dieser Arbeit analysiert. Doch geht diese Arbeit immer wieder über die Aussagen und Analysen des Sammelbandes hinaus, indem es die Bilder in Darstellungstraditionen einordnet. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf folgende zwei Aufsätze aus dem Band:
- (1). In Beckers Aufsatz „Christen, Muslime, Heiden. Die mediale Konstruktion eigener und fremder Religion im Basler Evangelischen Heidenboten und Barmer Missionsblatt“ (2018) fragt sie, wie Christen und Nicht-Christen visuell dargestellt werden und welche Vorstellung von Religion dabei mitschwingt (Becker 2018: 147). Ihrer Analyse lagen ca. 1.000 Bilder des Evangelischen Heidenboten und des Barmer Missionsblatts zugrunde, die sie thematisch als religionsbezogen einstuft (Becker 2018: 148). Wie diese Arbeit basiert Beckers Aufsatz auf Text-Bild-Analysen (Becker 2018: 148). Ein Beispiel ist das Bild mit der Mutter, die ihr Kind in den Ganges wirft, welches von Becker (2018: 152–153) bearbeitet wurde, doch in Unterkapitel 3.4. dieser Arbeit vertieft analysiert wird. Becker hebt hervor, dass das Eigene und Fremde sich gegenseitig beeinflussen und nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind (2018: 145–147). Beckers Ergebnisse ihrer Analyse zeigt u.a., dass nicht nur die Mission in Übersee, sondern auch die Evangelisation (bzw. Innere Mission) der Leser Ziel der Publikationen war (2018: 171). Der methodische Unterschied zwischen Beckers Aufsatz und der vorliegenden Arbeit liegt vor allem darin begründet, dass diese Arbeit die Bilder des EHB in Darstellungstraditionen einordnet und die Genese einzelner Motive erarbeitet, während sich Beckers Analyse auf die 1.000 Bilder der beiden Missionszeitschriften stützt. Außerdem analysiert Becker sowohl Fotografien, die als Autotypie in diesen Zeitschriften abgedruckt wurden, als auch Holzschnitte, während diese Arbeit Fotografien nur als Vorlagen für Grafiken an einzelnen Stellen heranzieht. Einen interessanten Aspekt von Beckers Analyse umfasst ihre Aussage, dass das Barmer Missionsblatt den Glauben des europäischen Unterstützerkreises stärken wollte, während der EHB in der Zeit ab 1871 eher versuchte die Vielfalt der Missionsgebiete abzudecken (2018: 162). Von 1846 bis 1870 waren die Bilder im EHB in ihrem Charakter somit denen des Barmer Missionsblattes ähnlich. Die zusätzlich in dieser Arbeit besprochenen Text-Bild-Verbindungen in der HBK fokussierten auch die Stärkung des Glaubens des Lesers.
- (2).
Kokou Azamedes Aufsatz im Sammelband Menschen – Bilder – eine Welt: Ordnungen von Vielfalt in der religiösen Publizistik um 1900 (2018: 235–256) steuert für die Analyse der oft von Missionszeitschriften gewählten Umsetzung des Motivs Kommt herüber und hilf uns! (Abb. 9) wichtige Grundlagen bei, auf dem die emblematische Analyse des Motivs im Unterkapitels 3.1. aufbaut.

Abb. 9Komm herüber und hilf uns! In: Halbbatzenkollekte. (1857, Nr. 1), S. 1.
Die bereits erwähnte Arbeit Conversio im Wandel. Basler Missionare zwischen Europa und Südindien und die Ausbildung einer Kontaktreligiosität, 1834–1860 von Becker schneidet einige Themen dieser Arbeit an, ohne Bilder des EHB und der HBK kunsthistorisch zu analysieren. Sie gibt wertvolles Hintergrundwissen zu den Einstellungen der Basler Mission und der Missionare in Indien zum Thema Konversion und Heiligung.38 Becker zieht immer wieder Vergleiche zu den Publikationen der Basler Mission. Ihre Ausführungen sind sehr wertvoll für diese Arbeit, doch wird sich zeigen, dass die hier getätigte kunsthistorische Analyse der Bilder eine neue Perspektive auf das Material zulässt.
Judith Becker analysiert in ihrer Einleitung die verschiedenen Narrative,39 die es über die Geschichte von Missionaren gibt. Becker benennt das „Said’sche Meisternarrativ“, welches sie auch als „postkoloniales Narrativ“ (2015: 20) bezeichnet. Dabei seien die Missionare „gewollte oder ungewollte Unterstützer des kolonialen Systems“ (2015: 20). Andererseits gibt es das heroische Narrativ (2015: 20–21), welches von den Missionaren selbst erstellt wurde und die Missionare als „Unterstützer der indigenen Menschen“ (2015: 20) zeigten.40 Für die hier vorliegende Arbeit spielt das heroische Narrativ eine entscheidende Rolle, da die hier untersuchte Publizistik der Basler Mission diese Erzählform in Bild und Text an den Leser übertragen wollte. Doch übernimmt die Arbeit nicht das Narrativ, sondern versucht dieses und seine Argumentationsmuster bzw. ikonografischen Strategien zu analysieren.
In der Disziplin der Kunstgeschichte können Werke genannt werden, die ähnliche Fragestellungen anhand von anderem Material analysierten. Partha Mitters Werk Much Maligned Monsters (1979) zeigt auf, wie Bilder von indischer Kunst nach Europa kamen und dort interpretiert wurden. Giebelhausens Werk Painting the Bible: Representation and Belief in Mid-Victorian Britain (2006) analysiert, wie die Bibel in Englands Malerei des 19. Jahrhunderts als inspirierende Quelle diente, und erwähnt in diesen Zusammenhang auch Kittos Pictorial Bible41 und andere evangelikale Literatur.
Die Zusammenfassung der für diese Arbeit wichtigen Literatur zeigt, dass die Bilder von Indien im EHB und der HBK bisher nur am Rande von historischen oder kulturwissenschaftlich ausgerichteten Analysen behandelt wurden. Oft bildete die Grundlage für die Bildanalysen nicht die Bilder selbst, sondern Text-Analysen, bei denen die Bilder illustrativ hinzugefügt wurden. Text-Bild-Verbindungen und kunsthistorische Analysen vom EHB und der HBK standen noch nicht im Fokus von Untersuchungen. Diese Methoden wurden bisher auch noch nicht für Bilder in anderen Missionszeitschriften genutzt. Die Zusammenfassung zeigte jedoch, dass Werke aus der Geschichte und Theologie wertvolles Hintergrundwissen zu dem hier analysierten Material bilden.
1.3. Ziel der Arbeit und methodisches Vorgehen
Wie die Zusammenfassung der wichtigsten Literatur zu dem Thema zeigt, wurden die Bilder im EHB und der HBK noch nicht unter kompositorischen, ikonografischen und bildevolutionären Fragestellungen analysiert. Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie Indien in Missionszeitschriften und missionsbezogener Literatur visuell-textlich dargestellt wird. Eine große Rolle bei dieser Analyse spielen die in Unterkapitel 2.4. dargelegten Strategien. Wie Unterkapitel 1.1. zeigt, sollen dafür vor allem biblische und emblematische Leseweisen der Grafiken in den Fokus gerückt werden. Um diese und andere Strategien zu ergründen, legt diese Arbeit die wichtigsten Motive dar, mit denen Indien dargestellt wird. Neben den Motiven, die emblematisch für das Heidentum stehen (Kapitel 3), werden religiöse Szenen (Kapitel 4 und 6), profane Alltagsdarstellungen (Kapitel 5) sowie die Darstellung des missionarischen Erfolgs (Kapitel 7) analysiert. Dafür werden die Bilder im EHB und in der HBK in dem Zeitraum von 1846 bis 1870 in den größeren Kontext von Bildern zu christlicher Erbauungsliteratur und -zeitschriften, bebilderten Bibeln und Bibelkommentaren und anderen Medien gesetzt. Dies soll einerseits die Entwicklung von Bildmotiven aufzeigen, durch welche die Bilder im EHB und der HBK besser verstanden werden können. Andererseits werden so die Beschreibungen der Grafiken in größere Diskurse eingeordnet; ein Vorgehen, durch welches die Besonderheiten des EHB und der HBK herausgearbeitet werden können.
Ein Bildmotiv ist ein Thema, welches in unterschiedlichen Bildern immer wieder leicht verändert gezeigt wird. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth nennt die Motivkunde, welche Motivketten oder Motivgruppen analysiert, eine Methode, die über Stilepochen hinweg Kontinuitäten aufzeigt. Diese Methode wurde geschaffen, um eine Legitimierung der Kunst des 19. Jahrhunderts zu erschaffen. Schmoll gen. Eisenwerth hebt für die Motivkunde hervor, dass mit ihr die Bedeutung von Kunst des 19. Jahrhunderts in Zusammenhang mit der Kunst vorheriger Jahrhunderte herausgearbeitet wird (Schmoll gen. Eisenwerth 1970: 12).42
Details
- Pages
- 682
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631920145
- ISBN (ePUB)
- 9783631925508
- ISBN (Hardcover)
- 9783631920138
- DOI
- 10.3726/b22245
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Joseph Austin Benwell biblische Leseweise der Welt Sinnbilder Embleme christliche Ikonografie evangelikale Christen erweckte Christen Grafiken Basler Mission 19. Jahrhundert Zeitschriften Missionsjournalen Missionsgebiete Hinduismus Heidentum Indien Holzschnitte
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 682 S., 6 farb. Abb., 142 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG