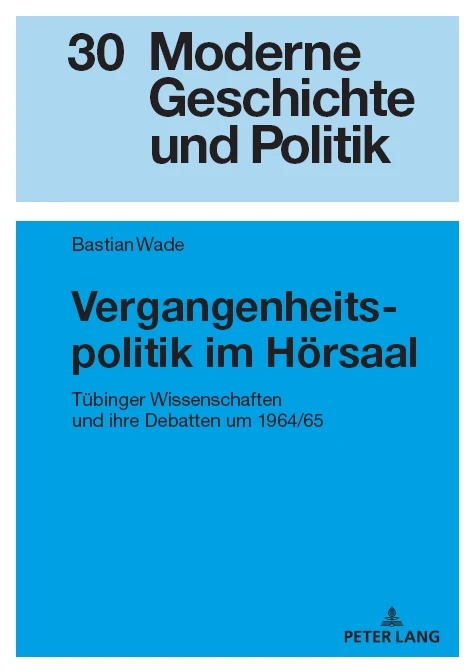Vergangenheitspolitik im Hörsaal
Tübinger Wissenschaften und ihre Debatten um 1964/65
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort und Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Abkürzungen
- Einleitung
- I. „Eine geistige Welt allein verbürgt dem Volke die Größe“ – Universitäten und Nationalsozialismus
- II. „Im Kern gesund“ – Neuanfang nach 1945?
- III. „Keine Experimente!“ – Politische Kultur zwischen Verdrängung und Verantwortung
- IV. „Deutsches Geistesleben“ und „die braune Universität“ – Tübinger Avantgardismus
- Auftakt
- Vorspiel in Tübingen
- Hermann Gremliza und die „braune Universität“
- Abwehr und Entgegenkommen
- Die Ringvorlesung „Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus“
- Lob und Tadel
- Schluss
- Archivquellen
- Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStA)
- Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg (StAL)
- Archiv der Universität Tübingen (UAT)
- Onlinepublikationen
- Periodika
- Gedruckte Quellen und Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Reihenübersicht
Verzeichnis der Abkürzungen
ADE |
Ausschuss für Deutsche Einheit |
AStA |
Allgemeiner Studentenausschuss |
BK |
Bekennende Kirche |
BNS |
Bund Nationaler Studenten |
LSD |
Liberaler Studentenbund |
NSDStB |
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund |
SDS |
Sozialistischer Deutscher Studentenbund |
SWF |
Südwestfunk |
Einleitung
Das Jahr 1964 begann im Universitäts-Dorf Tübingen mit einem Paukenschlag, der Studierende und Lehrende1 der Uni Tübingen und mit ihnen die ganze Stadt in hellen Aufruhr versetzte: In der Februarausgabe der Studierendenzeitung notizen klagte der damalige Chefredakteur Hermann Gremliza „die braune Universität“ Tübingen ob ihrer „unbewältigte[n] Vergangenheit“ an – ein Befund, den er insbesondere an der Tatsache festmachte, dass einige Professoren, die ab 1933 „sich und ihre Fähigkeiten fast bedingungslos in den Dienst des Regimes [stellten]“ und „ihre Seele für das Linsenmus der Karriere an das Regime verschacherten“2, in den 1960er Jahren noch immer in Tübingen lehren durften. Namentlich führte er dabei den Germanistikprofessor Gustav Bebermeyer und den Juraprofessor Georg Eißer an, deren Verlautbarungen während der nationalsozialistischen Herrschaft keinen Zweifel an ihrer Gesinnung ließen. Bebermeyer habe als „Beauftragter mit besonderen Vollmachten an der Universität“ aktiv die Gleichschaltung der Uni Tübingen vorangetrieben, wobei er auf keinerlei Widerstand gestoßen sei: „Der ‚Hort des abendländischen Bildungsguts‘, die deutsche Universität, […] die sich durch Generationen auf das Erbe Humboldts und des deutschen Humanismus berief, sich selbst für die geistige Elite der Nation hielt, hatte nichts Eiligeres zu tun, als sich den neuen Machthabern als Vasall anzubieten“3. Bebermeyers Bemühungen seien dann auch schnell vom Regime belohnt worden, indem er bereits 1933 zum ordentlichen Professor für das neu geschaffene Ordinariat für deutsche Volkskunde berufen wurde. Fortan habe er Lehrveranstaltungen zu Themen wie „Rasse, Volkstum, Volk“, „Deutsche Volkwerdung“ und zur „Frage der Umvolkung“ abgehalten und seine Forschungen auf die „Kernfrage“ ausgerichtet, „was […] von unserer Volkskultur arteigen geblieben, was auf dem Wege der Überfremdung durch nichtnordische Herkunft in Gesinnung und Haltung artwidrig geworden“4. Eben jener Professor, so Gremliza weiter, halte im Wintersemester 1963/1964 wieder Vorlesungen und einen Arbeitskreis für Doktoranden und Fortgeschrittene ab. Süffisant bemerkt Gremliza dazu: „So wird in Tübingen Vergangenheit bewältigt“5. Der Artikel schloss mit dem Aufruf, dass „Klärung und Abrechnung“ der Vergangenheit nottäten, da „die Bebermeyers und Eißers […] keine Einzelfälle“ seien: „Solange die Tübinger Hochschulsituation so ist, wird es anderer Mittel bedürfen, die Vergangenheit zu bewältigen, als theoretisierende Vorträge über die Geschichte des Dritten Reichs“6.
Der Verkaufserfolg der 53. Ausgabe der notizen war beispiellos. Wo die Zeitung sonst üblicherweise über Wochen unbeachtet wie Blei in den Schaukästen auslag, säumten nun Straßenverkäufer die Straßen, die die Nachfrage kaum bedienen konnten. Gremliza, der nach dem Studium erst als Journalist beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel Karriere machte, ehe er 1972 zur Zeitschrift konkret wechselte und 1974 deren Herausgeber wurde7, ist in der Rückschau auch Jahrzehnte später noch erstaunt über die erhebliche zeitgenössische Resonanz auf seinen Artikel: „Ich habe nie wieder in meiner gesamten journalistischen Laufbahn derartigen Publikumszuspruch erlebt wie da. Es war fast beängstigend!“8
Der publizistische Erfolg der Ausgabe ist dabei nicht zuletzt auch mit dem Bild auf der Titelseite zu erklären. Abgebildet war die Fotografie eines Ölgemäldes, welches Hermann Hoffmann, Professor für Psychiatrie und Rektor der Uni Tübingen von 1937 bis 1939, für die Rektorengalerie von sich anfertigen ließ – „in ordensgeschmückter SA-Uniform“, die goldene Amtskette der Tübinger Rektoren aus dem Jahr 1841 um den Hals tragend.9 Das Gemälde wurde nach 1945 im Keller eines der Hauptgebäude der Tübinger Universität vor den Augen der Öffentlichkeit versteckt. Gremliza hatte während seiner Recherchen für den Artikel einen Hinweis auf das Gemälde und seinen Verbleib erhalten, woraufhin Personen aus dem Umfeld der notizen-Redaktion unter Mithilfe des Oberpedells Rudolf Günther in die Kellerräume einstiegen und das Gemälde abfotografierten.10

Abbildung 1: Titelseite der notizen 53, Februar 1964
Titelbild und Artikel elektrisierten die schon seit den frühen 1960er Jahren politisierten Tübinger Studierenden und spaltete sie in zwei Lager – während die einen per Flugblatt „Gerechtigkeit für Prof. Eißer“ forderten, verlangten die anderen Aufklärung vonseiten der Universität: „Es geht nicht um persönliche Vorwürfe, sondern um eine institutionelle Frage, bei deren Klärung die an Amtsträger, insbesondere Professoren, anzulegenden Maßstäbe zu berücksichtigten sind“11. In der Folge kam es in Lehrveranstaltungen zu teils erregten Diskussion zwischen Studierenden und Hochschullehrern12 und noch im Februar 1964 beschloss der Allgemeine Studentenausschuss (AStA)13, gemeinsam mit der Universitätsleitung „Möglichkeiten für eine verstärkte politische Information, besonders über die nationalsozialistische Zeit, ausfindig [zu] machen. Dabei ist zunächst an die Gestaltung einer Ringvorlesung und an Veranstaltungen aus der Sicht einzelner Fächer gedacht“14. Es folgten mehrmonatige Verhandlungen zwischen Universität und AStA über eine adäquate Reaktion auf die nun im Raum stehenden Fragen, ehe der Kleine Senat in seiner Sitzung vom 4. Juni 1964 mehrheitlich für die Durchführung einer Ringvorlesung zur Rolle der Universität im Nationalsozialismus im Wintersemester 1964/1965 votierte. Zwischenzeitlich war der Theologe Hermann Diem in das Amt des Rektors eingeführt worden, der als äußerst liberal galt und von Anfang an für die rasche Durchführung einer Ringvorlesung plädierte. Als Titel der Vorlesungsreihe wurde „Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus“ gewählt und der Pädagogikprofessor Andreas Flitner mit der Organisation betraut.15 Anfang November 1964 schließlich fand der erste Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung statt, der von Rektor Diem zum Thema „Kirche und Antisemitismus“ gehalten wurde. In den Folgemonaten sprachen fachwissenschaftlich wie gesellschaftlich anerkannte Kapazitäten wie etwa Theodor Eschenburg, Hans Rothfels, Ralf Dahrendorf, Hermann Bausinger „sowie weitere Ordinarien klangvollen Namens und ungebräunter Weste“16 über die Zustände ihrer jeweiligen Fachdisziplinen, aber auch an den Universitäten selbst, vor und während des „Dritten Reichs“17. Die Ringvorlesung erhielt – im Vergleich zu früheren Veranstaltungsreihen dieser Art – eine nie dagewesene öffentliche Resonanz, was sich an hohen Besucherzahlen, Berichten in der regionalen und nationalen Presse, Leserzuschriften und Publikationsangeboten für die gehaltenen Vorträge niederschlug. Aufgrund der hohen Nachfrage entschieden sich die Vortragenden schließlich, die Redemanuskripte in Form eines Sammelbandes unter dem Titel „Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus“ zu veröffentlichen. Selbstbewusst verkündet der Klappentext des Sammelbands die Eigenwahrnehmung der Bedeutung der Ringvorlesung sowie den Anspruch der zugehörigen Publikation:
„Professoren von Rang verschiedener Fakultäten beschrieben und deuteten Aspekte des deutschen Geisteslebens in der nationalsozialistischen Zeit, suchten in kritischer Betrachtung Antworten auf Fragen, die heute drängender als je nach Verantwortung und Mitschuld der Wissenschaft gestellt werden. Die Vortragsreihe hatte ein starkes, über Deutschland hinausreichendes Echo; ihre Publikation gewinnt durch die Diskussion um die ‚braune Universität‘ große Aktualität, sie gibt einen Schlüssel zum Verständnis jener Zeitläufe, sie darf zu jenen Büchern gerechnet werden, von denen Theodor Heuss sagte, ‚dass sie helfen, die Vergangenheit zu erkennen, um die Gegenwart zu bewältigen‘.“18
Das Echo der Tübinger Ringvorlesung hallte bis nach Westberlin, Bonn, Heidelberg, Marburg, Münster und München, wo wenig später vergleichbare Vortragsreihen organisiert wurden: Die Universität München lud im Wintersemester 1965/1966 zu mehreren Vorträgen im Rahmen der Ringvorlesung „Die deutsche Universität im Dritten Reich“ ein, im Jahr 1966 stellte die Freie Universität Berlin ihre interdisziplinären Universitätstage unter den Titel „Nationalsozialismus und die deutsche Universität“ und im selben Jahr kamen Hochschulgermanisten unter der Überschrift „Nationalismus in Germanistik und Dichtung“ auf dem Deutschen Germanistentag zusammen. Viele der Redebeiträge, die ebenfalls publiziert wurden, bezogen sich auf die Tübinger Vorlesungsreihe und unterstrichen damit deren Avantgardestellung und ihre Beispielfunktion bei der Aufarbeitung der institutionellen, ideellen und personellen NS-Vergangenheit der Universitäten und der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen.19 Zeitgenössisch wurde bereits die historische Signifikanz der Tübinger Ringvorlesung für den Beginn der Auseinandersetzung bundesdeutscher Hochschulen mit ihrer jüngsten Vergangenheit betont, etwa von dem Historiker Heinrich August Winkler oder dem Philosophen Wolfgang Fritz Haug.20 „Einen Moment lang“, so konstatiert rückblickend auch der Tübinger Kulturwissenschaftler Bernd Jürgen Warneken, „erschien Tübingen als eine Hochburg der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, zumindest was die Universitätsgeschichte betrifft“21. Umso erstaunlicher ist es daher, dass die Vortragsreihe der Universität Tübingen bislang kaum Gegenstand zeithistorischer Arbeiten gewesen ist.
Dieser Umstand mag dabei auch in der Tatsache begründet liegen, dass erst etwa Mitte der 1980er Jahre an deutschen Universitäten und in den wissenschaftlichen Disziplinen ein Prozess der ernsthaften Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit während der NS-Diktatur begann, der sich vor allem im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verdichtete – ein Prozess, der erst zu diesem Zeitpunkt die nötige analytische, aber vor allem auch selbstkritische Tiefenschärfe entfaltete. Die Impulse für diese Entwicklung waren vielfältig und sowohl inner- als auch außeruniversitär bedingt. Erstens konnten sich auch die Universitäten – und insbesondere die institutionalisierte Geschichtswissenschaft – nicht mehr länger dem seit der Ausstrahlung der vierteiligen US-amerikanischen Fernsehserie „Holocaust“ 1979 gewachsenen öffentlichen Druck nach intensiverer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit entziehen. Die Rede vom „schwarzen Freitag für die Historiker“, wie der Spiegel im Nachgang der Ausstrahlung hämisch titelte, war der offene Vorwurf an die deutsche Zeitgeschichtsforschung, das „Dritte Reich“ und vor allem den Massenmord an den europäischen Juden großzügig ausgespart, höchstens aber „pflichtschuldig-lakonisch“22 konstatiert statt aufgearbeitet zu haben: „Selten ist einer Wissenschaft so drastisch bescheinigt worden, dass sie jahrzehntelang an den Interessen und Bedürfnissen der Öffentlichkeit vorbeigelebt hat“23. Vorwürfe dieser Art waren stark überzeichnet, wie etwa der Historiker Martin Broszat – seinerzeit Leiter des Instituts für Zeitgeschichte – anhand quantitativer Auswertungen von Vorlesungsverzeichnissen bundesdeutscher Universitäten aus den 1970er Jahren zeigen konnte. Auch er musste indes zugeben, dass es in qualitativer Hinsicht erheblichen Nachholbedarf gab.24 Die fortan verstärkt betriebene historische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wurde, zweitens, durch einen Generationenwechsel innerhalb der Funktionseliten erleichtert. Junge Wissenschaftler beerbten an den Universitäten die „45er-Generation“25 – jene Alterskohorte der um 1930 Geborenen, die die NS-Diktatur noch aktiv erlebte, aber 1945 jung genug war, um sich auf das politische System der Bundesrepublik einzulassen und schließlich staatstragend wurde. Die Etablierung der Demokratie und die zunehmende Liberalisierung der Gesellschaft – Errungenschaften, die maßgeblich dieser Generation zugeschrieben werden – waren indes nur um den Preis der Integration der Generation der Täter zu haben und das hieß insbesondere, eine Art „Stillhalteabkommen“26 im Sinne des „kommunikativen Beschweigens“27 mit der Vätergeneration zu schließen. Die nun nachrückende Generation konnte sich dagegen sehr viel unbefangener jenen Fragen widmen, welchen die „45er“ noch großzügig auswichen. Fragen zur Geschichte von Universitäten wurden nun außerdem häufiger gestellt, weil sich – drittens – in den 1980er Jahren Gründungsjubiläen altehrwürdiger bundesdeutscher Hochschulen häuften, anlässlich derer auch die Zeit zwischen 1933 und 1945 nicht länger ausgespart werden konnte.28 Auch hier machte die Universität Tübingen im Zuge ihres 500-jährigen Jubiläums 1977 den Anfang, wie zu einem späteren Zeitpunkt noch zu sehen sein wird. Viertens brachte die Wiedervereinigung und die damit verbundene Verschmelzung der ost- und westdeutschen Bildungssysteme wenigstens punktuell Schwung in die universitätshistorische Forschung, insbesondere in vergleichende Ansätze.29 Den wohl größten Anstoß für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit deutscher Universitäten im ausgehenden 20. Jahrhundert lieferte aber, fünftens, der Skandal um Hans Schwerte, dem ehemaligen Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Schwerte offenbarte seiner ehemaligen Wirkungsstätte siebzehn Jahre nach seiner Emeritierung im Jahr 1995, er habe seit Ende des Zweiten Weltkriegs unter falschem Namen gelebt und seine Tätigkeit im Nationalsozialismus verschwiegen. Wie sich nun herausstellte, war der Germanistikprofessor Schwerte bis 1945 unter dem Namen Hans Ernst Schneider bekannt, ein hochrangiger SS-Funktionär und ab 1943 Leiter des „Germanistischen Wissenschaftseinsatzes“, einer Abteilung des SS-„Ahnenerbes“, die unter anderem für die organisatorische Abwicklung von Versuchen an Menschen im Dachauer Konzentrationslager verantwortlich war. Schneider schrieb sich 1946 unter Ausnutzung der Nachkriegswirren unter dem Namen Hans Schwerte an der Universität Hamburg ein und schlug fortan eine beachtliche akademische Laufbahn ein, die ihm sogar das Bundesverdienstkreuz einbrachte. Schwerte sah sich schließlich gezwungen, einer Aufdeckung seiner wahren Identität zuvorzukommen und erstattete Selbstanzeige. Der Fall Schneider/Schwerte sorgte weit über Aachen hinaus für Entsetzen und Diskussionen, nicht zuletzt deshalb, weil er wie unter einem Brennglas die nach wie vor unzureichende Auseinandersetzung der deutschen Universitäten mit ihrer NS-Vergangenheit und der ihrer Angehörigen deutlich machte – denn es bestand kein Zweifel daran, dass Schwertes Doppelidentität in gewissen Kreisen bekannt war und er sein Geheimnis nur deshalb so lange für sich behalten konnte, weil er gedeckt wurde.30 Das Ereignis setzte einen Institutionalisierungsprozess der Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte als legitime geschichtswissenschaftliche Teildisziplinen in Gang, die sich nun mit Nachdruck der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit verschrieben.31 Dieser Prozess wurde schließlich noch flankiert durch heftige Debatten um die Rolle deutscher Historiker im Nationalsozialismus im Zuge des 42. Historikertags in Frankfurt am Main im Jahr 1998.32 Es folgten vor allem im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine Reihe von Forschungsprojekten, Tagungen, Kongressen und Publikationen, die sich diesem Themenfeld widmeten und in beachtlichem Umfang Wissen über die Rolle der Universitäten und der Wissenschaften im „Dritten Reich“ generierten. Immer wieder rekurrierte dabei neben den Zeitgenossen auch die Forschung auf die Tübinger Ringvorlesung „Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus“ als ein erstes, wegweisendes Aufbruchsmoment.33
Indes widmete sich bislang einzig der Historiker Karl Christian Lammers in einem Sammelbandbeitrag der Tübinger Ereignisse der frühen 1960er Jahre.34 Nicht zuletzt den Limitationen des Formats wird es dabei geschuldet gewesen sein, dass Lammers’ Aufsatz in weiten Teilen nicht über eine oberflächliche Darstellung der Ereignisse hinausgeht und eine tiefergehende Analyse des politisch-gesellschaftlichen Klimas als Entstehungskontext der Ringvorlesung ebenso vermissen lässt wie die Herausarbeitung der lokalspezifischen Konstellationen. Vereinfacht gesagt, bleibt Lammers Antworten auf die Fragen schuldig, warum ausgerechnet in den frühen 1960er Jahren, warum ausgerechnet in Tübingen und warum auf diese Weise es zu dieser vergangenheitspolitischen Eruption kam, die – ausgehend von den Tübinger Hörsälen – ein kurzlebiges, aber intensives Strohfeuer entfachte, das in der gesamten Bundesrepublik Spuren hinterließ. Diese Forschungslücke zu schließen ist erklärtes Ziel der vorliegenden Arbeit.
In den folgenden vier Kapiteln werden Genese und Durchführung der Ringvorlesung „Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus“ rekonstruiert und neben dem lokalen auch in den größeren, bundesdeutschen soziopolitischen Kontext eingeordnet und vor diesem Hintergrund analysiert. Als Basis der Untersuchung dienen dabei zeitgenössische Publikationen wie etwa die im Rahmen der Ringvorlesung gehaltenen Vorträge, aber auch Medienberichte und nicht zuletzt die Veröffentlichungen in der Tübinger Studierendenzeitung notizen. Ferner geben die im Tübinger Universitätsarchiv verwahrten Schriftwechsel und Sitzungsprotokolle zum Gremliza-Artikel aus dem Jahr 1964 Einblick in den genauen Hergang der Ereignisse, die schließlich in der Durchführung der Ringvorlesung gipfelten. Ergänzt wird die Rekonstruktion und Bewertung schließlich um persönliche Erinnerungen von drei Zeitzeugen, mit denen der Verfasser Interviews führen konnte.
Zentral für die vorliegende Untersuchung sind dabei die oben aufgeworfenen Forschungsfragen: Warum jetzt, warum hier und warum in Form einer Ringvorlesung? Die zentralen Thesen dieser Arbeit, die insbesondere im dritten und vierten Kapitel ausgeführt werden, lauten dabei, dass das Klima des „kommunikativen Beschweigens“35 und der oben angedeutete Generationenpakt auch an den Universitäten in den langen fünfziger Jahren36 kaum kritische Fragen aufkommen ließen. Diese lärmende Stille wurde dann 1964 in Tübingen von den Vorgängen rund um die Ringvorlesung durchbrochen, wofür es sowohl gesamtgesellschaftliche als auch lokale Gründe gab. Zum einen hatte der sogenannte Auschwitz-Prozess, der ab Dezember 1963 in Frankfurt gegen Teile des ehemaligen Personals des KZ Auschwitz geführt wurde, der Öffentlichkeit durch eine breite Medienberichterstattung auf beispiellose Weise die in Auschwitz begangenen Verbrechen drastisch vor Augen geführt und eine Konfrontation der Deutschen mit der NS-Vergangenheit erzwungen. Der Prozess führte dabei nicht zuletzt auch zu einer gesellschaftlichen Frontenbildung zwischen jenen, die die Zeit für gekommen sahen, endlich einen „Schlussstrich“ unter die Vergangenheit zu ziehen und jenen, die nun erst recht anfingen, Fragen zu stellen. Letztere stammten vor allem aus der Generation der um 1940 Geborenen, die einen Großteil der späteren „68er“ stellten und die in den Worten des Historikers Dirk Moses „keine Vertragspartei im großen Stillhalteabkommen zwischen den ‚45ern‘ und deren Vorgängergeneration“ waren.37 Zu dieser Generation gehörte auch Hermann Gremliza, der mit dem eingangs zitierten Artikel auf eine lokale Studierendenöffentlichkeit derselben Alterskohorte traf, die schon zu Beginn der 1960er – und damit lange vor 1968 – in Bewegung geraten war. Der notizen-Artikel über die „braune Universität“ verfügte damit über einen Resonanzraum, in dem er unweigerlich Wirkung entfaltete. Zusammengenommen entstand in Tübingen so eine Dynamik, die es der Universität und ihrer Vertreter kaum mehr möglich machte, den Fragen auszuweichen, die nun offensiv gestellt wurden. Dass es schließlich zu einer so offenen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit im Rahmen einer Ringvorlesung kam, war dabei nicht zuletzt wesentlich dem Wirken des Rektors Hermann Diem geschuldet, dessen eigene Biografie und Erfahrungen im „Dritten Reich“ sowie sein politisches Engagement in der frühen Bundesrepublik ihn zu einem Verbündeten der Studierenden machte. Gerade im Kontrast zum Umgang der Universität mit der Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ nur wenige Jahre zuvor wird deutlich, wie sehr die Ringvorlesung formal eine neue Stufe in der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und damit einen Bruch mit tradierten Ausweichreflexen darstellte. Gleichwohl wird anschließend an eine Darstellung der im Rahmen der Ringvorlesung gehaltenen Vorträge argumentiert, dass die zugrundeliegende Haltung wenig selbstkritisch war und weitgehend dem Narrativ folgte, wonach eine per se unpolitische Wissenschaft selbst zum Opfer des Nationalsozialismus geworden sei. Die Auseinandersetzung der exponierten Fachvertreter mit dem Nationalsozialismus wurde auf einer akademisch-theoretisierenden und -abstrahierenden Metaebene geführt. Diese Akademisierung der Schuld stellte damit in qualitativer Hinsicht gegenüber den Abwehrreflexen der 1950er Jahre nur insofern eine wirkliche Neuerung in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus dar, als überhaupt öffentlich darüber gesprochen wurde. Nicht zuletzt erklärt sich damit auch, weshalb die Ringvorlesung nach allen Seiten hin anschlussfähig war, keine hitzigen Debatten nach sich zog oder zu Konsequenzen für Universität, Wissenschaften oder Wissenschaftler führte. Eine wirklich intensive Aufarbeitung, die auch persönliche und institutionelle Verantwortungen in den Blick nahm, fand – wie oben bereits beschrieben – erst sehr viel später statt. Um den Gegenstand und die Notwendigkeit dieser Aufarbeitung deutlich zu machen, beginnt die Untersuchung zunächst mit einem Blick auf die Geschichte der Universität im Nationalsozialismus und in den ersten Nachkriegsjahren.
1 Dem Verfasser ist die Verwendung einer geschlechtsneutralen bzw. alle Geschlechter abbildende Sprache sehr wichtig und er hält sie auch bei der Abfassung wissenschaftlicher Texte für geboten. Gleichwohl muss im Kontext einer geschichtswissenschaftlichen Arbeit auch darauf geachtet werden, dass historische Sachverhalte nicht durch Sprache verzerrt oder schlicht falsch dargestellt werden. Wenn also im Kontext dieser Arbeit nicht auch von Hochschullehrerinnen die Rede ist, dann bildet sich darin die Tatsache ab, dass der Lehrkörper der Universität im Untersuchungszeitraum dieser Studie eine reine Männerdomäne war. Gleichwohl wird aber von Studierenden die Rede sein, da es – wenngleich auch nur sehr wenige – sehr wohl auch Studentinnen gab.
Details
- Pages
- 186
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631916513
- ISBN (ePUB)
- 9783631916520
- ISBN (Hardcover)
- 9783631905531
- DOI
- 10.3726/b22064
- Language
- German
- Keywords
- Erinnerungspolitik Wissenschaftsgeschichte Ringvorlesung NS-Vergangenheit Sechziger Jahre Vergangenheitsbewältigung Studentenbewegung Nationalsozialismus Hermann Gremliza Universitätsgeschichte
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 186 S., 7 s/w Abb.