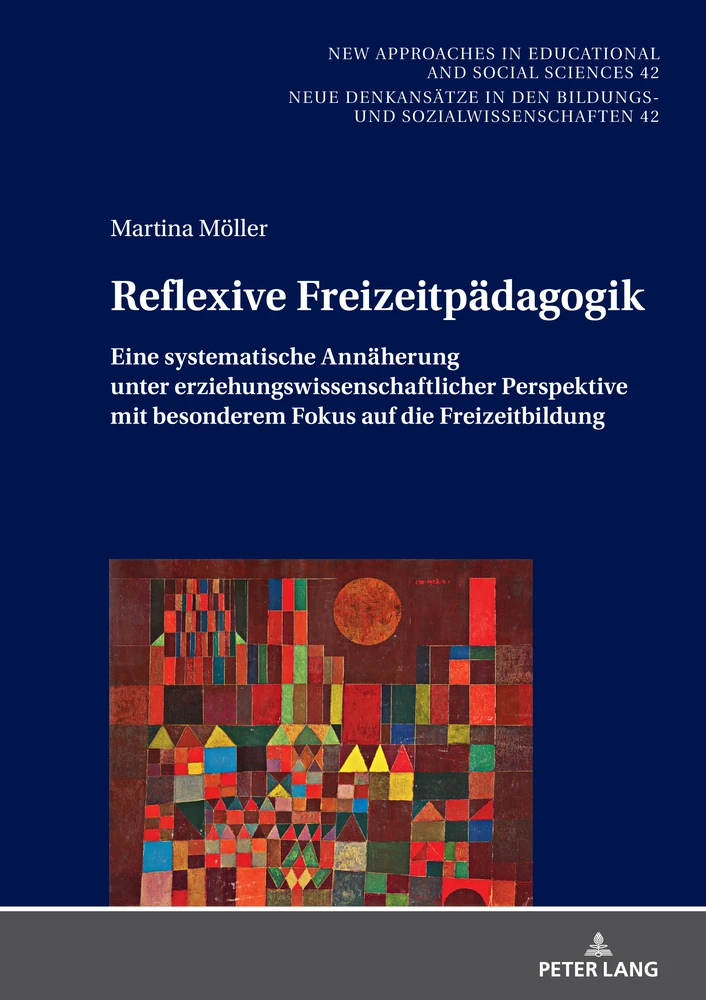Reflexive Freizeitpädagogik
Eine systematische Annäherung unter erziehungswissenschaftlicher Perspektive, mit besonderem Fokus auf die Freizeitbildung
Zusammenfassung
Die Arbeit regt damit dazu an, reflektiert mit der eigenen Freizeit umzugehen. Zugleich wird das Bildungspotenzial von Freizeit deutlich, das eine gesunde Ausbalancierung der unterschiedlichen Bedürfnisse und Funktionen von Freizeit erfordert. Freizeitbildung kann zur Steigerung von Autonomie, persönlichem Wachstum und sinnstiftendem Erleben beitragen. Insbesondere die soziokulturelle Animation stellt einen gesellschaftspolitisch relevanten Ansatz dar, um Integration, ziviles Engagement und Demokratie in der Freizeit erlebbar zu machen und Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Freizeit, Freizeitpädagogik und Freizeitwissenschaft: Zugänge aus einer Beobachterperspektive
- 2.1 Definitorische Annäherungen
- 2.2 Naive und kritische Aspekte einer Freizeitpädagogik
- 2.3 Kritischer Diskurs zur Disziplingeschichte
- 2.4 Kritische Erziehungswissenschaft als Schutz vor Vereinnahmung und Innovationspotenzial
- 3. Interdisziplinäre Zugänge zur Freizeit
- 3.1 Sozialgeschichtlicher Diskurs zur Freizeit
- 3.1.1 Vorformen von Freizeit
- 3.1.2 Zur Bedeutsamkeit der Muße in der klassischen griechischen und römischen Antike
- 3.1.3 „Freizeit“ im Mittelalter
- 3.1.4 Frühe Neuzeit: Renaissance und Reformation
- 3.1.5 Zum Stellenwert der Arbeit im Zeitalter der Aufklärung und Industrialisierung
- 3.1.6 Freizeit im Nationalsozialismus
- 3.1.7 Zur Freizeit seit 1945
- 3.2 Einblick in die psychologischen Aspekte von Freizeit
- 3.3 Philosophischer Diskurs zu den Antipoden Arbeit – Freizeit am Beispiel Hannah Arendts
- 3.3.1 Zur Person- und Rezeptionsgeschichte
- 3.3.2 Zu den Tätigkeitsformen
- 3.3.3 Zum Stellenwert der Vita activa in der Antike und dem Aufstieg der Vita contemplativa im Mittelalter
- 3.3.4 Zum Stellenwert des öffentlichen Bereichs in der Polis
- 3.3.5 Veränderungen in der Neuzeit – Aufstieg des Animal laborans
- 3.3.6 Zur Umkehr des privaten und öffentlichen Bereichs
- 3.3.7 Zur Weltentfremdung und dem Bedeutungsschwund der Vita contemplativa
- 3.3.8 Fazit
- 3.4 Philosophischer Diskurs zur Freiheit und Bindung
- 4. Anthropologische Grundannahmen
- 4.1 Erziehungsbedürftigkeit und Bildsamkeit des Menschen
- 4.2 Humanistische Grundannahmen zur Person
- 4.3 Zur Trias Mensch – Natur – Kultur
- 4.4 Freizeit – Gesundheit – Arbeit – Lebensqualität
- 5. Freizeit und Pädagogik: Einblick in die Historie
- 5.1 Bildung und Freizeit – ein Widerspruch oder konstituierende Bedingung?
- 5.2 Jan Amos Comenius: Anwalt einer vernünftigen Lebensordnung
- 5.2.1 Zum Welt- und Menschenbild bei Comenius: Bildsamkeit als Gabe Gottes
- 5.2.2 Zum Stellenwert von Arbeit und Freizeit im Denken des Comenius
- 5.2.3 Comenius Aufruf zur Verantwortung für die Gesundheit
- 5.2.4 Conclusio
- 5.3 Fritz Klatt – ein Wegweiser der Freizeitbildung
- 5.3.1 Zur Person und Wirkungsgeschichte Fritz Klatts
- 5.3.2 Zur anthropologischen Sicht Fritz Klatts
- 5.3.3 Gesundheitspädagogische Überlegungen in den Werken von Fritz Klatt
- 5.3.4 Zur Entwicklung freizeitpädagogischer Grundgedanken
- 5.3.5 Freizeitpädagogische Zieldimensionen
- 5.3.6 Gestaltungsmerkmale der Freizeitpädagogik
- 5.3.7 Zur professionellen Kompetenz der Kursleiter
- 5.3.8 Fazit
- 5.4 Soziokulturelle Animation als Hochform der Freizeitbildung
- 5.4.1 Jane Addams, die amerikanische Settlement-Bewegung und ihre Vordenker
- 5.4.2 Ausgewählte Wegbereiter einer partizipatorischen Bildung im Freizeitbereich
- 5.4.3 Impulse aus dem lateinamerikanischen Bereich
- 5.4.4 Neuere europäische Entwicklungslinien: Zur Entwicklungsgeschichte der Soziokulturellen Animation in Frankreich
- 5.4.5 Zur Begrifflichkeit und der länderspezifischen Verortung und zum gegenwärtigen Begriff der Soziokulturellen Animation
- 5.4.6 Zu den Funktionen der Soziokulturellen Animation heute
- 6. Gesellschaftliche Tendenzen und Impulse zur Weiterentwicklung der Freizeitbildung
- 6.1 Der Mensch im Zeitalter der reflexiven Moderne
- 6.2 Identitätskonzeptionen im Wandel
- 6.3 Bildung als Selbstbildung
- 6.4 Bildung als Freizeitbildung
- 6.5 Freizeit im Horizont des Lebenslaufes
- 6.6 Verfallserscheinungen und Gegenkräfte durch Erlebnistherapie
- 7. Impulse zur Entwicklung einer reflexiven Freizeitbildung
- 7.1 Kulturelle Milieus, Freizeitgestaltung und Bildungschancen
- 7.2 Urteilskraft gegenüber Vereinnahmungstendenzen
- 7.3 Von der Freizeiterziehung zur Freizeitbildung
- 7.4 Freizeitbildung als kritische Erweiterung der Kulturpädagogik
- 8. Zum Stellenwert der Natur- und Tierwelt im Leben des modernen Menschen
- 8.1 Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit als Zugang zum eigenen Ich
- 8.2 Natur als Antipode einer Kultur- und Leistungsgesellschaft
- 8.3 Heilsame Kräfte: Henry David Thoreau (1817–1862)
- 8.4 Tiere als Bereicherung des menschlichen Daseins
- 8.5 Ethische Implikationen in der Mensch-Tier-Beziehung
- 9. Mögliche zeitgemäße Zielsetzungen einer reflexiven Freizeitbildung
- 9.1 Persönlichkeitsbildung
- 9.2 Erweiterung von Möglichkeitsräumen
- 9.3 Förderung von Gesundheitserleben und Wohlbefinden
- 9.4 Soziale Verortung
- 9.5 Sinnstiftende Aspekte
- 9.6 Prävention und Intervention durch Freizeitbildung
- 10. Paradigmen und ausgewählte methodische Zugänge
- 10.1 Erlebnis als Kontrasterfahrung: Sinnlichkeit als Zugangsmöglichkeit
- 10.2 Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung: Von der Handlungs- und Projektorientierung bis hin zur Soziokulturellen Animation
- 10.3 Gemeinschaft – Individualität: TZI (Ruth Cohn)
- 10.4 Dialogisches Prinzip: Zur Bedeutsamkeit der Person im Dialog bei Martin Buber
- 11. Ausgewählte Handlungsfelder einer Freizeitbildung
- 11.1 Freizeitcoach – eine berufliche Vision
- 11.2 Offene und kirchliche Kinder- und Jugendarbeit
- 11.3 Freizeitpädagogik in der Ganztagsschule
- 11.4 Tiergestützte Freizeitpädagogik
- 11.5 Künstlerische Freizeitprojekte: Beispiel Musik
- 11.6 Ehrenamtliches Engagement als Freizeitbildung
- 11.7 Freizeitbildung, Tourismus und Ökologie
- 11.8 Freizeitwelten als Bildungswelten: Erlebnisorientierte Lernwelten
- 11.9 Sport, Gesundheit und Freizeitbildung
- 11.10 Ganzheitliche Erwachsenenbildung in der Freizeit
- 12. Qualitätskriterien für die Freizeitbildung
- 12.1 Aufbau einer Berufsethik und des entsprechenden Professionswissens
- 12.2 Evaluation und Qualitätsmanagement
- 12.3 Selbstkritische Sichtweise
- 13. Zusammenfassung und Ausblick
- 14. Literaturverzeichnis
- 15. Internetquellen
- 16. Abbildungsverzeichnis
- Reihenübersicht
1. Einleitung
Freizeit – für viele Menschen ein Wort, das von positiven Assoziationen begleitet wird. Trotz eines faktischen Rückgangs der wöchentlichen Arbeitszeit in den letzten 100 Jahren, beklagen viele Menschen, dass sie viel zu wenig Freizeit hätten.1
Wird von Freizeit gesprochen, so erscheint dies als ein allgemein verständlicher Terminus und dennoch versteht jeder hierunter durchaus etwas anderes. Mit den eigenen Kindern nachmittags auf den Spielplatz zu gehen, mag von den einen als Freizeit erlebt werden, andere Personen würden sagen, dass ihre Freizeit erst dann beginnt, wenn die Kinder wieder zuhause im Bett liegen und schlafen.
Negativ wird Freizeit als Nicht-Arbeitszeit definiert. (vgl. Kap. 1) Die Trennung der Lebenszeit in Arbeitszeit und Freizeit suggeriert, dass es sich hierbei um klar abgrenzbare und voneinander verschiedene Bereiche handelt, basierend auf der Trennung der Arbeitswelt von dem privaten Leben im Zuge der beginnenden Industrialisierung. Dabei wird übersehen, dass diese Trennung letztlich artifiziell ist. (vgl. Kap. 3) Obgleich jeder Mensch für sich definiert, was er als Freizeit erlebt, gibt es in der Wissenschaft keine einheitliche Definition.2 Selbst die Frage, seit wann es Freizeit in der Menschheitsgeschichte gibt, erfährt von verschiedenen Forschern unterschiedliche Antworten. (vgl. vor allem Kap. 2.1 und Kap. 3.3)
Die Definition von Arbeitszeit scheint auf den ersten Blick einfacher zu sein – jedenfalls seit es Arbeitsverträge und festgelegte Arbeitszeiten gibt. Auf der anderen Seite verschwimmen in der Gegenwart diese Grenzen zunehmend: die permanente Erreichbarkeit über Smartphone, die Notwendigkeit der stetigen Weiterqualifikation, das Bestreben, Hobbies zu Berufen zu machen, die Flexibilisierung der Arbeitsräume und -zeiten – all dies sind Momente, die eine Trennung der Zeit in Arbeits- und Freizeit letztlich fraglich erscheinen lassen. Neue Kompetenzen werden hierbei dem Individuum abverlangt, neue Möglichkeitsräume eröffnet. (vgl. Kap. 6)
Freizeit gilt heute als ein Lebensbereich, der expandiert. Vielfach wird von einem quantitativen und qualitativen Bedeutungsgewinn der Freizeit gesprochen. Dabei muss bedacht werden, dass dies in erster Linie auf die westlichen Industrienationen zutrifft. Auch in Deutschland ist aber die freie Zeit durchaus ungleich verteilt und variiert innerhalb des individuellen Lebenslaufs. Zahlreiche Faktoren, u.a. auch das Geschlecht, die Bildung und das pekuniäre Kapital, spielen hierbei eine Rolle. Nicht zuletzt verschränkt sich die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen mit deren Bildungsverläufen. (vgl. Kap. 7.1) Freizeit ist auch ein wichtiger Bildungsfaktor.
Zugleich muss auf die Schattenseite des heutigen Erwerbsmarktes hingewiesen werden: eine Vollbeschäftigung aller Bürger im ersten Erwerbsmarkt erscheint immer weniger möglich.3 Dies führt zwangsläufig zu Schwierigkeiten, wenn sich ein Individuum in hohem Maße über die Berufstätigkeit definiert und diese Grundlage der gesellschaftlichen Achtung und Integration darstellt. Über den Stellenwert der Freizeit für die Sinnstiftung, Lebensqualität und Identitätsbalance muss demzufolge kritisch reflektiert werden. Das humanistische Potenzial sollte dabei einer Konsumorientierung entgegengesetzt werden. (vgl. Kap. 4 und Kap. 6)
Der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Nahrstedt (*1932) war Mitbegründer des „Instituts für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit“ (IFKA), das ebenfalls freizeitbezogene Forschungsprojekte durchführt.4 Mitte der 1970er-Jahre wurde von Nahrstedt u.a. die Vision einer Freizeitgesellschaft und das Aufblühen der Freizeitpädagogik als führende Pädagogik, als „Emanzipationspädagogik“5 und „Friedenspädagogik“ 6 prognostiziert7 und bereits damals kritisiert.8 Heute wird dieses Institut von Renate Freericks geleitet und verfolgt als Arbeitsschwerpunkte sozialwissenschaftliche Zeitforschung und weitere Auftragsforschungen zur Freizeit- und Tourismusentwicklung von Städte, Konzeptentwicklung und Evaluationen, Fachtagungen etc. zum Tourismusmanagement und vieles mehr.9
Horst Opaschowski (*1941) gründete im Jahr 1979 das BAT-Freizeitforschungs-Institut. Von der Stiftung für Zukunftsfragen, einer Initiative von British American Tobacco,10 wird heute u.a. in regelmäßigen Abständen ein Freizeitmonitor und eine Tourismus-Analyse durchgeführt. Horst Opaschowski, der sich zunächst mit Fragen der Freizeit aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive befasst hat, sich aber ab den 1980er-Jahren zum Zukunftsforscher und politischen Berater entwickelt hat, war bis 2011 der wissenschaftliche Leiter dieser Stiftung. Das aktuelle Selbstverständnis der Stiftung für Zukunftsfragen lautet: „Zukunft ist machbar. Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt“.11
Darüber, was die Menschen in ihrer Freizeit machen, gibt es heute zahlreiche empirische Studien, die insbesondere auch von Seiten der Wirtschaft von Interesse sind. Die Liaison mit der Wirtschaft impliziert aber auch, dass es innerhalb der empirischen Forschungslage „blinde Flecken“ gibt, nämlich immer dort, wo es um wenig finanzstarke Gruppen geht.12
Infolge des demografischen Wandels verbunden mit einer verbesserten Gesundheitsvorsorge kommt es zu einem Anstieg der freien Lebenszeit in der nachberuflichen Lebensphase.13 Die eigenen Kinder sind erwachsen, das Rentenalter oder Pensionsalter ist erreicht, und man ist körperlich und geistig noch relativ fit. Die Generation der „jungen Alten“ muss die neu gewonnene freie Zeit gestalten. Freizeit kann in diesem Zusammenhang durchaus eine psychosoziale Krise bedeuten.14
Dabei ist die Freizeit als pädagogisches Handlungs- und wissenschaftliches Forschungsfeld eine relativ junge Disziplin. Die Wurzeln freizeitpädagogischer Bestrebungen lassen sich bis in die Weimarer Republik zurückführen, pervertierten auf praktischer Ebene unter dem Nationalsozialismus. In der Nachkriegszeit wurde die Thematik langsam wieder aufgegriffen und hielt Einzug in den erziehungswissenschaftlichen Diskurs.15 (vgl. Kap. 2.3, Kap. 5)
Sprechen Forscher wie Walter Tokarski (*1946)16 von dem Bedeutungszuwachs der Freizeit im menschlichen Lebenslauf, so wäre die Schlussfolgerung, dass die Arbeit an Stellenwert verliert, sicherlich trügerisch. Viel eher darf die Knappheit der Ressource „bezahlte Arbeit“ als Strukturierungsmoment des menschlichen Lebens nicht außer Acht gelassen werden. Die Sinnfrage des menschlichen Lebens bleibt bestehen und erfordert gesellschaftliche Deutungsangebote und individuelle Entscheidungen. Dabei kommt aber auch dem privaten Lebensbereich und der Freizeit eine hohe Bedeutsamkeit zu, das Leben dreht sich – insbesondere bei der „Generation Y“17 – nicht mehr nur um die berufliche Karriere oder die Familie, auch die persönliche Lebensqualität wird relevant.18 Durch den demografischen Wandel bezeichnet der Soziologe Klaus Hurrelmann (*1944) die Generation der Ende der 1970er-Jahre bis Anfang der 1990er-Jahre Geborenen als „heimliche Revolutionäre“, da die Wirtschaft auf sie als Arbeitskräfte durchaus angewiesen ist, die Angehörigen dieser Generation aber familiäre und freizeitbezogene Erfahrungsqualitäten in dem beruflichen Arbeitsbereich einfordern.19 Dass durch die Forscher gezeichnete Generationen-Portrait und die sich auflösende Kategorie von Arbeit und Freizeit wird in den modernen Medien vielfach polarisierend diskutiert.20
Die pädagogische Debatte über Freizeit impliziert somit immer eine ethische und normative Perspektive. Hierdurch unterscheidet sie sich von kommerziell orientierten Perspektiven auf die Freizeit als Wirtschaftsmarkt.21
Dabei scheint die Freizeitwissenschaft sich als eigenständige Disziplin zu etablieren. Horst Opaschowski definiert sie als Spektrumswissenschaft22, Reinhold Popp (*1949) spricht von einer Querschnittswissenschaft und Integrationswissenschaft23. Die Forderung nach Eigenständigkeit und Abgrenzung von der Erziehungswissenschaft steht ebenso im Raum wie die Forderung, Freizeitpädagogik als eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft zu begreifen.24
Die aktuellen Veröffentlichungen und Studiengänge zum Gegenstandsbereich „Freizeit“ zeigen, dass sich die Freizeitpädagogik zur Freizeitwissenschaft entwickelt, als Kernbereiche der Freizeitwissenschaft sich heute vor allem die Verbindung von Freizeit und Tourismus, Freizeit und Sport sowie Freizeitmanagement und -marketing begreifen. Dabei werden wesentliche Bereiche jenseits des Bereiches Tourismus durchaus eher marginalisiert. (vgl. Kap. 8, 9, 10)
Bei der Suche nach einer bildungstheoretischen Fundierung der Freizeitpädagogik finden sich kaum aktuelle Quellen, die dem annähernd gerecht werden. Im Kontext der Entgrenzung von Bildungsprozessen und einer Aufwertung informeller und non-formaler Bildungsprozesse wird es zunehmend wichtig, Freizeit als Raum lebenslanger Bildungsprozesse wahrzunehmen und Freizeitpädagogik als reflexive Freizeitbildung zu fundieren. Die Forderung nach lebenslangem Lernen und nachhaltiger Bildung lässt die Verengung einer bildungswissenschaftlichen Perspektive auf institutionelle Bildungsprozesse obsolet erscheinen.
Das vorliegende Werk möchte den bildungstheoretischen Diskursstrang der Freizeitpädagogik wieder aufgreifen, anthropologische Grundlagen thematisieren und einen systematischen und kritischen Blick auf vereinnahmende Tendenzen und die Kommerzialisierung der Freizeit ermöglichen. Ziel soll es hierbei sein, eine kritische Sicht auf Entwicklungstendenzen im Freizeitbereich und produktive Möglichkeitsräume für eine zeitgemäße Freizeitbildung zu eröffnen.
Zugleich soll es ein Studienbuch sein, das exemplarisch tradierte erziehungswissenschaftliche Positionen und deren Vertreter vorstellt und diese im Hinblick auf freizeitpädagogische Bezüge reflektiert, um die Möglichkeit zu eröffnen, sich eine eigene professionelle freizeitpädagogische Position anzueignen und Geschichte und Gegenwart sowie zukünftige Entwicklungstendenzen kritisch hinterfragen zu können.
1 vgl. Opaschowski 2008, S. 39.
2 vgl. Carius/Gernig 2010, S. 1; Prahl 2002, S. 16.
3 vgl. Lippl 1995; S. 86.
4 vgl. Nahrstedt 2008a
5 Nahrstedt 1974, S. 10.
6 Nahrstedt 1974, S. 23.
7 Nahrstedt 1974, S. 5 ff.; Opaschowski 1976, S. 154.
8 vgl. Opaschowski 1976. Aus soziologischer Sicht sprach Christiane Müller-Wichmann bereits Mitte der 1980er-Jahre von der „Legende der Freizeitgesellschaft“ und wies darauf hin, dass die Berechnungen z.B. nicht die gestiegenen Erwartungen berücksichtigten, d.h. die gewonnene Zeit jenseits der Berufsarbeit nicht automatisch zur Freizeit wird. (vgl. Müller-Wichmann 1987, S. 620ff.)
9 vgl. Homepage der Hochschule Bremen: Forschungseinrichtungen: IFKA – Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturpädagogik e.V. URL (2014/2018).
10 vgl. Homepage der Stiftung für Zukunftsfragen. URL (2014).
11 vgl. Homepage der Stiftung für Zukunftsfragen: Selbstverständnis und Stiftungszweck. URL (2014; 2018).
12 vgl. Carius/Gernig 2010, S. 63.
13 vgl. Opaschowski 2008, Kap. 4, S. 164ff.
14 vgl. Opaschowski 2008, S. 177.
15 vgl. Nahrstedt 1990; Giesecke 1983.
16 Tokarski 2005, S. 529.
17 Hurrelmann/Albrecht 2014.
18 vgl. Bund/Heuser/Kunze 2013.
19 Hurrelmann/Albrecht 2014.
20 vgl. Kommentare zum Zeit online-Artikel: Generation Y. Die heimlichen Revolutionäre der Arbeit (04.09.2014). URL (2015).
21 vgl. Lippl 1995.
22 vgl. Opaschowski 1994, S. 441-444; vgl. Opaschowski 2008. S. 16; vgl. Freericks/Hartmann/Stecker 2010, S. 19.
23 vgl. Popp/Schwab 2003, S. 4.
24 vgl. Popp/Schwab 2005.
2. Freizeit, Freizeitpädagogik und Freizeitwissenschaft: Zugänge aus einer Beobachterperspektive
2.1 Definitorische Annäherungen
Obgleich jeder eine subjektive Vorstellung von Freizeit hat, gibt es keine allgemeingültige Definition von Freizeit. Der Blick in den Duden suggeriert, dass es lediglich zwei Bedeutungsebenen von Freizeit gebe: Freizeit als…
1. „Zeit, in der jemand nicht zu arbeiten braucht, keine besonderen Verpflichtungen hat; für Hobbys oder Erholung frei verfügbare Zeit.
2. [mehrtägige] Zusammenkunft für Gruppen mit bestimmten gemeinsamen Interessen.“25
Bei dem Terminus „Freizeit“ handelt es sich um ein Determinativkompositium:

Abb. 1: Zur Semantik26 (vgl. Carius/Gernig 2010, S. 4–7)
Es gibt zunächst als Determinans das Adjektiv „frei“, das das Subjekt „Zeit“ näher definiert. Es wird somit zwischen „freier“ und „nicht-freier“ Zeit differenziert. Die Freizeitwissenschaftler Florian Carius und Björn Gernig (2010) führen den Gedanken der „Zeit der Freiheit“ auf Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) zurück, der in seinem weltbekannten Erziehungsroman „Émile ou de l’éducation“ (1762) von der „temps de liberté“ sprach.27 Somit wurde der Begriff hier im pädagogischen Kontext verwandt.28
„Pensez-vous que ce temps de liberté soit perdu pour lui? tout au contraire, il sera le mieux employé; car c’est ainsi que vous apprendrez à ne pas perdre un seul moment dans un temps plus précieux: au lieu que, si vous commencez d’agir avant de savoir ce qu’il faut faire, vous agirez au hasard; sujet à vous tromper, il faudra revenir sur vos pas; vous serez plus éloigné du but que si vous euzziez été moins pressé de l’atteindre.“29
Erst durch Bildung gewinnt der Mensch die Freiheit und Kompetenz, souverän mit der Zeit umzugehen und zielorientiert zu handeln, dadurch auch freie Zeit zu gewinnen so könnte die Interpretation lauten.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Gestaltung der Freizeit für J.-J. Rousseau neben einer pädagogischen auch eine politische Bedeutsamkeit besaß, worauf Martin Rang (1959) deutlich verweist. So sprach sich J.-J. Rousseau auch explizit für ein Theater in Genf aus und maß den „Festsitten einer Nation“30 hohe Bedeutsamkeit zu. Für das Gemeinschaftserleben sah er die gemeinsame Freizeit als wichtig an.31
Etymologisch kann der Terminus Freizeit auf den Begriff „freye zeyt“ oder „frey zeit“ zurückgeführt werden.32 Dieser Begriff ist im Koblenzer Gerichtsbuch urkundlich seit dem Jahr 1356 belegt, als Kaiser Karl IV (1316–1378) eine Verschiebung der „freye zeyt“ verfügte.33 „Freye zeyt“ meinte hier noch die Marktfriedenszeit und stellte einen mittelalterlichen Rechtsbegriff dar.34 Während der Marktfriedenszeit standen die Menschen unter einen besonderen Schutz, Überfälle und Gewalttaten wurden besonders hart bestraft.35
Ins Lateinische wurde die „freye zeyt“ dann mit „tempus liberum“ übersetzt und meinte eine Zeit „daran einer thủn mag nach seim willen vnd gefallen“.36 Eine erste Bedeutungsverschiebung wird erkennbar, „tempus liberum“ impliziert die Nutzung von Zeit nach eigenen Gustos.
Mit der Renaissance findet eine Rückbesinnung auf den antiken Begriff der „Muße“ statt, das Individuum gerät in den Blick, „freye zeyt“ meint in diesem Zusammenhang jene Zeiten, in denen der einzelne Mensch über ein höheres Maß an Freiheit verfügt, „Freizeit als Zeit der Freiheit“37. In einem Wörterbuch aus dem Jahre 1616 wird freye zeyt wie folgt definiert: „freye zeyt – darin einer thun mag nach seim willen und gefallen.“38
In heutiger Schreibweise findet sich „Freizeit“ als Kompositum im Jahr 182339 bzw. 182640 und der Begriff wird im Duden erstmals im Jahr 1929 aufgeführt.
Renate Freericks (*1961), Rainer Hartmann (*1966) und Bernd Stecker gehen in ihrem Werk „Freizeitwissenschaft“ (2010) auch auf den Freizeitbegriff ein. Sie rekurrieren hierbei zunächst auf Johannes Fromme (*1956)41, der Freizeit wie folgt definiert:
„‘Der Freizeitbegriff verweist auf eine spezifische Form arbeitsfreier Zeit, die es so in vormoderner bzw. vorindustrieller Zeit nicht gegeben hat, und basiert – im Unterschied zu älteren Formen (wie der Muße) – auf einer klaren raum-zeitlichen Trennung von Arbeit und sonstigem Leben sowie einer strengen zeitlichen Regelung und auch Begrenzung der Erwerbsarbeit‘ (Fromme 2001, S. 619).“42
Diese Definition kann durchaus kritisch gelesen werden, denn die raum-zeitliche Trennung und die strikte Begrenzung der Erwerbsarbeitszeit ist heute nur noch bedingt gegeben. Es stellt sich die Frage, ob der Freizeitbegriff erodiert, wenn es zu einer zunehmenden Verflüssigung solcher Grenzen kommt – man denke hier an Beschäftigungsformen mit „Homeoffice“ oder auch jene Selbstständige, bei denen weder die Arbeitszeit festgelegt, noch die zeitlich-räumliche Trennung in eine private und eine berufliche Welt gegeben sein muss. Von der jüngeren, durchaus leistungsbereiten, „Generation Y“ wird ein höheres Maß an Autonomie und Flexibilisierung der beruflichen Zeitstrukturen durchaus auch erwartet, um den privaten, familiären und beruflichen Lebensbereich auszubalancieren.43
So konstatiert der Soziologe Hans-Werner Prahl (*1944) bereits im Jahr 2002, dass
„Freizeit (…) traditionell als Gegenteil von Arbeit begriffen [wurde]. Diese Sicht war historisch angemessen und kann auch für die Gegenwart immer noch als eine zentrale Bestimmung angesehen werden. Diese arbeitspolare Definition wird aber immer stärker überlagert durch gesellschaftliche Entwicklungen, die nur noch indirekt auf Arbeit bezogen sind.“44
Statt einer kritischen Hinterfragung jenes Freizeitbegriffs wird in dem Handbuch „Freizeitwissenschaft“ weiter dargelegt, dass das allgemeine Verständnis von Freizeit ein dialektisches sei, indem Freizeit negativ als „Nicht-Erwerbsarbeitszeit“ bestimmt werde.45 Die Autoren beziehen sich auf die Sichtweise von Hermann Giesecke (*1932)46, der die Entstehung von Freizeit in Zusammenhang mit der Industrialisierung bringt. Hierbei spielt die raum-zeitliche Trennung von Arbeit und privatem Leben eine wichtige Rolle, ebenso die Rationalisierung und Ökonomisierung von Zeit.
Daneben wird erwähnt, dass der Erziehungswissenschaftler, Freizeitwissenschaftler und Zukunftsforscher Horst Opaschowski (*1941)47 die ersten Anfänge der Entstehung von Freizeit auf das Reformationszeitalter ins 16. Jahrhundert zurückführt. Im Zuge des Aufkommens der protestantischen Arbeitsethik sei als Gegenpol der Wunsch nach Freizeit entstanden.
„Die Gegenpole öffentlicher Pflicht, Fremdbestimmung und Zwang auf der einen Seite und private Neigung, Selbstbestimmung und Freiheit auf der anderen Seite führten schließlich zu einer strikten Trennung von privater und öffentlicher Zeit.“48
Obgleich der Müßiggang als Laster galt, wurde das Privileg der Muße, das zunächst dem Adel vorbehalten war, vom aufstrebenden Bürgertum und später auch weiteren Bevölkerungskreisen adaptiert.49 Freizeit erscheint in dieser dialektischen Sichtweise als eine „Restkategorie“50 und bezieht sich auf jene Zeit, die abzüglich der Arbeitszeit verbleibt.
Auch die Freizeitwissenschaftler Florian Carius und Björn Gernig (2011) problematisieren, dass es zum Beginn der Freizeit durchaus unterschiedliche Theorien gibt.51 Sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass jene Vertreter, die „Freizeit als Produkt der Industrialisierung“52 betrachten, eine „moderne Vorstellung von Freizeit“53 vertreten, deren „wissenschaftlichen Aktionsradius“ durchaus begrenzt und statisch ist.54 Dieses definitorische Konstrukt von Freizeit „ist stark gegenwartsbezogen und setzt somit erstens eine dichotome Zeiteinteilung zwischen Erwerbsarbeit und klar individuell disponibler Zeit sowie zweitens die räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsort voraus.“55
Grundsätzlich fällt auf, dass diese Darlegungen in neueren Handbüchern und Einführungswerken zur Freizeitwissenschaft sehr knapp ausfallen. Sie geben lediglich zentrale Begründungsmomente wieder, wodurch eine Anregung zur kritischen Reflexion m.E. zu kurz kommt.
Diese wird stärker von Soziologen angeregt; neuere theoretische Werke dezidiert zur Freizeitpädagogik sucht man vergeblich. Hier dominiert im Moment eher eine empirische Ausrichtung.
Der Soziologe und Theologe Bodo Lippl (*1970) expliziert die Problematik, Freizeit (wissenschaftlich) zu definieren. Er weist vor allem auch auf die forschungsbezogenen Konsequenzen hin:
„Freizeit ist keine konkrete Institution oder ein exakt abgrenzbarer gesellschaftlicher Handlungsbereich, sondern eher eine recht uneindeutige Kategorie der Zeitverwendung, unter die mehr oder weniger alles subsumiert werden kann. Vor allem bei empirischen Studien ergibt sich das Problem, dass Definitionen präzise sein müssen. Oftmals sind Definitionen nicht kompatibel, weshalb viele wissenschaftliche Forschungen schwierig bzw. gar nicht so ohne weiteres verglichen werden können.“56
Hierzu rekurriert er u.a. auf den Soziologen Bernhard Nauck (*1945)57, der davon ausgeht, dass der jeweilige Freizeitbegriff immer im Kontext der Theorie und Forschung betrachtet werden muss. Der Begriff der Freizeit hat oftmals durchaus auch normative Implikationen.58 Diese werden oftmals ausgeblendet, beobachtet man den Diskurs.
Freizeit als Kategorie muss somit als soziokulturelles Konstrukt begriffen werden, das dem historischen Wandel unterliegt.
Die Definitionen von Freizeit können in ein negatives und positives Spektrum unterschieden werden, die auch den veränderten Stellenwert von Arbeit und Freizeit widerspiegeln. Bodo Lippl gibt einen Einblick in positive und negative Definitionsmöglichkeiten, die sich wie folgt visualisieren lassen:

Abb. 2: Definitorische Ansätze zur Freizeit: Von der Residualkategorie zum autonomen Lebensbereich59 (vgl. Lippl 1995)
Zunächst wurde Freizeit negativ als Rest- oder „Residualkategorie“60 zur Arbeit definiert, als jene Zeit, die dem Menschen nach der Berufsarbeit verblieb.
|
24 Stunden – Erwerbsarbeitszeit pro Tag in Stunden = Freizeit am Tag |
Bereits im Jahr 1932 findet sich eine „negative“ Freizeitdefinition bei dem Sozialwissenschaftler und Sozialdemokraten Andries Sternheim (1890–1944)61.
Bekannt wurde Sternheim vor allem durch seine Studie zu den Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit, die er mit Marie Lazarsfeld-Jahoda (1907–2001) und Hans Zeisl (1905–1992) durchgeführt und 1933 unter dem Titel „Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie“ publiziert hat. A. Sternheim wurde 1944 in Auschwitz ermordet.
Andries Sternheim definierte in seinem Aufsatz „Zum Problem der Freizeitgestaltung“ (1932) die Freizeit wie folgt:
„Als Freizeit wird hier diejenige Zeit betrachtet, welche nach der normalen Arbeitsperiode übrig bleibt. Die Freizeit ist daher als Antipode zu der auf dem normalen Arbeitsplatz verbrachten Zeit gedacht. Ausdrücklich wird bei dieser Begriffsbestimmung von normaler Arbeitsperiode und normalem Arbeitsplatz gesprochen, da die Freizeit auch für zusätzliche Arbeit zur Befriedigung eigener oder fremder Bedürfnisse verwendet werden kann. Weiter bleibt die Freizeit der völlig aus dem Wirtschaftsprozeß Ausgeschiedenen und derjenigen, die noch nicht im Wirtschaftsprozeß tätig sind außer Betracht.“20
Nach diesem Verständnis gibt es die Freizeit erst auf der Basis der außerhäuslichen Erwerbsarbeit. Menschen ohne Erwerbstätigkeit, ältere Menschen oder Kinder fallen aus diesem definitorischen Ansatz erst einmal heraus.
Obgleich sich erste Ansätze zur Erforschung der Freizeit mit dem Werk „Die Erholung der Arbeiter außer dem Hause“ von Victor Böhmert (1893)62 finden lassen, wird Freizeit bzw. der Umgang mit Freizeit erst in den 1920-/30er-Jahren als gesellschaftlich relevanter Problembereich erkannt und vermehrt zum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Diskussion.
Sowohl die Pädagogik (Fritz Klatt 1929) als auch die Psychologie (Pearl Greenberg 1932) und Sozialwissenschaft (Andries Sternberg 1932) wandten sich dem Phänomen „Freizeit“ zu. Provokant könnte man die These in den Raum stellen, dass Freizeit – sobald demokratisiert– zum gesellschaftlich relevanten Problembereich wurde.
Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass der Beginn einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen „Freizeit“ von negativen Definitionen ausgeht.
Der Terminus „negative Definition“ impliziert aber keine „präjudikative Wertung“63, sondern nimmt die Arbeit als zentrale Bezugsgröße und grenzt Freizeit als Nicht-Arbeitszeit ab.64
Diesen Ansatz führt Bodo Lippl mit der protestantischen Arbeitsethik in Verbindung, durch die es zu einer enormen Aufwertung der Arbeit im menschlichen Lebenslauf kam.65 (vgl. hierzu noch Kap. 3.1.4)
Hier wird eine rein formale und zeitliche Kategorie als Definitions- und Abgrenzungskriterium herangezogen. Es findet eine ökonomisch-rechtliche Dichotomisierung statt, in der Arbeit und Freizeit zwei Kategorien darstellen.
Spätere Forscher66 haben diesen negativen Definitionsansatz immer weiter präzisiert, da nicht die gesamte Zeit jenseits der bezahlten Erwerbsarbeit als Freizeit betitelt werden kann. Es stellt sich die Frage, ob Freizeit allein als zeitliche Kategorie (verbleibende Zeit neben der Arbeitszeit) oder als inhaltliche Kategorie bzw. „Komplementärzeit“67 zur Arbeitszeit zu bestimmen ist.
Der französische Soziologe Joffre Dumazedier (1915–2002) verfolgt den Ansatz, Freizeit stärker inhaltlich zu bestimmen. So versucht er, Freizeit von familienbezogenen, religiösen oder politischen Aktivitäten abzugrenzen68 und wirft die Frage auf, welche Funktion Freizeit für das Subjekt habe. In seinem Werk „Vers une civilisation du loisir?“ (1962) spricht Joffre Dumazedier der Freizeit drei übergeordnete Funktionen zu, die als Bestimmungsmerkmal herangezogen werden könnten.69

Abb. 3: Charakteristika von Freizeit nach Joffre Dumazedier (1974) (eigene Abbildung)
Bodo Lippl resümiert, dass Joffre Dumazedier (1915–2002) letztlich Freizeit als Aktivität charakterisiert, die entweder der Erholung, der Unterhaltung oder der persönlichen Entwicklung dient.70 Er ordnet die Sichtweise von Joffre Dumazedier noch in den Bereich der negativen Definitionen ein, während Hans-Werner Prahl sie bereits zu den positiven Definitionen zählt.71 Hieran wird erkennbar, dass es sich letztlich um Kategorien handelt, deren Gehalt durch eine intersubjektive Validierung bestimmt wird.
Als weitere Beispiele für die Differenzierung negativer Definitionsansätze rekurriert Bodo Lippl auf Viggo Graf von Blücher72, der sich mit der Entwicklung der Freizeit befasst hat und als Freizeit eben nicht mehr das gesamte verbleibende Zeitfenster neben der Arbeit betitelte, sondern die Schlafenszeit, die Zeit für die Erledigung der Hausarbeit etc. abzog.73 Allerdings lässt sich Freizeit demnach weder ausschließlich über die Kategorie der Zeit noch über die des Inhalts- oder der Aktivitätsform bestimmen, wozu Bodo Lippl entsprechende Beispiele anführt.74
Auch mittels rollentheoretischer Überlegungen wurde versucht, Freizeit zu definieren. So bestimmte der Soziologe Erwin Scheuch (1928–2003) in seinem Aufsatz zur „Problematik der Freizeit in der Massengesellschaft“ (1972)75 diese nicht allein über die Aktivität. Als Bestimmungsmerkmal zog er hinzu, ob es sich um Aktivitäten handelt, die sich nicht zwangsläufig aus der „funktionalen Rolle“ ergeben, in denen sich das Individuum befindet. Als Freizeit werden dementsprechend jene Zeiträume bezeichnet, in denen das Individuum Aktivitäten ausübt, die nicht an seine soziale Rolle gebunden sind: „(…) Freizeit sind Tätigkeiten, die sich nicht notwendig aus den funktionalen Rollen ergeben.“76
Die Freiheit vom Rollenzwang kann hier als ein neues Bestimmungsmerkmal betrachtet werden, wobei einem bewusst sein muss, dass das Individuum seine sozialen Rollen interpretiert und ausgestaltet. Dennoch gelang es Erwin Scheuch, die Einstellungen und die individuelle Motivation zu berücksichtigen.77
Bodo Lippl skizziert somit die Differenzierung und Entwicklung negativer Definitionsansätze anhand von vier Personen und deren Definitionen. Jenseits einer rein quantitativen Erfassung der verbleibenden freien Zeit neben der Erwerbsarbeit werden zunehmend qualitative/inhaltliche Bestimmungsmerkmale bedeutsam. Gerade bei Joffre Dumazedier scheint die Grenze zu positiven Definitionsansätzen fließend. Hier wird der Freizeit ein höherer Stellenwert beigemessen und zunehmend als eigenständiger Lebensbereich betrachtet.
In den 1960/70er-Jahren wurde Freizeit vermehrt aus (sozial- und entwicklungs-)psycho-logischer Perspektive betrachtet. Welche Zusammenhänge sich zwischen dem Freizeitverhalten, der Persönlichkeitsstruktur und dem Freizeiterleben entdecken lassen, spürten z.B. Hans Thomae (1960), Reinhard Schmitz-Scherzer (1974) oder auch Walter Tokarski (1979) nach.
Die Subjektivität von Freizeit rückt in den Mittelpunkt, so definiert Wolfgang Nahrstedt (1972) Freizeit als „eine Zeit größtmöglicher individueller Freiheit“78. Das Determinans frei – im Sinne von Freiheit zu etwas – bestimmt die Sichtweise.
Wolfgang Nahrstedt führt die Entstehung der Freizeit eben nicht nur auf die Industrialisierung zurück, sondern stellt sie in den Kontext der Aufklärung.79 Dabei begreift er die Reformation als Wegbereiter der Freizeit, die aber erst durch die Aufklärung und ein neues Selbst- und Bildungsverständnis aufkam.80
„In der Literatur herrscht die Meinung vor, daß die moderne Freizeit erst als Folge der Industrialisierung entstanden sei. Tatsächlich jedoch ist die Freizeit zumindest in Deutschland durch den neuen Freiheitsbegriff der Aufklärung und durch die Industrialisierung gemeinsam geschaffen worden.“81
Es wird an diesem Versuch bereits evident, dass eine rein dichotome Bestimmung fragwürdig erscheint. Auch die Bemühungen, Theorien zur historischen Entwicklung aufzustellen, verbleiben aus Sicht von Florian Carius und Björn Gernig fragwürdig, da hier immer nur selektiv auf einzelne Protagonisten rekurriert wird und Textstellen/Aussagen überinterpretiert werden.82 Diesem Vorwurf muss sich jeder Versuch einer Historiografie stellen. Zugleich sind die Definitionsversuche von Freizeit stets im historischen Kontext zu sehen.
So stellt der Pädagoge Erich Weber (1927–2016) in seinem Werk „Das Freizeitproblem. Anthropologisch-pädagogische Untersuchung“ (1963) die Bedeutsamkeit der Freizeit für ein sinnerfülltes Leben heraus und betont den Moment der Selbstbestimmung als Charakteristikum der Freizeit.
„’Freizeit’ läßt sich zusammenfassend als der Inbegriff derjenigen Zeitspannen eines individuellen Lebenslaufes bestimmen, in denen sich die Person frei von Fremdbestimmung – vor allem in der Form der Erwerbsarbeit – erlebt und dadurch frei wird für die sinnvolle Erfüllung dieser Zeiten, so daß eine wahrhaft menschliche Lebensführung möglich wird.“83
Die Pole Fremdbestimmung und Selbstbestimmung werden bereits bei Erich Weber zum Definitionskriterium von Freizeit, wobei zu erahnen ist, dass die Erwerbsarbeit mit Fremdbestimmung assoziiert ist. Auch dieses Kriterium erscheint fraglich, denn auch außerhalb der Erwerbstätigkeit kann ich – selbstbestimmt – auf einen Teil meiner Autonomie verzichten, wenn ich z.B. regelmäßig in einem Fußballverein trainiere. Sowohl an die Trainingszeiten als auch an die Spielregeln und Anweisungen des Trainers muss ich mich halten. Im umgekehrten Fall kann ich bei meiner Erwerbstätigkeit über ein hohes Maß an Selbstbestimmung verfügen, und meine berufliche Arbeit kann als sinnvolle Tätigkeit erlebt werden.
Dieser Problematik ist sich Horst Opaschowski bewusst und versucht, eine alternative Definition von Freizeit anzubieten.84 Horst Opaschowski85 propagiert dabei sehr stark einen positiven Freizeitbegriff, der sich nicht aus der Dichotomie Arbeitszeit – Freizeit ableiten soll, sondern er führt den Begriff der Lebenszeit als übergeordnete Kategorie ein und unterscheidet dann Zeitverwendung gemäß den Graden der Selbstbestimmung. Bezugspunkt ist somit das Subjekt.
Von Horst Opaschowski stammt auch die Einteilung der Lebenszeit in:
(a) Obligationszeit
(b) Determinationszeit
(c) Dispositionszeit86

Abb. 4: Zeitformale Tätigkeitskategorisierung nach dem Lebenszeitmodell Opaschowskis (eigene Grafik, leicht modifiziert nach Markowetz)87
Horst Opaschowski favorisiert den Begriff der „freien Zeit“. Diese sieht er durch den hohen Grad an Dispositionsfreiheit, die ein hohes Maß an individueller Entscheidungsfreiheit, Wahl- und Handlungsmöglichkeiten impliziert, bestimmt.88
Nach seinem Modell würde Freizeit in der Regel mit der Dispositionszeit, Erwerbsarbeit mit der Determinationszeit und alltägliche Notwendigkeiten oder Verpflichtungen mit der Obligationszeit landläufig assoziiert werden.
Diese Kategorisierung mag auf den ersten Blick plausibel erscheinen, kann aber bei genauerer Betrachtung nur bedingt standhalten. So wird z.B. leicht übersehen, dass die Übergänge zwischen der Determinations-, Obligations- und Dispositionszeit fließend sein können und letztlich die Motivation und das Erleben des Individuums in der konkreten Situation die Zuordnung bestimmt.89
Eine kritische Rezeption findet sich bei Florian Carius und Björn Gernig. Hier wird sowohl die unzureichende Weiterentwicklung des Lebenszeitmodells beklagt als auch auf Unschärfen im Konzept der Dispositionszeit verwiesen und eine unzulässige Verkürzung der Selbstverwirklichung auf die freie Zeit.90
Bodo Lippl verweist noch auf Ansätze von Sebastian de Grazia (1917–2000)91 und Josef Pieper (1904–1997)92, die er, Heinz-Günter Vester (*1955)93 folgend, zu den humanistisch orientierten Modellen zählt. Hier wird an dem Muße-Begriff der Antike und der Idee der Kontemplation angesetzt und die philosophische Frage eines guten Lebens verfolgt. Bodo Lippl wirft als Kritikpunkt die Transferfrage in die Gegenwart auf und das Problem der Normativität bzw. Wertbeladenheit.94 Dem ist entgegenzuhalten, dass die normative Problematik auch heute besteht. Allerdings wird dies wenig thematisiert.
Diese Darstellung kann nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben, vielmehr gibt sie einen Einblick in den Diskurs und die Schwierigkeiten, eine angemessene allgemeine Definition von Freizeit zu finden. Es ist deutlich geworden, dass die Definitionen in engem Zusammenhang mit dem historischen Verständnis von Freizeit stehen und dem aktuellen Phänomen „Freizeit“ gerecht werden müssen.
Freizeit wird von den Vertretern positiver Definitionsansätze zum eigenwertigen Lebensbereich erhoben und erfährt eine Aufwertung. Viele Menschen verbinden mit dem Freizeitbegriff positive Assoziationen.
Dass Freizeit auch heute ein gesellschaftliches Phänomen darstellt, indem sich durchaus auch Probleme abzeichnen, zeigt sich u.a. daran, dass Freizeit sogar in der Kriminologie ein Thema ist. In seinem Werk „Kriminologie: eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen“ (2011) widmet sich Hans Dieter Schwind (*1936) dem Phänomen „Freizeit“. Zugleich konstatiert er, dass es in der Kriminologie relativ wenige empirische Studien zum Freizeitbereich gibt.95
2.2 Naive und kritische Aspekte einer Freizeitpädagogik
Das eigene Verständnis von Freizeit und die zugleich mitschwingenden Assoziationen zu generalisieren, entspräche sicherlich einem naiven Verständnis von Freizeitpädagogik. Ebenso verkürzt wäre die unkritische Übernahme jener Positionen zur Freizeit, wie sie in aktuellen Werken dargestellt wird. Das eigene kritische Denken bleibt bei deskriptiven Darstellungen vielfach außen vor, Definitionen werden absolut gesetzt und die eigene Verwobenheit in den gegenwärtigen Diskurs wird nicht erkannt. Auch wäre es naiv, die historischen Kontexte auszublenden oder gegenwärtige Entwürfe absolut zu setzen.
Ein Mangel an kritisch-reflexivem Denken bedingt leicht, dass Vereinnahmungstendenzen nicht erkannt werden, und es eine sehr starke Tendenz gibt, auf den direkten Nutzen und die Verwertungsmöglichkeiten zu schauen. Nicht selten kommt bei Pädagogikstudenten der Wunsch auf, eine Art „Rezeptologie“ an die Hand zu bekommen und eine Theorievermittlung derart zu erfahren, dass eine unmittelbare Umsetzung in der Praxis erfolgen kann. Der Wunsch nach einem direkten praktischen Nutzen der Auseinandersetzung mit Theorie besteht sicherlich, verbunden mit der Intention, durch konkrete Handlungsempfehlungen Zeit und Kraft zu sparen, wenn man in der Praxis steht.
Bei dem Thema „Freizeit“ sieht es diesbezüglich nicht anders aus, jedoch kommt hier noch stärker die Frage der Wirtschaftlichkeit hinzu, d.h. inwiefern sich hier lukrative Berufsmöglichkeiten und neue Berufszweige ergeben könnten. Dies führt vielfach zu einer verkürzten Sicht auf Freizeit, die so einer zunehmenden Kommerzialisierung preisgegeben wird und Gefahr läuft, ideologisch vereinnahmt oder zumindest auf konkrete Handlungsfelder reduziert zu werden.
Grundsätzlich wäre hier der Theorie-Praxis-Zusammenhang kritisch zu reflektieren. Dabei wird deutlich, dass die Annahme, Theorie ließe sich unmittelbar in die Praxis übersetzen, eine naive Lesart (freizeit-)pädagogischer Theorie ist.
Karl-Heinz Dammer96 diskutiert das Theorie-Praxis-Verhältnis unter einer kritischen, historisch-philosophischen Perspektive. Er rekurriert hierzu auf den griechischen Begriff der θεωρία – theoría nach Aristoteles (384 v.Chr.–322 v. Chr.).
Aristoteles differenziert zwischen den praktischen und den theoretischen Wissenschaften.97 Theoria meint im Griechischen die „Gottesschau“98, es geht um das Schauen des Ewigen und Wahren. Wissenschaft und Praxis waren somit getrennte Bereiche nach aristotelischem Verständnis.99 (vgl. hierzu Kap. 3.1.2)
Der Theologe Thomas Böhm (*1964) beschreibt diesen Umstand wie folgt:
„Theoretisch ist nämlich im aristotelischen Sinne diejenige Wissenschaft und diejenige Betrachtung der Dinge, die nicht Mittel zu etwas anderem ist, sondern allein um ihrer selbst willen besteht, d.h. sie ist ein Wissen um des Wissens willen. Damit ruht sie nicht auf Notwendigkeiten des Lebensvollzugs. Voraussetzung der θεωρία ist die Muße, die sich gegen ein ständiges Sich-Verlieren an das Mannigfache richtet. Denkendes Betrachten ist um seiner selbst willen, das heißt, es sucht nichts außerhalb seiner selbst und ist folglich auch frei: In sich seiend ist es nur um seiner selbst willen.“100
Bereits hier wird eine Distanz zur Praxis erkennbar, die die Voraussetzung der Theorie bildet. Ohne Distanz und eine Beobachterperspektive, mit der sich die Freisetzung vom direkten Handlungszwang verbindet, wäre keine theoretische Erkenntnis möglich. Karl-Heinz Dammer verdeutlicht dies an der Anekdote zu Thales von Milet (um 750 v. Chr.), der ein freier Bürger der griechischen Polis war101: Thales von Milet wandelt meditierend – den Blick auf den Himmel gerichtet – in seiner Heimatstadt umher und stolpert in eine Grube, woraufhin er von einer Magd ausgelacht wird.
Dies versinnbildlicht, dass das theoretische Schauen nicht automatisch den Menschen zum praktischen Handeln befähigt. Dennoch wurde die θεωρία in der griechischen Polis hochgeschätzt und nur den freien Bürgern, die aus dem täglichen Arbeitsprozess freigesetzt waren, kam die Muße zur Theoria zu.
Für den Erziehungswissenschaftler Karl-Heinz Dammer (*1959) ist diese Freistellung aus dem Arbeitszusammenhang ein Privileg, das bereits auf die unterschiedlichen Ebenen von Theorie und Praxis verweist, darauf, dass „die Theorie als Reflexionsinstanz der Praxis verpflichtet ist“102, aber zugleich die Distanz voraussetzt und weder die Praxis ein Mitspracherecht bei der Theorie habe, noch der Theoretiker direkten Einfluss darauf habe, „wie Praktiker im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten, Handlungslogiken, Normen und Zielsetzungen sich welche theoretischen Erkenntnisse nutzbar machen“103.
Dieses antike Verständnis zum Theorie-Praxis-Verhältnis wandelte sich in der Neuzeit: Wissenschaft wurde als Werkzeug zur Gestaltung und Veränderung der Natur und der gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen. Die rationale Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der Welt sollte diese beherrschbar machen.
Dieses neue Wissenschaftsverständnis findet sich bei dem englischen Philosophen Francis Bacon (1561–1626) in seinem Werk „Novum Organon“ (1620), das auch dem Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius (1592–1670) bekannt war und dessen Denken beeinflusst hat. Das Credo „Wissen ist Macht“ dürfte heute den meisten bekannt sein, weniger geläufig ist, dass sich diese Idee bis auf Francis Bacon zurückführen lässt.104 Der französische Philosoph, Naturwissenschaftler und Mathematiker René Descartes (1596–1650) verfasste den, in seinen Essays 1637 veröffentlichten, „Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences“, in dem er die „more geometrico“ – als Heilsweg der Erkenntnis preist.105
Der Fortschrittoptimismus wird spürbar und die Hoffnung wächst, mit theoretischen Einsichten und der Wissenschaft die Welt zu beherrschen und zu verändern. Der menschlichen Vernunft kam hierbei eine Schlüsselstellung zu, womit Bildung zu einem wesentlichen Moment der Weltverbesserung und der Sicherung von Frieden zugesprochen wird. Theorie sollte nach diesem Verständnis die Praxis anleiten und verbessern. Eine technologische Machbarkeitsutopie und ein Fortschrittsoptimismus kam auf, der spätestens seit der „Aufklärung der Aufklärung“ gedämpft wurde.
Auch heute besteht bei Berufsanfängern und Laien, aber auch Praktikern die sich als Wissenschaftler sehen möchten, vielfach das Wunschbild, praktische Erfahrungen verallgemeinern und als Erfahrungswissen tradieren zu können oder aus den theoretischen Erkenntnissen direkte Handlungsanleitungen für die Praxis ableiten zu können. Es wird nach Gewissheit, einfacher Orientierung und Sicherheit gesucht, die das Handeln legitimiert.
Auch die empirische Unterrichtsforschung mag zu solcher verkürzten Sicht verleiten und die moderne Hirnforschung führt gegenwärtig zu einer Renaissance des bereits im 19. Jahrhundert geführten Diskurses zum Theorie-Praxis-Verhältnis.106
Doch spätestens seit der Studie des amerikanischen Soziologen Robert Dreeben107, der sich mit den verborgenen, nicht intendierten Lerneffekten der Institution Schule befasste, hat der Terminus „Technologiedefizit“ Einzug in den pädagogischen Diskurs gehalten.108 Kaum ein Erziehungswissenschaftler – auch kein Empiriker – wagt es heute noch von linearen Kausalzusammenhängen zu sprechen. Diesen Machbarkeitsmythos zu brechen, half nicht zuletzt die systemtheoretische Perspektive, wie sie von Niklas Luhmann (1927–1998) in den Diskurs eingebracht wurde. Niklas Luhmann und Karl-Eberhard Schorr109 betonen bereits Ende der 1970er-Jahre, dass Unterricht „in eigentümlicher Weise autonom sei“.110
Details
- Seiten
- 726
- Erscheinungsjahr
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631922002
- ISBN (ePUB)
- 9783631922019
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921708
- DOI
- 10.3726/b22014
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2024 (Oktober)
- Schlagworte
- Selbst Selbstaktualisierung Soziokulturelle Animation Freizeitgestaltung Freizeitbedürfnisse Gesundheit Erholung Freizeit Bildung Freizeitbildung Reflexion Persönlichkeit Persönlichkeitsbildung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024., 726 S., 93 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG