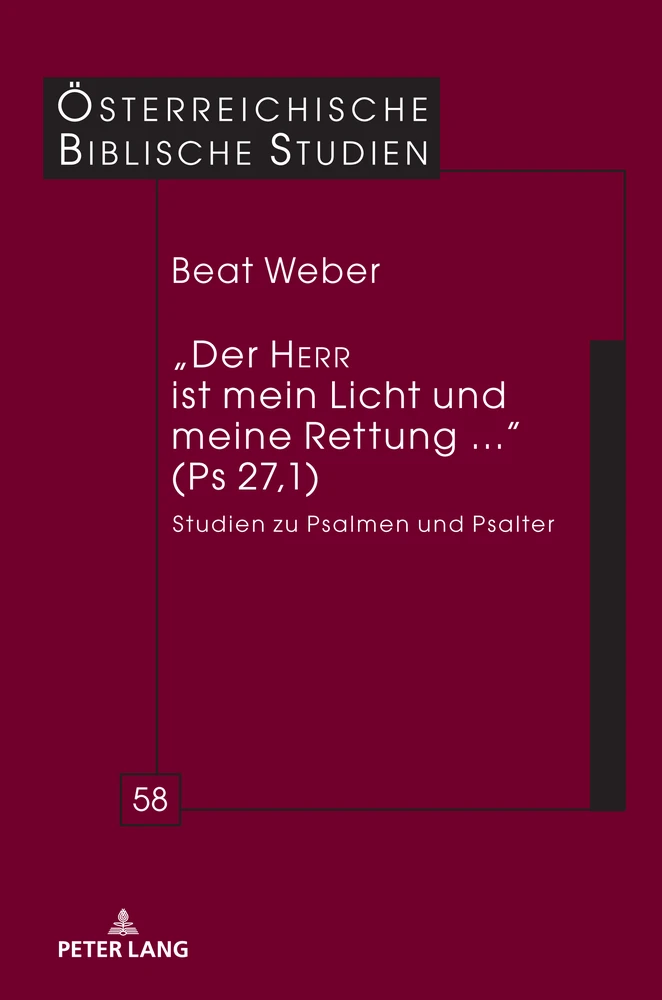„Der HERR ist mein Licht und meine Rettung ...“ (Ps 27,1)
Studien zu Psalmen und Psalter
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- I. Psalmenkommunikation und Redekonstellationen
- I.1 Von der Beherzigung der Tora Jhwhs (Ps 1,2) zur Darbringung der Tehilla Jhwhs (Ps 145,21). Erkundungen und Erwägungen zum Psalter als Lehre und Lob
- I.2 „Ich bewirke Rettung …“ (Ps 12,6). Kommunikationsanalytische Untersuchung zu Psalm 12
- I.3 Notizen zu Form, Pragmatik und Struktur von Psalm 16
- I.4 „Gewiss, du, Herr, bist meine Zuflucht!“ (Ps 91,9). Beobachtungen zu den Redevollzügen und ihrer Konfiguration sowie zur Nachgeschichte von Psalm 91
- I.5 Spott und Ironie in den Psalmen. Eine erste Sichtung
- I.6 „Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott!“ (Ps 3,3). Direkte Rede von und an „Widersacher(n)“ in den Psalmen
- II. Zu den Psalmen 25–34 und ihrer Konfiguration
- II.1 „Um zu schauen auf die Lieblichkeit des Herrn …“ (Ps 27,4). Ein neues Gesamtverständnis von Psalm 27
- II.2 “The Lord is my Light and my Salvation …” (Ps 27,1). Psalm 27 in the Literary Context of Psalms 25–34
- II.3 Die Psalmen 25–34 in den Qumran-Handschriften und im Masoretischen Text. Untersuchungen zu Textgestalt, Überlieferung und Komposition
- II.4 „Ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit …“ (Ps 34,2). Die Psalmen 25–34 als Kleinkomposition in Verbindung mit hermeneutisch-methodischen Überlegungen zur „Psalterexegese“
- III. Psalter, Kanon und Theologie
- III.1 Psalm 1 and Its Function as a Directive into the Psalter and Towards a Biblical Theology
- III.2 Meint die Tora Jhwhs in Psalm 1,2 (auch) den Psalter? Erkundungen zur Reichweite des Tora-Begriffs
- III.3 „An dem Tag, als Jhwh ihn rettete aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls“ (Ps 18,1). Erwägungen zur Anordnung der biographischen Angaben zu David im Psalter
- III.4 “At the Time when Yhwh Delivered Him out of the Palm of all His Enemies and out of the Hand of Saul” (Ps 18,1). From David in the Book of Samuel to David in the Book of Psalms and Back Again
- III.5 Das königlich-davidische Danklied 2. Samuel 22 / Psalm 18 im Kontext von Psalm 1–18. Eine (proto-)kanonische Lesung vom Ende der Samuelbücher her zum Anfangsbereich des Psalters hin
- III.6 „Gelobt sei der Herr, mein Fels …!“ (Ps 144,1). Wirkung und Bedeutung von Psalm 18 (// 2. Samuel 22) im Nachfeld des Psalters
- III.7 Moses, David and the Psalms. The Psalter in the Horizon of the “Canonical” Books
- IV. Verschiedenes
- IV.1 Halleluja, der Feind ist vernichtet!? Was „Rachepsalmen“ uns sagen – (un)zeitgemässe Überlegungen
- IV.2 „Ein neues Lied“
- IV.3 „Ausgang und Eingang, Anfang und Ende …“ Fragmente zu musikalischen und biblischen Ein-, Über- und Ausgängen
- IV.4 Verzeichnis der Veröffentlichungen des Verfassers zu Psalmen, Psalter und bibelhebräischer Poesie
I.1 Von der Beherzigung der Tora Jhwhs (Ps 1,2) zur Darbringung der Tehilla Jhwhs (Ps 145,21). Erkundungen und Erwägungen zum Psalter als Lehre und Lob*
Abstract: After a brief review of past research on exegetical methods and current attempts to formulate a theology of the Psalter by contemplating the formation of “canon”, this study consid- ers the use of individual psalms as a means to communicate between the faith community, the psalmist and God. Psalm 3 (a tephillah) is used to demonstrate that. Most psalms contain both speech to God (prayer) and speech about God (presupposing an audience) with a pedagogical purpose. This “liturgical” phenomenon poses new questions regarding a (too) one-sided literary point of departure. On the basis of Psalm 1 at the beginning of the book, the Torah aspect of the Psalter is also considered. The conclusion also evaluates the connections with Psalm 145 (a tehillah) and the closing of the book.
„The history of the composition of the Psalter
is an extremely complex one which has not been,
and probably never will be, completely understood.
[Many scholars would agree with this judgment].“1
1. Forschungsstand und Anfragen
1.1 Erich Zenger und die Leuvener Tagung von 2008
Am 57. Colloquium Biblicum Lovaniense (CBL) vom 5.–7. August 2008, das der Komposition des Psalmenbuchs gewidmet war, brachte Erich Zenger die von Frank-Lothar Hossfeld und ihm in einer Vielzahl von Veröffentlichungen vorangetriebene Forschung im Titel seines Hauptvortrags programmatisch auf den Punkt: „Psalmenexegese und Psalterexegese“.2 Und in der Einführung zum Sammelband mit Konferenzbeiträgen schrieb er: „Die Psalmenexegese muss ergänzt werden durch die Psalterexegese, d.h. ein Psalm muss sowohl als Einzeltext als auch als Teiltext des Buchzusammenhangs, in dem er steht, betrachtet werden.“3 Man kann das Hossfeld-Zengersche Programm in folgende Matrix überführen (Skizze):
| Psalmenexegese | + / → | Psalterexegese |
|---|---|---|
| synchron | synchron | |
| diachron | diachron |
Da eine Psalmenexegese unbestritten ist, geht es um die Legitimation und den Stellenwert einer Psalterexegese. Ihr zugrunde liegt die Annahme, dass Einstellung und Platzierung der Psalmen in den Psalter als „Buch“ (in der Gestalt des proto-MT) und damit deren Abfolge und Gruppierung von Bedeutung sind. Ist dem so – und die Vielzahl der Beobachtungen zur Kontiguierung und Gruppierung von Psalmen lassen sich kaum allein der Rezeption (Leseperspektiven) zuweisen – dann ergeben sich gegenüber einer isolierten Betrachtung der Einzelpsalmen Sinnüberschüsse, welche die Psalterexegese zu erheben und bedenken hat. Entsprechend lässt sich dann nicht nur nach einer Theologie der Psalmen fragen, sondern auch nach einer Theologie des Psalters. Diesem Vorhaben, auch eine Psalterexegese und -theologie zu erarbeiten, haben sich Zenger und Hossfeld gewidmet. Psalmen- wie Psalterexegese seien dabei methodisch synchron wie diachron anzugehen. Bei der Psalterexegese ist bei ihnen die Diachronie (Genese) freilich mehr im Blick als die Synchronie (Geltung), die tendenziell unterbelichtet ist. Warum und in welcher Weise eine Psaltertheologie stärker synchron zu akzentuieren ist, habe ich an der genannten Leuvener Tagung mit einem kleinen Beitrag unter der Überschrift „Von der Psaltergenese zur Psalter-theologie“ zu skizzieren versucht.4
1.2 Forschungsstand und gegenwärtige Anfragen
Die 1985 veröffentlichte Dissertation von Gerald Wilson „The Editing of the Hebrew Psalter“ kann als (Neu-)Anfang der Psalterforschung gelten.5 Sie führte zur intensiven Beschäftigung mit dem Psalter in seiner Buchgestalt, sowohl in Nordamerika als auch in Europa. Die zeitähnlich publizierten Sammelbände „The Shape and Shaping of the Psalter“ (1993) und „Neue Wege der Psalmenforschung“ (1994), welche Referate verschiedener Kongresse der Society of Biblical Literature (SBL) enthalten, mögen als Beispiele dienen.6
Nach dem teils frühen Tod der Pioniere und Promotoren der Psalterforschung, Gerald H. Wilson in den USA († 2005), Erich Zenger († 2010) und Frank-Lothar Hossfeld († 2015) in Deutschland (zudem Klaus Seybold † 2011 in der Schweiz und Peter Flint † 2016 in Kanada) hat die Psalterforschung ihre (v.a. durch Erich Zenger eingebrachte) Stosskraft verloren. In der post-Zenger/Hossfeld-Ära ab ca. 2010 werden denn auch vermehrt kritische Anfragen an das Verstehensparadigma einer Psalterexegese gestellt.7 Wenn ich recht sehe, gibt es in den nachfolgend skizzierten (sich teils überlappenden) Bereichen einen Bedarf an Diskussion, Klärung sowie teils Revision und vertiefter Weiterarbeit.8
1.2.1 Der Handschriftenbefund (DSS/Q, MT, LXX)
Die Psalterexegese orientiert sich am (proto-)MT (der in der Regel als zeitlich wie autoritativ vorrangig angesehen wird). Bekanntlich liegen die Psalmen aber – vereinfacht gesagt – in drei Überlieferungsströmen vor: MT, LXX und DSS/Q. Dabei gibt es bereits eine längere Diskussion über das Verhältnis zwischen der Überlieferung des (proto-)MT und der Textfunde aus den Höhlen am Toten Meer (aufgrund des erhaltenen Umfangs v.a. 11Q5 = 11QPsa).9 Angesichts der nun vollständig publizierten Handschriften aus den Höhlen am Toten Meer und der Qumran-Forschung, die sich (wie die zur LXX) zu einem eigenen Forschungszweig entwickelt hat, ergeben sich Anfragen und Kritik an die Psalterforschung. So äussern sich Stimmen, die für eine Multiformität plädieren und sich gegen die Priorität (zeitlich wie normativ) des MT-Psalters richten. Auch das Zwei-Stufen-Modell der Psalterwerdung (Ps 1/2–89 | 90–145/150) und sein Verständnis als (autoritatives) „Buch“ werden in Frage gestellt.10 Kontrovers diskutiert werden u.a. die im MT den Schluss bildenden Psalmen 145/146–150, deren Umfang, Anordnung und Abfolge in den drei Hauptüberlieferungen (teils) unterschiedlich sind.11
1.2.2 Das „Buch“-Verständnis
In jüngerer Zeit mehren sich die Stimmen, die den Psalter nicht als Komposition („Buch“ im engeren Sinne), sondern als Kompilation (Anthologie) beurteilen. In Frage gestellt wird die planvolle (intentionale) Abfolge bzw. Arrangierung der einzelnen Psalmen und – damit verbunden – der mit der Ablauf- bzw. Zusammenlesung verbundene zusätzliche Sinn.12 Im Zusammenhang mit der Frage, ob und inwiefern der Psalter ein „Buch“ ist, spielen Verständnis und Funktion des eröffnenden Psalms (v.a. Ps 1,2) eine wesentliche Rolle.13
1.2.3 Zu Gestalt, Verwendung und Aufführung
Auch das (jedenfalls kontinentaleuropäisch) vorherrschende literarische (nachkultische) Verständnis des Psalters als weisheitlich imprägniertes Meditations- und Lehrbuch und/oder „Volksbuch“14 wird – neuerdings – hinterfragt.15 Dies geschieht namentlich durch Studien, die den Gebets- und Gottesdienstcharakter dabei zu wenig beachtet sehen, das kommunikativ-dialogische Setting herausstellen und sich für ein liturgisches (performatives) Verständnis der Psalmen aussprechen bzw. die Weisheit im Psalter anders akzentuieren.16
1.2.4 Fragestellungen rund um Redaktion, Rezeption, Theologie und „Kanon“
Hierzu gibt es ein ganzes Bündel von Fragestellungen und Standpunkten, wie z.B.: Welche Gruppierungen sind mit Entstehung, Überlieferung und Autorisierung von Psalmen(formationen) und Psalter(gestalten) betraut und welche Anliegen verbinden sie damit?17 Wie ist der Psalter angesichts seiner hohen Intertextualität im Gegenüber zu anderen Bibelbüchern und Schriftteilen zu konturieren?18 Und welche Wirkungen, aber auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede ergeben sich im Blick auf para-biblische (apokryphe) Psalmen und Gebete in der Spätzeit des Zweiten Tempels?19
Jeder der vier genannten Punkte verdiente eine eingehende Erörterung. In meinem Beitrag greife ich vorwiegend Fragestellungen aus den Abschnitten 1.2.3, teils auch 1.2.2 und 1.2.4 auf. Nach wie vor überzeugt von der Legitimität und Wichtigkeit des biblischen Psalters als Komposition und „Buch“, geht es mir um einen Schritt hin zu einer besseren Erfassung seiner Charakteristik.20 Dies geschieht mittels kommunikationsanalytischer Methoden und unter Aufnahme und Weiterführung von Einsichten aus Catherine Petranys Monographie „Pedagogy, Prayer and Praise“ (2015).21 Insofern handelt es sich um eine Weiterarbeit an einer von mir vor einigen Jahren skizzierten „Theologie und Spiritualität des Psalters und seiner Psalmen“.22 Im Blick ist der Psalter insgesamt (MT); die Einsichten werden aber an drei ausgewählten Psalmen (Ps 3 – Ps 1 – Ps 145) festgemacht.
2. Der Psalter als Gottes- und Gemeindekommunikation (Psalm 3)
Wir werfen einen Blick auf Ps 3, der das erste (David-)Präskript bei sich hat.23 Er eröffnet mit einer invocatio Dei, enthält an Gott adressierte Worte und ist das erste Gebet im Psalter. Aber der Psalm ist – typischerweise – nicht nur ein Gebet. Und darum soll er hier bedacht werden. Vorab jedoch einige grundsätzliche Überlegungen zu einer kommunikationsanalytischen Exegese der Psalmen.
2.1 Einführende Erläuterungen zu den Sprechvorgängen in den Psalmen
Die biblischen Psalmen sind praktisch durchgängig „Reden“.24 Entsprechend sind die kommunikativen Vorgänge, Sprechrichtungen sowie die involvierten Sprechenden und Angesprochenen relevant.25 Bei einer kommunikationsorientierten Exegese lassen sich methodisch drei Kommunikationsebenen unterscheiden. Die involvierten Kommunikationspartner sind allerdings nur teilweise markiert bzw. bestimmbar. Zwischen den Ebenen können sich zudem komplexe Interaktionen sowie Überlagerungen einstellen, und es sind Mehrfachadressierungen möglich:26
1. Die Kommunikationsebene zwischen den im Text vorkommenden, sprechenden (nicht mit dem Hauptsprecher selbst identischen) Personen und denjenigen, die diese adressieren.27 2. Die Kommunikationsebene des/der im Text Sprechenden und der im Text Angesprochenen (textinterner „Autor“ bzw. „Adressat“).28 3. Die Kommunikationsebene des „realen“ Verfassers und der „realen“ (Erst-)Empfänger (textexterner „Autor“ bzw. „Adressaten“).29 Zudem ist 4. im Blick auf die dargestellten Inhalte bzw. Geschehnisse gegebenenfalls zwischen einem realen, sozio-historischen bzw. kultischen (textexternen) Setting (Sitz im Leben) und einem textlich dargestellten (textinternen, möglicherweise fiktiven) Szenario zu unterscheiden.30
Vom Sprechakt eines „Gebets“ (im engeren Sinn) sprechen wir dann, wenn der Rede-Modus in der 2. Person („du“) geschieht und Gott angesprochen wird. Von solchem Reden zu Gott sind Sprechakte in der 3. Person („er“) zu unterscheiden, in denen über Gott gesprochen wird.31 Letztere konstituieren ein Kommunikationsgefüge, bei dem eine oder mehrere Person(en) als Zuhörer – zumindest virtuell bzw. textintern – vorausgesetzt sind.32 Ein Wechseln zwischen der 2. und der 3. Person ist in der Psalmenrede häufig. Mit diesem Sprechrichtungswechsel sind unterschiedliche Sprechakte und Funktionen verbunden. Ist die an Gott adressierte Rede in 2. Pers. als „Gebet“ zu charakterisieren, so hat die (implizit oder explizit) an Menschen gerichtete Rede in 3. Pers. oft lehrhaften Charakter. Redeformen des „Bekennens“ oder „Schilderns“ können in 2. oder in 3. Pers. formuliert und entsprechend unterschiedlich adressiert sein. Zudem bietet die (Psalmen-)Sprache die Option der Mehrfachadressierung, wobei sekundär Angesprochene deutlich oder unterschwellig vorliegen können. So ist ein öffentlich gesprochenes oder wie in den Psalmen verschriftetes Gebet (und im Psalter ediertes, eingebettetes Gebet) zwar an Gott gerichtet, sekundär aber auch an menschliche Adressaten (sie zum Mitbeten einladend o.ä.). Gegenläufig zu dieser Gebetsrede coram publico ist – gerade in den Psalmen – auch mitmenschlich adressierte Rede coram Deo in Betracht zu ziehen. Geht es um das gemeinsame Sprechen eines Gebets, kommt eine weitere Ebene insofern hinzu, als „Ich“- und „Wir“-Äusserungen der Psalmen Identifizierungen ansteuern und ermöglichen. Ein komplexer Sprechakt ist schliesslich das Segnen, bei dem sowohl Gott als Geber wie auch die Empfangenden (vom Sprecher) einbezogen werden.33
2.2 Text und Übersetzung von Psalm 334
| 1 | מִזְמֹ֥ור לְדָוִ֑ד בְּ֝בָרְחֹ֗ו מִפְּנֵ֤י׀ אַבְשָׁלֹ֬ום בְּנֹֽו׃ | Ein Psalm – David zugehörig – als er floh vor Absalom, seinem Sohn. | ||
| I | A | 2 a | יְ֭הוָה מָֽה־רַבּ֣וּ צָרָ֑י | Herr, wie sind viele geworden meine Bedränger, |
| 2 b | רַ֝בִּ֗ים קָמִ֥ים עָלָֽי׃ | viele [sind es, die] aufstehend gegen mich! | ||
| 3 a | רַבִּים֮ אֹמְרִ֪ים לְנַ֫פְשִׁ֥י | Viele [sind es, die] sagend in Bezug auf meine Person: | ||
| 3 b | אֵ֤ין יְֽשׁוּעָ֓תָה לֹּ֬ו בֵֽאלֹהִ֬ים סֶֽלָה׃ | „Es gibt keine Rettung [mehr] für ihn durch Gott!“ Sela. | ||
| B | 4 a | וְאַתָּ֣ה יְ֭הוָה מָגֵ֣ן בַּעֲדִ֑י | Aber du, Herr, [bist] ein Schild um mich herum, | |
| 4 b | כְּ֝בֹודִ֗י וּמֵרִ֥ים רֹאשִֽׁי׃ | meine Ehre und emporhebend mein Haupt. | ||
| II | A | 5 a | קֹ֭ולִי אֶל־יְהוָ֣ה אֶקְרָ֑א | Laut („meine Stimme“), zum Herrn, rief ichwiederholt, |
| 5 b | וַיַּֽעֲנֵ֨נִי מֵהַ֖ר קָדְשֹׁ֣ו סֶֽלָה׃ | da antwortete er mir von seinem heiligen Bergeher. Sela. | ||
| 6 a | אֲנִ֥י שָׁכַ֗בְתִּי וָֽאִ֫ישָׁ֥נָה | Ich, ich legte mich nieder und fiel in Schlaf; | ||
| 6 b | הֱקִיצֹ֑ותִי כִּ֖י יְהוָ֣ה יִסְמְכֵֽנִי׃ | ich erwachte, denn der Herr stützt mich. | ||
| B | 7 a | לֹֽא־אִ֭ירָא מֵרִבְבֹ֥ות עָ֑ם | Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden an[Kriegs-]Volk, | |
| 7 b | אֲשֶׁ֥ר סָ֝בִ֗יב שָׁ֣תוּ עָלָֽי׃ | die ringsum sich aufgestellt haben gegen mich. | ||
| III | A | 8 a | ק֘וּמָ֤ה יְהוָ֨ה׀ | Steh bitte auf, Herr! |
| 8 b | הֹושִׁ֘יעֵ֤נִי אֱלֹהַ֗י | Rette mich, mein Gott! | ||
| 8 c | כִּֽי־הִכִּ֣יתָ אֶת־כָּל־אֹיְבַ֣י לֶ֑חִי | Denn geschlagen hast du alle meine Feinde [bezüglich der] Kinnbacke, | ||
| 8 d | שִׁנֵּ֖י רְשָׁעִ֣ים שִׁבַּֽרְתָּ׃ | [die] Zähne der Frevler hast du zerbrochen gemacht. | ||
| B | 9 a | לַיהוָ֥ה הַיְשׁוּעָ֑ה | Beim Herrn [ist/wird sein] die Rettung! | |
| 9 b | עַֽל־עַמְּךָ֖ בִרְכָתֶ֣ךָ סֶּֽלָה׃ | Auf dein Volk [komme/kommt] dein Segen! Sela. |
2.3 Kommunikationsvorgänge in Psalm 3 im Überblick
| 2–4 | GEBET I | GEGENWART | |
| 2–3 | Bittgebet (ich → du) | ||
| • Anrufung Gottes I | |||
| • Beschreibung der Not (sie) | |||
| • „Zitat“: Feindworte (sie → ich) | |||
| 4 | Bekenntnis I (ich → du) | ||
| • Kontrastive Eröffnung | |||
| • Anrufung Gottes II | |||
| • Beteuerung des Vertrauens und des Schutzes | |||
| 5–7 | GEBETSERFAHRUNG UND GOTTESHILFE | VERGANGENHEIT | |
| 5 | Schilderung I | ||
| • Wiederholtes, lautes Beten (ich → er) | |||
| • Antwort Gottes (er → ich) | |||
| 6 | Schilderung II | ||
| • Niederlegen zum Schlafen (ich) | |||
| • Aufwachen → göttliche Hilfe (er → ich) | Vergangenheit → Gegenwart | ||
| 7 | Bekenntnis II (ich) | ||
| • Beteuerung der Abwesenheit von Furcht | (Vergangenheit →) Gegenwart | ||
| • Angesichts/trotz zahlreicher Widersacher | Gegenwart ← Vergangenheit | ||
| 8–9 | GEBET II | GEGENWART | |
| 8ab | Bittgebet II (ich → du) | ||
| • Anrufung Gottes III + IV | |||
| • Appell einzugreifen | |||
| 8cd | Schilderung III (du → sie) | Vergangenheit (→ Gegenwart) | |
| • Verbindung zum Bittgebet (denn) | |||
| • Eingreifen Gottes gegen Feinde | |||
| 9 | Bekenntnis III (mit einem Segenswunsch schliessend) | Gegenwart (/ Zukunft) | |
| • Zuspruch/Ankündigung der Rettung (er) | |||
| • Zuspruch/Ankündigung des Segens (es ← du) |
2.4 Fazit der kommunikationsanalytischen Erarbeitung von Psalm 3
Psalm 3 ist ein Gebet, näherhin eine תפלה „Klagebitte“ (mit Gottesanrufung, Leidschilderung und Zuversichtsäusserung). Das Gebet enthält neben der vorherrschenden vertikalen Kommunikationsachse (↑) freilich auch Aussagen mit horizontaler Adressierung (→). Die schildernde „Er“-Rede über Gott ist coram Deo gesprochen, dient der Selbstvergewisserung und führt ein Gott motivierendes Moment mit sich. Die Schilderung und das bilanzierende Bekenntnis des Sprechenden lassen ein menschliches Gegenüber erwarten (ein Selbstgespräch ist nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich). Diese menschlichen Adressaten werden im Psalm selbst nicht hinreichend erkennbar; gewisse Hinweise finden sich im Präskript, das paratextlich einen Interpretationshorizont für ein neues Hören und Wiederverwenden in einer Gemeinschaft aufspannt. Der Psalm kehrt nach dem Rekurs auf ein früheres Ereignis in 5–7 zur Gegenwart und zum Beten zurück. Dabei wird in 8cd – wie zuvor im „Er“-Modus des Schilderns und Bekennens (5–7) – auf frühere Erfahrung zurückgegriffen.35
Der Schluss in 9ab mit den beiden Nominalsätzen ist kommunikativ auffällig (und wird oft als sekundär beurteilt). In 9a wird neuerdings nicht zu Jhwh, sondern von ihm gesprochen. Die Aussage oszilliert zwischen einem Fazit (Bekenntnis der Zuversicht) aus den in 5–7 vorgetragenen Rettungserfahrungen und einer auf die Zukunft bezogenen Vergewisserung, die sich aus dem in 8 geäusserten Gebet ergibt. Als Sprecher kommt das redende „Ich“ (vom Präskript her gelesen: David) oder aber eine anwesend zu denkende Gemeinschaft in Frage. Obwohl kein Sprecherwechsel markiert wird, halte ich es für wahrscheinlich, dass das Gottesvolk in 9a auf die Gebetsworte und Schilderungen des sprechenden „Ich“ (David) antwortet und sie in Anspruch nimmt.
Aufgrund der auf Jhwh zu beziehenden Bezeichnung „dein Volk“ liegt in 9b ein letzter, freilich nur schwacher Wechsel zum Gebet vor. Als Sprecher kommen in Frage: 1. (wiederum) das (davidische) „Ich“ (für das Volk), 2. das (liturgisch als anwesend zu denkende) Gottesvolk – dies scheint mir am wahrscheinlichsten – oder 3. eine dritte Person, etwa eine priesterliche Stimme, die auf das Rettungsbekenntnis hin die Gemeinde mit dem Segen entlässt. Die Erwähnung des Volkes in der Schlusszeile stützt jedenfalls die Annahme – und darauf liegt mein Hauptaugenmerk –, dass in den implizierten Adressaten der Schilderung von 5–7 auch das (versammelte) Gottesvolk zu sehen ist. Ist dem so, liegt hier eine Überschreitung von der textlichen auf die aussertextliche Wirklichkeit bzw. eine „Hereinholung“ derselben vor (vgl. ähnlich beim finalen Makarismus in Ps 2,12). Vers 9 verstärkt jedenfalls eine kollektivierende relecture des „Ich“-Psalms.36
2.5 An Gott wie auch an die Gemeinde adressiertes Reden in den Psalmen
Im recht einfachen und kurzen Ps 3 liegt ein kommunikatives Setting vor, das nicht nur von einem zum Herrn sprechenden Beter ausgeht, sondern auch eine teilnehmende, wenn auch im Hintergrund bleibende Gemeinschaft voraussetzt, die angesprochen wird und möglicherweise (in 9b) auch selbst zu Gott spricht. Vom Präskript her gelesen, ist es das mit David dem Herrn treu bleibende Israel. Im Psalm findet ein mehrfacher Redewechsel statt; zudem sind an Gott und an die Gemeinde adressierte Reden miteinander verknüpft.
Diese am ersten Gebet im Psalter festgestellte Beobachtung ist für die biblischen Psalmen keineswegs nebensächlich, sondern so grundlegend wie zentral. Die Mehrzahl aller Psalmen weist wie Ps 3 einen Wechsel zwischen der Anrede Gottes im Gebet und einer zwischenmenschlichen Kommunikation auf. Unter Heranziehung und Auswertung der kommunikationsanalytischen Psalmenübersetzung von Andreas Ruwe37 ergibt sich prima vista folgender Gesamtbefund:
| Psalter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Psalmen | NUR Gebet38 | MIT Gebet | OHNE Gebet | Bemerkungen |
| 001–041 | 3 + (5) Pss | 25 Pss | 8 Pss | Ca. 4/5 der Psalmen enthalten Gebetsworte (Du-Anreden) |
| 042–072 | 5 + (2) Pss | 18 Pss | 6 Pss | Ca. 4/5 der Psalmen enthalten Gebetsworte (Du-Anreden) |
| 073–089 | 4 + (2) Pss | 8 Pss | 3 Pss | Gut 4/5 der Psalmen enthalten Gebetsworte (Du-Anreden) |
| 090–106 | 0 + (1) Pss | 10 Pss | 6 Pss | Ca. 2/3 der Psalmen enthalten Gebetsworte (Du-Anreden) |
| 107–150 | 1 + (3) Pss | 19 Pss | 21 Pss | Gut 1/2 der Psalmen enthalten Gebetsworte (Du-Anreden) |
| 001–150 | 13 + (13) Pss | 80 Pss | 44 Pss | Gut 2/3 der Psalmen enthalten Gebetsworte |
Die Sichtung der hundertfünfzig Psalmen erfolgte nach drei Kategorien: 1. Psalmen, die nur aus Gebetsworten bestehen; 2. Psalmen, die neben Gebetsworten auch andere, nicht an Gott gerichtete Worte enthalten; 3. Psalmen, die keine Gebetsworte enthalten. Als Resultat ergibt sich, dass Psalmen, die wie Ps 3 neben der Gottesanrede Worte enthalten, die sich (meist) an Menschen richten, mit rund 80 Psalmen die mit Abstand grösste Gruppe im Psalter darstellen. Mit Ausnahme des letzten Teilbuchs, wo die Psalmen ohne Gebetsworte (im engeren Sinn) leicht überwiegen, stellen die Psalmen mit einer Mischung von Gebets- und anderen Worten auch in den einzelnen Teilbüchern die Mehrheit dar. In den meisten Fällen ist dabei eine Zuhörerschaft bzw. (gottesdienstliche) Gemeinschaft mitgedacht. Manchmal wird aufgrund direkter Anrufe (z.B. in den Hymnen) auch deutlich, um wen es sich handelt.
Die (meisten) Psalmen und damit das Psalmenbuch insgesamt haben folglich ein dialogisches Gepräge mit unterschiedlichen Rednern und Angesprochenen. Dieser häufige Wechsel hat (zunächst) auf der Textebene Einfluss darauf, was die Psalmen innerhalb des Psalters sind und bewirken wollen. Es ist anzunehmen, dass die an bzw. in den Psalmen festgestellten Sprechformen auch Hinweise auf ihre Performanz und Verwendung mit sich führen. Dabei wird man zwischen Einzel-, Gruppen- und „Buch“-Verwendung(en) unterscheiden müssen. Was die im Psalter gesammelten Psalmen angeht, vermag die auf die beiden L-Label gebrachte Opposition von literarisch und liturgisch m.E. den Sachverhalt nicht hinreichend zu fassen.39 Von anderen Überlegungen her spricht Bernd Janowski für die Zeit des Zweiten Tempels angemessener von einem Neben- und z.T. auch Ineinander von Kult- und Buchreligion und in der Tendenz von einer Transformation (Metaphorisierung) des Kultischen.40 Die musikalischen Angaben in den Präskripten lassen auch eine (Re-)Liturgisierung in Betracht ziehen.41 Der komplexe Sachverhalt kann hier nicht weiter bedacht werden und bedarf weiterer Überlegungen.42 Gegenüber dem in Kontinentaleuropa dominierenden literarischen Verständnis43 hält eine kommunikationsanalytische Sichtweise den Redecharakter und die enge Verbindung von Gott- und Menschenadressierung, von Gebet und Einsicht/Belehrung44 verstärkt im Blick. Dabei ist weniger die Herkunft als die „Zukunft“ und d.h. die (Wieder-)Verwendung im Fokus. Hinsichtlich der genannten Doppelheit von Worten, die an Gott, und solchen, die an Mitmenschen gerichtet sind, ist an dieser Stelle auf eine Monographie mit dem bezeichnenden Titel „Pedagogy, Prayer and Praise“ hinzuweisen.45 Aus diesem anregenden Beitrag der neueren Psalmen- und Psalterforschung sollen nachfolgend einige Einsichten aufgegriffen und da und dort weiterentwickelt werden. Dies soll anhand des Eröffnungspsalms geschehen. Stand in Ps 3 das Gebet im Vordergrund, so handelt es sich bei Ps 1 um eine weisheitliche Belehrung.
3. Den Psalter als die Weisung Jhwhs verstehen und beherzigen (Psalm 1)46
3.1 Der Psalter in seiner genuinen Verbindung von Weisheit und Gebet
Catherine Petrany zeigt anhand eines Vergleichs des Psalters mit den Büchern Proverbia und Ben Sira auf, dass der Psalter von einem genuin eigenen Gepräge der Weisheit bestimmt ist.47 Es unterscheidet sich von der horizontalen Vater/Sohn- bzw. Lehrer/Schüler-Unterweisung der Proverbia. Mit der Weisheit von Ben Sira haben die Psalmen die Aufnahme von Gebet und Hymnus gemeinsam. Sind dort Belehrung und Gebete aber separiert, so werden im Psalter Weisheit, (Bitt-)Gebet und Hymnus verschränkt. Dies gilt selbst für (Tora-)weisheitlich geprägte Psalmen wie Ps 73, ganz zu schweigen von Ps 119, der abgesehen von den eröffnenden אשרי-Versen durchgehend Gebet (!) ist.48 Petrany schreibt:
„The dominant presence of shifting address in the psalms, from human audience to divine audience, and the relative (though not complete) absence of this kind of shift in sapiential pedagogy, makes this an appropriate framework for inquiring about the functional similarities and differences that mark sapiential and psalmic instruction.“
„Thus, rather than standing distinct from the language of prayer and praise, wisdom in the Psalter provides an essentially ,psalmic‘ mechanism for easing the hearer/you into the role of the ,I‘ and the ,we‘ who turn to God in prayer and praise God within the congregation. In this way, all three levels of interpretation reveal that the primary instructional impact of the Psalter lies in its being verbalized, in these ,texts‘ becoming words that are spoken, and songs that are sung. The lessons of the psalms cannot simply be read or heard and subsequently understood or applied; these are poems that invite their hearers to speak and sing, and thereby to understand, to know, and to relate God’s works to others in the act of praise that conflates the horizontal and vertical aspects of psalmic speech (Ps 145:6) … The teaching psalmist repeatedly draws the audience of the psalms out of the act of individualized listening and into a vertically oriented speaking with a communal dimension.“49
Für die Einschätzung des Psalmenbuchs als Weisheit und Weisung ist Ps 1 und darin insbesondere Vers 2 zentral; mit Scott Jones gesprochen: „The placement of Psalm 1 at the introduction to the Psalter suggests that the meaning of תורה in Ps 1,2 is crucial not only for how one understands this psalm, but also for how one understands the entire Book of Psalms.“50 Daher werfen wir einen Blick auf diesen Psalm.
3.2 Text und Übersetzung von Psalm 1
| I | A | 1 | a | אַ֥שְֽׁרֵי־הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר׀ | Glückpreisungen dem Mann, der |
| b | לֹ֥א הָלַךְ֘ בַּעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים | nicht ging in einer Gemeinschaft von Frevlern | |||
| c | וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֭טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד | und auf einen Weg von Sündern nicht trat | |||
| d | וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֜צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב׃ | und an einem Sitz von Spöttern nicht sass, | |||
| B | 2 | a | כִּ֤י אִ֥ם בְּתוֹרַ֥ת יְהוָ֗ה חֶ֫פְצ֥וֹ | sondern an der Weisung des Herrn seine Lust [hat] | |
| b | וּֽבְתוֹרָת֥וֹ יֶהְגֶּ֗ה יוֹמָ֥ם וָלָֽיְלָה׃ | und in seiner Weisung murmelnd sinnt bei Tag und Nacht! | |||
| C | 3 | a | וְֽהָיָ֗ה כְּעֵץ֘ שָׁת֪וּל עַֽל־פַּלְגֵ֫י מָ֥יִם | Dann wird er sein wie ein Baum, (ein)gepflanzt an Wasserrinnen, | |
| b | אֲשֶׁ֤ר פִּרְי֙וֹ׀ יִתֵּ֬ן בְּעִתּ֗וֹ | der seine Frucht bringen wird zu seiner Zeit, | |||
| c | וְעָלֵ֥הוּ לֹֽא־יִבּ֑וֹל | und sein Laub wird nicht welken. | |||
| d | וְכֹ֖ל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂ֣ה יַצְלִֽיחַ׃ | Ja, [in] allem, was immer er tut, wird er Gelingen erfahren. | |||
| II | A | 4 | a | לֹא־כֵ֥ן הָרְשָׁעִ֑ים | Nicht so die Frevler; |
| b | כִּ֥י אִם־כַּ֜מֹּ֗ץ | sondern wie die Spreu [sind sie], | |||
| c | אֲשֶׁר־תִּדְּפֶ֥נּוּ רֽוּחַ׃ | die (sie) verwehen wird ein/der Wind. | |||
| B | 5 | a | עַל־כֵּ֤ן׀ לֹא־יָקֻ֣מוּ רְ֭שָׁעִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט | Deshalb: Nicht aufzustehen vermögen Frevler im Gericht | |
| b | וְ֜חַטָּאִ֗ים בַּעֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים׃ | und Sünder in einer Versammlung von Gerechten. | |||
| III | 6 | a | כִּֽי־יוֹדֵ֣עַ יְ֭הוָה דֶּ֣רֶךְ צַדִּיקִ֑ים | Gewiss, kennend [ist] der Herr [den] Weg von Gerechten. | |
| b | וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד׃ | aber [der] Weg von Frevlern wird sich verlieren. |
3.3 Bemerkungen zum Psalter als (Weg-)Weisung, ausgehend von Ps 1,251
Dazu folgende Ausführungen, gegliedert unter acht Aspekten:
- 1. Die Rede in Ps 1 ist durchgehend menschlich adressiert. Sie ist weisheitlich- belehrend (kein Gebet). Die Identitäten des Sprechers wie des/der Angesprochenen bleiben im Hintergrund. Die Worte sind charakterisiert durch eine Verbindung von Weisheit (Zwei-Wege-Typik) und (Weg-)Weisung (Tora). Dabei wird – anders als in den Proverbia – die Beziehung zu Gott in den Vordergrund geschoben: Die Weisung des Herrn (Ps 1,2) ist die von Gott selbst ergehende Unterweisung (genitivus subjectivus). Der in Ps 1 das Wort führende menschliche Lehrer lehrt, dass Gott der Lehrende seiner Lehre ist (vertical turn).
- 2. Die von Gott kommende, autoritative Lehre wird mit dem determinierten, Einheit wie Ganzheit vermittelnden Ausdruck die Weisung des Herrn bezeichnet. Das zugrunde liegende Verb ירה hi drückt den Vorgang des mündlichen (auf das Hören abzielenden) Belehrens aus. Ob diese Unterweisung verschriftet vorliegt – wie dies die Parallelstelle Jos 1,7–8 anzeigt (vgl. auch Jos 8,31.34–35 und v.a. 24,26: בספר תורת אלהים) –, ist wahrscheinlich, wird aber nicht betont. Diesbezüglich berührt sich die Aussage mit dem Erst- und Einzigbeleg für die Tora des Herrn innerhalb des Pentateuchs, Ex 13,9(–10) (vgl. ferner Jes 1,10; 5,24; 30,9). Dort wird die mündlich-katechetische Weitergabe (an künftige Generationen) angesprochen.
- 3. Über die Vermittlung von oben nach unten hinaus wird in Ps 1,2 der rezeptive Vorgang betont. Dies geschieht mit dem in Jos 1,8 und hier als terminus technicus verwendeten Verb הגה. Es hat wie ירה hi ebenfalls einen oralen (und auditiven) Aspekt: Glücklich gepriesen wird, wer die Tora Jhwhs (und damit ihren Inhalt) gegenwärtig hält, indem er sie murmelnd rezitiert und derart memoriert, beherzigt, verleiblicht (vgl. Ps 1,3; 37,30–31). Die oben erwähnte Stelle in Ex 13,9 (die Tora des Herrn sei in deinem Mund) spricht nicht nur das Empfangen, sondern auch das Nachsprechen und Verinnerlichen an und ist darin Jos 1,8 und Ps 1,2 ähnlich. Zudem klingt Ps 1,1–2 an das Schema‘ Jisra’el an (vgl. Dtn 6,5–8): die Aufforderung, die Worte zu Herzen zu nehmen, davon erfüllt zu sein und sie der nächsten Generation weiterzugeben.
- 4. Zwischenfazit: Wesentlich ist der in die weisheitlich-horizontale Belehrung eingelagerte theologisch-vertikale Aspekt. Die Tora Jhwhs wird als Gottesbelehrung empfangen, gegenwärtig gehalten und erweist sich derart als lebensbestimmend. Sie verlangt ganze Zuwendung und vorgängig Abwendung von einem Verhalten, das dieser Hingabe abträglich ist. Dazu schreibt Petrany: „This portrait is not a human-divine dialogue, but rather a meditative and active human engagement with the divine word, already made available and possibly even written.“52
- 5. Worauf die Tora des Herrn (Ps 1,2) referiert, geht aus Ps 1 selbst nicht hervor. Was damit gemeint ist, ergibt sich aus analogen Aussagen bzw. Anspielungen einerseits sowie der hervorgehobenen Erstplatzierung des Psalms innerhalb des Buches andererseits. Mit anderen Worten: Ps 1 ist als isolierter Einzeltext nicht hinreichend verstehbar. Er greift über sich hinaus und aktiviert in Gestalt, Gehalt und Positionierung Verstehensbedingungen, die nicht im Wortlaut selbst liegen.53 Das Verstehen dessen, was mit der Tora des Herrn in Ps 1,2 gemeint ist, vollzieht sich mit Hilfe anaphorischer und kataphorischer Verweise in kanonhermeneutischem Horizont.
- 6. Die anaphorische Dimension umfasst sinnstiftende Bezüge zu vorgelagerten Stellen autoritativen Schrifttums. Am prägnantesten sind die Aussagen in Jos 1,7–8: Gott verspricht seine Präsenz und bindet sie zugleich an das Befolgen der von Mose überkommenen Tora. Zu Beginn des Prophetenkanons ist damit – ohne dass dies explizit gesagt wird – in den Vorgaben des Deuteronomiums gleichsam der erste „Prophet“ (aber auch der erste „König“) nach Mose „geboren“ (vgl. Dtn 17,14–19; 18,9–22). Die Analogie zwischen Ps 1 und Jos 1 wird über den Wortlaut hinaus auch durch Position und Funktion der beiden Teile gestiftet: Wie zu Beginn des Prophetenkanons in Jos 1 das Paradigma des Propheten gezeichnet wird, so am Beginn des Psalters (und möglicherweise zugleich der Ketubim) in Ps 1 das Paradigma des Weisen (und Gerechten).54 Durch Antippen von weiteren, hier nicht näher zu entfaltenden Schlüsselaussagen (Belege s.u., Skizze) verstärkt sich mit Ps 1 die Andockung des Psalters an „Mose und die Propheten“ und damit dessen Autorisierung. Der Psalter soll (nun auch) als Tora Jhwhs verstanden oder jedenfalls auf den Weg gebracht werden, ebenfalls Gotteswort zu werden und zu sein.55
- 7. Die kataphorische Dimension von Ps 1, also das mit dem Eingangspsalm eröffnete Verweissystem in den Psalter hinein, trägt das ihre zur Auffassung des Psalters als Tora bei.56 Dessen Fünfteilung in Analogie zum Pentateuch unterstreicht, dass unter der Tora Jhwhs auch der Psalter als Fünfbuch gefasst werden will.57 Die Glückpreisung am Buchanfang über dem, der die Weisung Jhwhs murmelnd sinnt, bezieht sich auch auf den, der den ספר תהלים in Mund und Herz nimmt und aus ihm lebt.58 Mit dem Midrasch gesprochen (MTeh 78,1): „Dass dir nicht ein Mensch sage: Psalmen sind keine Thora! sie sind Thora, und auch die Propheten sind Thora.“59
- 8. Die in Ps 1,2 mit der Tora Jhwhs angezeigte Unterweisung durch Gott wird im nachfolgenden Ps 2 verstärkt: Gott selbst ergreift das Wort, spricht vom Himmelsthron her und etabliert Macht und Ordnung mit seinem Gesalbten auf dem Zionsthron. Von Ps 2 zu Ps 3 bleibt die dominant vertikale Adressierung bestehen, der Vektor wechselt aber die Richtung: Erstmals im Psalter wird Gott angerufen und damit gebetet (s.o.). Der in Bedrängnis geratene König David löst damit die in Ps 2,8 ergangene Gottesaufforderung zum Gebet (Frage/bitte mich …!) gleichsam ein. Mit Petrany bilanziert: „The first three psalms present the open and yet also plainly demarcated invitation that is repeated in different ways throughout the Psalter … Thus, the development of the first three psalms establishes the thematic and communicative shifts that stand at the foundation of the psalms’ pedagogical potential.“60

4. Den Psalter als Preisung Jhwhs darbringen (Psalm 145/146–150)
Zuletzt ein Blick auf das Ende des Psalters (MT). Da ist nicht mehr von der Tora Jhwhs die Rede (Ps 1,2, letztmals Ps 119), und auch die Tephilla ist mit der letzten David-Gruppe an ihr Ende gekommen (letztmals Ps 143). Vielmehr schiebt sich nun die Tehilla, der Hymnus, in den Vordergrund. Ps 145, der letzte Davidpsalm, ist – nach Ausweis der Präskripte – die einzige תהלה „Preisung“. Das alphabetische Akrostichon hat möglicherweise den Psalter bzw. Teilbuch V einmal beschlossen,61 bevor dieser mit dem finalen Hallel Ps 146–150 als Koda sein definitives Ende (MT) gefunden hat.62 Ps 145, den Friederike Neumann in ihrer Monographie als „schriftgelehrten Hymnus mit theologischem Profil“ bezeichnet,63 blickt dabei (wie Ps 3) einem Janus-Kopf vergleichbar auf beide Seiten (David-Gruppe und finales Hallel).
4.1 Text und Übersetzung von Psalm 145
| 1 | תְּהִ לָּה לְדָוִד | Eine Preisung – David zugehörig. | ||
| R’ | a | אֲרוֹמִמְךָ אֱלוֹהַי הַ מֶּלֶךְ | Ich will dich erheben, mein Gott: den König, | |
| b | וַאֲבָרֲכָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד׃ | ich will loben deinen Namen für immer und ewig. | ||
| 2 | a | בְּכָל־יוֹם אֲבָרֲכֶ ךָּ | An jedem Tag will ich dich loben | |
| b | וַאֲהַלְלָה שִׁמְךָ לְעוֹלָם וָעֶד׃ | und preisen deinen Namen für immer und ewig. | ||
| I | 3 | a | גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻ לָּל מְאֹד | Gross [ist] der Herr und preisenswertüberaus, |
| b | וְלִגְדֻ לָּתוֹ אֵין חֵקֶר׃ | ja, für seine Grösse gibt es keineErforschung. | ||
| 4 | a | דּוֹר לְדוֹר יְ שַׁ בַּח מַעֲ שֶׂיךָ | Generation um Generation soll rühmen deine Werke, | |
| b | וּגְב וּרֹתֶיךָ יַ גִּיד וּ׃ | ja, deine Machttaten sollen sie kundtun. | ||
| 5 | a | הֲדַר כְּבוֹד הוֹדֶךָ | Die Pracht der Herrlichkeit deiner Hoheit | |
| b | וְדִבְרֵי נִפְלְאוֹתֶיךָ אָשִׂיחָה׃ | und die Geschehnisse deiner Wundertaten will ich bedenken. | ||
| 6 | a | וֶעֱז וּז נוֹרְאֹתֶיךָ יֹאמֵר וּ | Ja, von der Macht deiner furchterregenden Taten sollen sie sprechen | |
| b | וּגְד וּ לֹּתֶיךָ אֲסַ פְּרֶ נָּה׃ | und deinen Grosstaten: Ich will davon erzählen. | ||
| II | 7 | a | זֵכֶר רַב־ט וּבְךָ יַ בִּיע וּ | Das Gedächtnis an deine grosse Güte sollen sie sprudeln lassen |
| b | וְצִדְקָתְךָ יְרַ נֵּנ וּ׃ | und deine Gerechtigkeit bejauchzen. | ||
| 8 | a | חַ נּ וּן וְרַח וּם יְהוָה | Gnädig und barmherzig [ist] der Herr, | |
| b | אֶרֶךְ אַפַּיִם וּגְדָל־חָסֶד׃ | langsam zum Zorn und gross an Gnade. | ||
| 9 | a | טוֹב־יְהוָה לַ כֹּל | Gut [ist] der Herr zu allen, | |
| b | וְרַחֲמָיו עַל־ כָּל־מַעֲ שָׂיו׃ | und seine Barmherzigkeit [waltet] über allseinen Werken. | ||
| 10 | a | יוֹד וּךָ יְהוָה כָּל־מַעֲ שֶׂיךָ | Lobdanken sollen dir, Herr, alle deine Werke, | |
| b | וַחֲסִידֶיךָ יְבָרֲכ וּכָה׃ | und deine Getreuen sollen dich loben. | ||
| III | 11 | a | כְּבוֹד מַלְכ וּתְךָ יֹאמֵר וּ | Von der Herrlichkeit deiner Königsherrschaft sollen sie sprechen, |
| b | וּגְב וּרָתְךָ יְדַ בֵּר וּ׃ | und über deine Machttat sollen sie reden, | ||
| 12 | a | לְהוֹדִיעַ לִבְנֵי הָ אָדָם גְּב וּרֹתָיו | um bekannt zu machen denMenschenkindern seine Machttaten | |
| b | וּכְבוֹד הֲדַר מַלְכ וּתוֹ׃ | und die Herrlichkeit der Pracht seinerKönigsherrschaft. | ||
| 13 | a | מַלְכ וּתְךָ מַלְכ וּת כָּל־עֹלָמִים | Deine Königsherrschaft [ist] eine Königsherrschaft aller Zeiten, | |
| b | וּמֶמְ שֶׁלְ תְּךָ בְּכָל־ דּוֹר וָדוֹר׃ | und deine Herrschaft [geht] durch Generationen und Generationen. | ||
| IV | [c | ≠ MT (vgl. LXX, Syr, 11Q5) נ | [Zuverlässig [ist] der Herr in all seinen Worten | |
| d] | ≠ MT (vgl. LXX, Syr, 11Q5) | und getreu in all seinen Werken.] | ||
| 14 | a | סוֹמֵךְ יְהוָה לְכָל־הַ נֹּפְלִים | Ein Stützender [ist] der Herr für alle Fallenden | |
| b | וְזוֹקֵף לְכָל־הַ כְּפ וּפִים׃ | und ein Aufrichtender für alle Gebeugten. | ||
| 15 | a | עֵינֵי־כֹל אֵלֶיךָ יְ שַׂ בֵּר וּ | Die Augen aller: Auf dich sollen sie harren, | |
| b | וְ אַ תָּה נוֹתֵן־לָהֶם אֶת־ אָכְלָם בְּעִ תּוֹ׃ | dass du gebest ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. | ||
| 16 | a | פּוֹתֵחַ אֶת־יָדֶךָ | [Du] tust auf deine Hand | |
| b | וּמַ שְׂ בִּיעַ לְכָל־חַי רָצוֹן׃ | und sättigest alles Lebendige mit Wohltat. | ||
| V | 17 | a | צַ דִּיק יְהוָה בְּכָל־ דְּרָכָיו | Gerecht [ist] der Herr auf all seinen Wegen |
| b | וְחָסִיד בְּכָל־מַעֲ שָׂיו׃ | und getreu in all seinen Werken. | ||
| 18 | a | קָרוֹב יְהוָה לְכָל־קֹרְ אָיו | Nahe [ist] der Herr allen, die ihn anrufen, | |
| b | לְכֹל אֲ שֶׁר יִקְרָאֻה וּ בֶאֱמֶת׃ | allen, die ihn anrufen (werden) in Wahrheit. | ||
| 19 | a | רְצוֹן־יְרֵ אָיו יַעֲ שֶׂה | Wohltat an denen, die ihn fürchten, wirkt er, | |
| b | וְאֶת־ שַׁוְעָתָם יִ שְׁמַע וְיוֹ שִׁיעֵם׃ | und ihren Hilferuf wird er hören und sie erretten. | ||
| 20 | a | שׁוֹמֵר יְהוָה אֶת־ כָּל־אֹהֲבָיו | Es bewahrt der Herr alle, die ihn lieben, | |
| b | וְאֵת כָּל־הָרְ שָׁעִים יַ שְׁמִיד׃ | aber all die Frevler wird er ausrotten. | ||
| R’’ | 21 | a | תְּהִ לַּת יְהוָה יְדַ בֶּר־ פִּי | Preisung des Herrn soll reden mein Mund, |
| b | וִיבָרֵךְ כָּל־ בָּ שָׂר שֵׁם קָדְ שׁוֹ לְעוֹלָם וָעֶד׃ | und loben soll alles Fleisch seinen heiligen Namen für immer und ewig. |
4.2 Einige Überlegungen zur Buchgestalt im Anschluss an Psalm 145
Zwischen dem vorletzten Vers (20) in Ps 145 und dem letzten Vers (6) in Ps 1 besteht eine Buch-umgreifende Parallele. Beachtenswert ist dabei folgende Verschiebung: Gott erscheint nun als Richter über die Frevler.64 Die in Ps 2 vom Himmelskönig ergangene Bevollmächtigung des gesalbten Zionkönigs hat ihr Gegenstück in der (vektoriell umgekehrten) lobpreisenden Jhwh-Anrede Davids. Das Diktum von Egbert Ballhorn, dass David als Zionkönig seine Krone dem Himmelskönig zu Füssen legt,65 mag etwas überzeichnet sein. Richtig aber ist, dass fortan allein noch von Jhwhs immerwährender Königsherrschaft die Rede ist. David tritt an die Spitze einer am Schluss alles Fleisch umfassenden, weltumspannenden Gemeinschaft, die Gott für immer und ewig das Lob darbringt.
Lobvokabular findet sich in Ps 145 in grosser Fülle. Die Schlüsselverben des psalmischen Gotteslobs (ידה hi, ברך pi, הלל pi) kommen nun letztmals im Psalter gemeinsam vor und werden miteinander verschränkt. Zugleich vollzieht sich eine Ablösung und ein Übergang insofern, als ברך (und ידה) ein letztes Mal erscheinen. Für die Schlussfanfare werden das Verb הלל und der Halleluja-Ruf (endgültig) zu Leitbegriffen, mit denen der Psalter abschliesst. Lobpreis wird Jhwh dargebracht. An Gott gerichtete „Du“-Rede macht einen wesentlichen Teil des Psalms aus. Dazwischen freilich, mit wiederholtem Wechsel, finden sich auch in diesem Psalm reflektierende, belehrende Aussagen.66 Sie setzen als „Er“-Rede eine mitfeiernde Gemeinschaft voraus (s.o., zu Ps 3).
Einigermassen überraschend ist, dass in den Versen 15–16 (in Aufnahme von Worten aus Ps 104) das allerletzte Mal im Psalter – jedenfalls grammatikalisch – in „Du“-Rede Jhwh direkt angesprochen und gepriesen wird. In den nachfolgenden Hallel-Psalmen 146–150 wird die Preiswürdigkeit Jhwhs wiederholt und in vielerlei Weise herausgestellt. Auch wird mit stets neuen Imperativen zum Lobpreis aufgerufen: die mitfeiernde Gottesgemeinde bis hin zu allem, was Odem hat. Hingegen wird der Lobpreis (noch) nicht vollzogen. Die Einlösung geschieht nicht mehr im „Wortraum“ des Psalters, sondern wird ausserhalb vollzogen.
An dieser Stelle ist noch ein kurzer Blick auf Ps 146–150 zu werfen. Bekanntlich gehen die Hauptüberlieferungen DSS (Q), MT und LXX je eigene Wege. Das im MT finale Hallel hat die neuste Forschung beschäftigt und zu divergierenden Auffassungen geführt. Mit der teils geäusserten Infragestellung der Priorität der protomasoretischen Überlieferung sowie des Psalters als Komposition wird auch die Möglichkeit einer Psaltertheologie problematisiert. Während für Erich Zenger und Egbert Ballhorn unter Priorisierung des MT die Zusammenhänge so offensichtlich sind, „dass sie in der Exegese nie fraglich waren“67 und Friederike Neumann jüngst von einer gestaffelten Entstehung ausgeht, hält David Willgren unter Infragestellung der MT-Priorität fest: Die Annahme von Ps 145/146–150 als „an intentional unified composition“ sei „unconvincing“.68 Noch pointierter äussert sich Alma Brodersen:
„Thus, the order and frame of Psalms 146–150 do not seem to be an integral part of the individual Psalms … For Psalms 146–150, the relation between MT, DSS, and LXX as the latter two depending on MT could not be proven. Psalms 146–150 in DSS do not presuppose the Masoretic Psalter, especially given that the end of MasPsb is not factually preserved. This result concurs with the possibility that Books IV and V of the later Masoretic Psalter were not stable until after the mid-first century CE. The deconstruction of a unit of Psalms 146–150 cannot be used as an argument for the dependence of 11QPsa on MT.“69
Die Debatte um das Buchende des Psalters ist noch kontroverser als diejenige um den Buchanfang. Man wird den Sachverhalt weiter bedenken müssen, und die Qumran- Handschriften spielen dabei eine gewichtige Rolle in der Auseinandersetzung.70 Freilich wird man die dabei in den Vordergrund geschobene Betonung auf Herkunft und Abhängigkeit relativieren dürfen und verstärkt Verwendung und „Zukunft“ in den Blick zu nehmen haben: Anders als die Sammlungen aus den Höhlen am Toten Meer ist der MT (und die LXX) für die jüdische wie die christliche Glaubensgemeinschaften autoritativ geblieben, was verstärkt (kanon)theologische Überlegungen erfordert – und dies nicht erst für die Zeit, wo die Bezeichnung „Kanon“ üblich wurde.
Details
- Pages
- 516
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631914984
- ISBN (ePUB)
- 9783631914991
- ISBN (Hardcover)
- 9783631914977
- DOI
- 10.3726/b22123
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Altes Testament Psalmen Psalter Bibel Bibelexegese Bibelstudien
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 516 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG