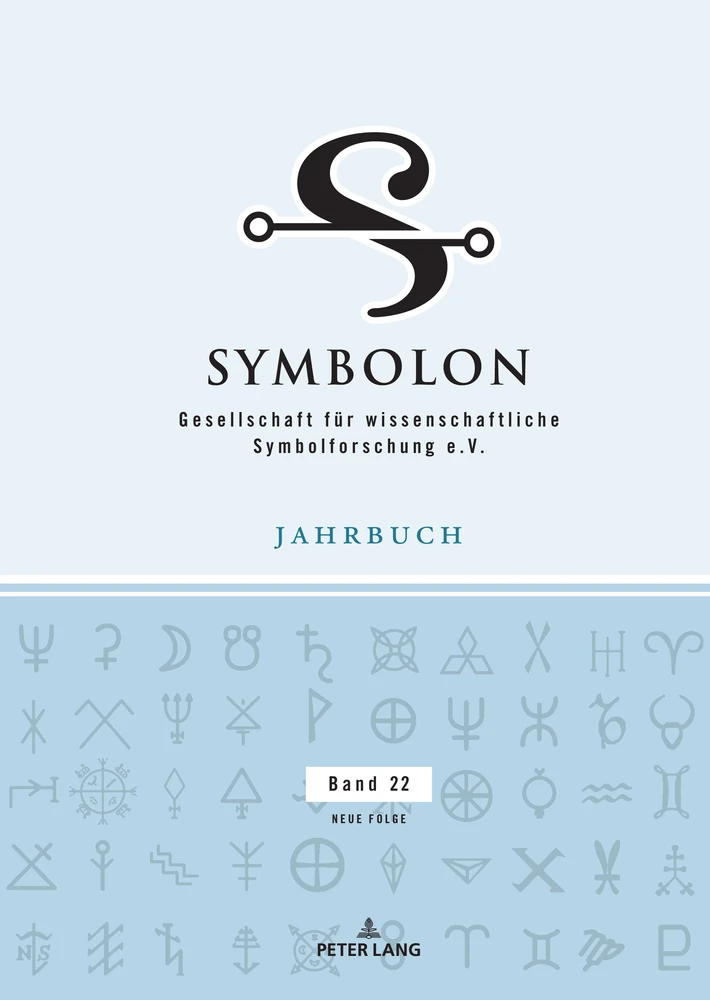Symbolon - Band 22
Symbole des Reisens und Verweilens / Phantastische Welten und imaginäre Länder / Symbole von Heimat und Fremdnis / Symbolik von Wegen und Grenzen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Vorwort des Herausgebers
- Auf Reisen. Symbolik des Unterwegsseins auf den »Symbolon«-Tagungen 2018–2021 (Martin Weyers)
- Tagung 2018 in Erfurt: Symbole des Reisens und Verweilens (Reisen und Verweilen: Eine ÜbersichtWerner Heinz)
- Zu den Symbolen des Reisens im Islam (Gabriele Berrer-Wallbrecht)
- Baiae und die Symbolik antiker Thermenarchitektur (Werner Heinz)
- „Nun weiß ich Dinge, die ich zuvor nicht wusste“: Symbolik von Reittier und Reitutensilien in der „Anderswelt“ (Yvonne S. Schulmeistrat)
- Der Topos des Wanderers: Von Ovids Göttern über den Tod im Märchen bis zu Tolkiens Gandalf (Friedhelm Schneidewind)
- Callahans Bar: Eine Untersuchung zur Symbolik der Taverne in der Science Fiction-Literatur (Balthasar von Weymarn)
- Reisen und Verweilen in harschen Zeiten: Balladen und Totentanzlieder im späten MA (Hans-Peter Banholzer)
- Die Götter der Geschwindigkeit Brüder der Morgenröte: der indoeuropäische Zwillings- und Pferdekult (Barbara Beyss)
- Finis Terrae und Weltinnenraum: Symbole, Mythen und Rituale rund um Weltenfahrten und Seelenreisen (Michael A. Rappenglück)
- Der „Gang nach Canossa“: Vom Ereignis zum Symbol (Oliver Münsch)
- Tagung 2019 in Gilching: Phantastische Welten und imaginäre Länder
- Verkehrte Welten und ihre Symbolik Bausteine zu einer Topographie des Imaginären (Leo Maria Giani)
- Tommaso Campanellas Staatsutopie „Città del Sole“ (Werner Heinz)
- Imaginationen, Simulationen, Multiversen: Phantastische Welten zwischen Realität und Fiktion (Michael Rappenglück)
- Ägypten als geistige Landschaft: Thomas Manns Josephsromane (Dieter Borchmeyer)
- Himmlisches Jerusalem und himmlischer Tempel: Biblische Motive und ihre Rezeption (Michael Bachmann)
- Faust, der Schöpfer und Kultivierer: Imaginäre Landschaftswelten und der Topos der Neulandgewinnung in Goethes Drama (Klaus Weißinger)
- Die neue Mythologie des Novalis: Symbolik im Märchen Eros und Fabel (Josefine Müllers)
- Tagung 2020 in Erfurt: Symbole von Heimat und Fremdnis
- Behausungen in Filmen des Regisseurs Edgar Reitz (Thomas Koebner)
- Himmlische Heimat und irdische Fremde: Die archaisch gnostische Welt- und Lebensauffassung als eines der Grundmodelle einer Kulturellen Kosmologie (Michael A. Rappenglück)
- Der Siebenstern als Symbol kosmischer Beheimatung: Untersuchungen zur geometrisierenden „Sakrallandschaft“ im Umfeld der Bruchhauser Steine (Südwestfalen) (Burkard Steinrücken)
- Die Kirche: tatsächliche Heimat von Franz von Assisi (Werner Heinz)
- Heimat als existentieller Anker und gelebtes Symbol (Hermes Andreas Kick)
- Tagung 2021 in Erfurt: Symbolik von Wegen und Grenzen – Wege und Grenzen der Symbolforschung
- Zwischen den Zeilen: Forschung im Grenzbereich des Wissbaren. Sechzig Jahrestagungen Symbolon (Martin Weyers)
- Der Weg des Schamanen aus philosophischer Perspektive (Thomas Höffgen)
- Schwellen und Pforten: Zur Symbolik architektonischer Grenzziehungen (Werner Heinz)
- Von der Symbolnot unserer Zeit (Peter Cornelius Mayer-Tasch)
- Rhythmus als Lebenssymbol im Aufbruch der internationalen Nachkriegskunst (Christa Lichtenstern)
- Schwellen und Grenzen in Mythen und Märchen (Wolfgang Bauer)
- Die Felsritzungen der Nordischen Bronzezeit: Ein religionswissenschaftlicher Weg zu einem wilden Symbolsystem (Nicole Höffgen)
- Das Metzler Lexikon literarischer Symbole: symboltheoretische Implikationen eines Work in Progress (Günter Butzer und Joachim Jacob)
- Erlösungsweg und Grenze im Verständnis verwundeter Leiblichkeit in Richard Wagners Parsifal und der aktuellen Corona-Debatte (Hermes Andreas Kick)
- Buchbesprechungen
- Hinweise zu den Autoren
Vorwort des Herausgebers
Erneut liegt ein Symbolon-Band vor, der die vielfältigen Aktivitäten und das damit verbundene breite Spektrum der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung wiedergibt. So sind auch in diesem Buch die Beiträge etlicher Geisteswissenschaftler verschiedenster Fakultäten, aber auch solche von Medizinern und Naturwissenschaftlern versammelt. Dieser reiche, interdisziplinäre Fächerkanon, auf den auch Martin Weyers in seinem Beitrag zu ‚Sechzig Jahren Symbolon-Tagungen‘ (gehalten am 27. August 2021) hinweist, hat entscheidend zum Gelingen der vier Tagungen, die in diesem Band vorgestellt werden, beigetragen. Mit den Themen Symbole des Reisens und Verweilens (2018), Phantastische Welten und imaginäre Länder (2019), Symbole von Heimat und Fremdnis (2020) und Symbolik von Wegen und Grenzen – Wege und Grenzen der Symbolforschung (2021) werden Bewegung und Dynamik angesprochen, aber auch Ruhe und Verharren. Es sind Spannungsfelder mit vielen Impulsen, die uns zum mittelalterlichen Totentanz oder auch zu prähistorischen Felszeichnungen führen können.
2018: Symbole des Reisens und Verweilens
Nach einleitenden Worten von Martin Weyers legt Werner Heinz in einer kurz gehaltenen Einführung dar, welche verschiedenen Bedeutungsebenen dem Begriff ’Reisen‘ zugrunde liegen; man hört von Reisenden der Antike, die ihren Zielort aus medizinischen Gründen wählten; Pilgerfahrten des Mittelalters spielen ebenso eine Rolle wie etwa der im Mittelalter überaus wichtige Weg über die Jenseitsbrücke oder Goethes Reisen in der Neuzeit.
In die muslimische Welt und ihre Pilgerreisen führt der Beitrag von Gabriele Berrer-Wallbrecht. Die Islamwissenschaftlerin erläutert einige Grundbegriffe muslimischen Glaubens und thematisiert u.a. die Pilgerfahrt (al-hağğ) als eine der Pflichten eines jeden Muslim, Mohameds Auswanderung (al-hiğra) aus dem Stammesgebiet, Reiseamulette und schließlich die Quitte als Fruchtbarkeits- und Traumsymbol.
Ein weiterer Beitrag von Werner Heinz stellt die Frage, was die höchst intensive Badekultur in dem kleinen, wenig westlich von Neapel gelegenen Ort Baiae mit dem Reisen zu tun hat. Hierhin zog es bereits vor der Zeitenwende, dann aber vor allem in der römischen Kaiserzeit, die Hautevolee Roms zum Sehen und Gesehenwerden – nun ja, und zum Baden. Zu solchen Reisen luden die verschiedenen Thermalbäder Baiaes, aber auch die von den Römern seinerzeit bereits gepflegte villegiatura ein. Eine solche Besucherfreundlichkeit schlug sich in einer Fülle von literarischen Zeugnissen – lobend oder warnend – nieder. In der Thermenarchitektur manifestierten sich Herrschaftsansprüche.
Mit den verschiedenen Reisetätigkeiten nordischer Götter befasst sich Yvonne S. Schulmeistrat mit ihren Untersuchungen zur Symbolik von Reittier und Reitutensilien in der ‚Anderswelt‘. Die Erzählungen vor allem der Snorra-Edda bewegen sich auf einer Art mythologischer Landkarte. Die Autorin spricht hier von einer literarischen Verständnisebene, der sie die inter- oder paramundane Verständnisebene entgegenhält, vor dem Hintergrund einer paraphysischen Landschaft. In diesem Bereich – sie nennt es auch das ‚schamanische Reisen‘ – verwischen die Grenzen zwischen den Figuren, und das Reittier ist kein gewöhnliches mehr.
Friedhelm Schneidewind greift in seinem Beitrag über den „Topos des Wanderers“ auf reiche Materialvorlagen zurück: Es sind Sagen, Märchen oder auch moderne Fantasy-Romane, die ebenso wie die Geschichten um Gilgamesch oder auch von Gestirnen bis hin zu „Peterchens Mondfahrt“ in seine Betrachtungen über das Reisen einfließen. Ausführlich geht Schneidewind in seinem Beitrag auf die symbolischen und mythologischen Bedeutungsebenen des Wanderns ein, wobei er mit hoher Kompetenz den gesamten Bereich von der Antike bis zu Tolkien abdeckt. Großen Wert legt der Autor auch auf die Begrifflichkeit; so findet er im Mythos die „Keimzelle aller phantastischen Literatur“. Sehr lebendig und abrundend geriet Schneidewinds Darbietung einiger Lieder vom Wandern.
Tief in den Bereich der Science Fiction führt Balthasar von Weymarns Beitrag über Callahan’s Saloon. Man erfährt von den Symbolen des Verweilens in Callahan’s Bar: von der Schwelle, der Zigarrenkiste mit den Münzen und dem Kamin, in dem die zerschmetterten Trinkgläser als Opfergaben landen. Es sind erstaunliche Bräuche und Riten, die den Leser in ihren Bann ziehen. Es ist dem Autor wichtig, auf jene Elemente – seien es Sprachen, seien es Bilder – hinzuweisen, die in ihrem Symbolgehalt auf tiefere Bedeutungsebenen hindeuten.
In einem kleinen in sich abgerundeten Beitrag geht Hans-Peter Banholzer auf die Reisen des Poeten und Sängers Fr. Villon ein anhand eines Liedtextes, den der Autor vertont hat. Es handelt sich um Liedgut, das (wie oft in jener Zeit) auf den Tod zielt. Vergleichend verweist Banholzer auf den seit dem Spätmittelalter bekannten Totentanz („der Tod tanzt“), der im 14. Jahrhundert von Frankreich aus nach Deutschland usw. ausstrahlte.
Mit ihrer sehr intensiven und fachübergreifenden Untersuchung widmet sich Barbara Beyss dem Phänomen von Zwillingsgöttern – im antiken Griechenland bekannt als die Dioskuren, also die Zeussöhne. Sie verfolgt die Spuren weiter bis in das bronzezeitliche Nordindien, das Baltikum, und sie findet sie auch in den Volksliedern. Der Mythos der Dioskuren (d.h.: Gottessöhnen) gehört zu den ältesten rekonstruierbaren Schichten der protoindoeuropäischen Religion und Mythologie: Der Kult reicht sechs Jahrtausende zurück. Die Rede ist vom allwissenden Himmelsgott, der Mutter Erde, der Morgenröte, der Sonne und der Sonnentochter, zu der die Himmelszwillinge, also die Dioskuren, in enger Beziehung standen. Die Zwillingsgötter (im Rigveda: die Ashvins) fahren dem Sonnengott auf seiner Sonnenbarke voraus und beschützen ihn. Zugleich sind sie göttliche Ärzte; in dieser Funktion kennt sie das frühe Christentum als die Heiligen Cosmas und Damian. Die altgriechischen Zwillingsgötter – ihre Namen: Kastor und Polydeukes – sind Schutzgötter für die Reisenden. Die indoeuropäischen Zwillingsgötter besitzen Pferde, die ihnen zur Mobilität in Windeseile verhelfen: „Götter der Geschwindigkeit“.
In einem sehr umfassenden Beitrag zu Erfahrung und zur Metapher des Reisens konstatiert Michael Rappenglück eine dreifache Bedeutungsebene: die „terrestrische Reise“, die von der Entdeckerfahrt bis zur Urlaubsreise reichen kann, die „individuelle Lebensreise“ und die „Seelenreise“, zu der Pilgerfahrten, aber auch Nahtoderfahrung und Jenseitsreise gehören. Der Autor spricht über Lebenswelten und systematisiert Passagen, Stationen, Scheidewege und Irrwege, denen nun auch noch Wegformen zugeordnet werden können. Grundsätzliche Fragen wie die nach der Weltenfahrt und der Seelenreise „mit dem Ziel, die Enden der Welt – Finis Terrae – zu erreichen“, seien auch im 21. Jahrhundert aktuell. Ebenso seien auch die Pilgerreisen und die spirituellen Wege wieder bedeutsam.
Bedauerlicherweise konnte Oliver Münsch seine Arbeiten zur Symbolhaftigkeit des Canossagangs nicht persönlich auf der Tagung präsentieren. Dafür aber waren sie angedacht, und deshalb wurden sie auch in diesen Band aufgenommen. Seinen Beitrag konnte Münsch schließlich am 23. November 2019 vor dem Symbolforscherkreis im Nibelungenmuseum in Worms vorstellen. Zunächst informiert der Autor umfassend über die Forschungsgeschichte und die zugehörigen Dokumente. Angesichts der negativen Bedeutung des Ereignisses – es brachte weder eine Wende noch eine Konfliktlösung – stellt sich die Frage, wie aus Canossa ein so starkes Symbol werden konnte. Im 16. Jahrhundert wurde die erste offene antipäpstliche Deutung des Geschehens veröffentlicht (Ulrich von Hutten), und Canossa wurde zum Symbol für die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat. Allerdings entziehe sich die Begegnung „bis heute einer exakten Einordnung“.
2019: Phantastische Welten und imaginäre Länder
Die Jahrestagung 2019 fand zusammen mit der Gesellschaft für Archäoastronomie in Gilching (bei München) statt. Eröffnet wurde sie nach mehreren kurzen Ansprachen zur Begrüßung vom Religionswissenschaftler Leo Maria Giani über die Symbolik der „Verkehrten Welt“. In dieser Welt werde alles spiegelverkehrt, also gegenläufig, gehandhabt, wie am Beispiel von Satanismus und Schwarzen Messen (Urin statt Weihwasser usw.) zu sehen. Die Macht der Verkehrten Welt sei mit „Tod, Unordnung, Chaos und destruktiven Kräften assoziiert“; sie habe aber ein hohes Faszinationspotential, so in der Richtung der Entfesselung ihrer destruktiven Macht. Giani bringt dem Leser diese „phantastischen Welten“ anhand etlicher Beispiele aus der Kultur- und Religionsgeschichte ein gutes Stück näher.
Die Staatsutopie, die Plato in seinem „Timaios“ formuliert hatte, findet in der Renaissance mit Thomas Morus (1478–1535) und Tommaso Campanella (1568–1639) erneute Aufmerksamkeit. Werner Heinz stellte Campanellas „Città del Sole“ im Kontext der Zeit und in einer Fülle von Einzelheiten vor. Diese „Sonnenstadt“ beschreibt ein utopisches Staatswesen nach frühkommunistischem Muster. Es gibt keinen Privatbesitz und angeblich auch keine Ständegesellschaft – eine Forderung, die sich als Utopie in der Utopie erweisen sollte, denn die Lenker dieses utopischen Staates stehen über dem gemeinen Volk; mit dem Mechanismus der staatlichen Überwachung werden sogar z.B. die Zeiten des Beischlafs vorgeschrieben. Das ließ die Zuhörer sichtlich betroffen zurück.
Der Wissenschaftler und Wissenschaftshistoriker Michael Rappenglück konnte seinen Vortrag über „Imaginationen, Simulationen, Multiversen“ nicht verschriftlichen. Um aber eine Vorstellung von diesem Beitrag, dessen Untertitel „Phantastische Welten zwischen Realität und Fiktion“ die Intention des Autors klar erkennen lässt, zu geben, haben wir hier im Band mit dem Einverständnis Rappenglücks das Abstract abgedruckt. Der Mensch – so der Gedanke – schaffe sich „weltweit Kosmovisionen“, die durchaus real erfahren werden könnten. Ausgedrückt würden sie in Symbolen, Mythen, Ritualen und der Kunst.
In die alttestamentarische Bronzezeit oder – anders gesagt – in die Welt des altägyptischen Neuen Reiches führt Dieter Borchmeyer mit seinem Vortrag über „Thomas Manns Josephsromane“ (Untertitel). Schon als Jugendlicher sei der Dichter von Ägypten begeistert und mit dieser Kultur besser vertraut gewesen als sein Lehrer. Th. Mann lasse in einem inszenierten Religionsgespräch zwei Monotheismen aufeinanderprallen: der transzendente Josephs und der kosmotheistische Echnatons. Joseph selber werde zunehmend zum Ägypter, verleugne aber die Religion seiner Väter nie. In der Doppelheit von religiöser und säkularer Perspektive erweitere sich die geistige Landschaft Ägyptens zu einer terra utopica.
Der Theologe Michael Bachmann untersucht in seinem Beitrag die immer wieder neu formulierten Vorstellungen eines idealen Tempels in einer idealen Stadt, erbaut nach himmlischem Vorbild. Nach jeder Zerstörung äußerte sich neue Hoffnung. Beredtes Zeugnis ist die Offenbarung des Johannes, die den Zyklus des Neuen Testaments abschließt. Über die Spätantike hinweg wurde das Bild der idealen (Tempel-)Stadt immer wieder neu aufgelegt.
Germanistik und Geografie verbinden sich in dem Beitrag von Klaus Weißinger über Goethes wohl berühmteste Figur, den Faust, der hier als „Schöpfer und Kultivierer“ erscheint. Faust sucht Helena, findet sie und schafft es, „sie dauerhaft real in ihrer imaginär griechisch-antiken Umgebung erscheinen zu lassen“. Faust hilft dem Kaiser und erhält dafür ein Stück Land am Strand, das er kultivieren will. Gerade in diesem Gestaltungswillen treffen sich imaginäre und realistische Landschaften.
Friedrich von Hardenberg – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Novalis – erzählt in seinem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ von der Vollendung bzw. Erlösung der Welt durch den Geist der Poesie. Josefine Müllers greift die Geschichte von „Eros und Fabel“ – sie findet sich am Ende des ersten Teils des Romans – heraus und verfolgt den Erlösungsweg Fabels durch die unterschiedlichen Reiche von der Astralwelt über das ätherische Zwischenreich bis zur Unterwelt. Müllers konnte ihr Opus nicht auf der Tagung in Gilching präsentieren. Da es aber auf genau auf das Tagungsthema bezogen ist, können wir es dankenswerterweise hier abdrucken.
2020: Symbole von Heimat und Fremdnis
Ähnlich wie Josefine Müllers konnte auch Thomas Koebner seinen Vortrag nicht selber halten; deswegen hat Martin Weyers während der Tagung diese Arbeit vorgestellt. Koebner spricht über „Behausungen“, wie sie in den Werken des Filmemachers Edgar Reitz zu finden sind. Da geht es um Zimmerzellen mit der Vorstellung einzelner, recht verschiedener Gelasse; so etwa ein alter Dachboden als Raum für Verliebte – Symbol für Heimat, wie sie eigentlich jeder kennt, obwohl man sie bewusst kaum so wahrnimmt. Koebner diskutiert weitere Heimat-Zyklen, so auch die andere Heimat von Auswanderern nach Brasilien. Man kenne die Gefühle, die diese Symbole auslösen; man mache sie sich aber nur selten bewusst.
Den intensiven Beitrag über „Himmlische Heimat und irdische Fremde“ konnte Michael Rappenglück nicht schriftlich vorlegen. Deswegen haben wir mit dem Einverständnis des Autors das Abstract abgedruckt. Der gestirnte Himmel als Ausdruck einer transzendenten Sphäre, als eigentliche Heimat, ging dem Menschen verloren; es ergab sich die Dichotomie von „materiellem Körper und geistigem Wesen“ – eine Weltanschauung, die Rappenglück in der Gnosis begründet sieht.
Ähnlich wie Rappenglück musste auch Burkhard Steinrücken auf eine schriftliche Ausarbeitung seines Vortrags verzichten. Auch in diesem Fall können wir das Abstract abdrucken. Die grundsätzliche Frage lautet: Hat der Mensch astronomische Beobachtungen zur Sonne oder zum Mond und den daraus abgeleiteten Kalendarien usw. in die Landschaft projiziert, um damit eine sakrale oder pagane Topografie zu schaffen? Steinrücken untersucht diese Frage anhand einer markanten Landmarke im südlichen Westfalen.
Es überrascht eigentlich wenig, dass die Kirche die „tatsächliche Heimat des Franz von Assisi“ war, wie Werner Heinz im Titel seines Vortrags sagt. Von größter Bedeutung ist der Weg, der den Heiligen dorthin führte: Franz löste sich vollkommen von seiner bisherigen Welt des Reichtums und der Vornehmheit; er legte seine Kleidung ab, bis er im wahrsten Sinne des Wortes völlig nackt dastand, und begab sich in den bischöflichen Schutz vor seinem wütenden Vater. Und auch innerhalb der Kirche gestaltete er sich seinen eigenen Bereich: Das Leben in völliger Armut wurde zu seiner eigentlichen Heimat.
In einem grundlegenden Aufsatz untersucht Hermes A. Kick den Begriff der Heimat als einem existentiellen Anker „für die persönliche und politische Handlungssituation“. Es geht also um ethische Fragen. Heimat – so Kick – sei „Gegenständlichkeit, Symbol und Situation“ mit dem Sinnziel der „Identität, Freiheit, Einheit und Menschenwürde“. Die Symbolforschung könne helfen, das Spannungsfeld zwischen romantischer Idylle und rationalem Heimatbegriff in einem prozessdynamischen Ansatz auszuleuchten. Die Bedeutung, die Kick dem Begriff ‚Heimat‘ beimisst, geht auch daraus hervor, dass „Heimat mit ethischen Argumenten und auch mit politischen Instrumenten“ zu verteidigen sei – geschrieben vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
2021: Symbolik von Wegen und Grenzen – Wege und Grenzen der Symbolforschung
In seinem Festbeitrag zu sechzig Jahren Symbolon-Tagungen erzählt Martin Weyers in seiner Funktion als Erster Vorsitzender der Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung von ganz persönlichen Begegnungen in dem Haus von C. G. Jung am Zürichsee oder auch mit der Campbell-Foundation in den USA. Daraus entwickelt sich nahezu unbemerkt die eigentlich entscheidende Frage nach dem Symbolbegriff. Symbolforschung – sie steht ja bei jeder Tagung im Vordergrund – sei zugleich Kulturgeschichte, wesentlich angebunden an Religion, Mythen, Künste (diesen Bereich untersucht Weyers, selbst Bildender Künstler, ausführlich), alles unter Einbeziehung von Psychologie und Philosophie. Die Kunst stehe, wie etwa bei Schelling oder Heidegger nachzulesen, über der Philosophie. Symbolforschung sei Beschäftigung mit dem, was gerade noch oder gerade nicht mehr aussagbar sei. Geistige Phänomene ließen sich nur durch Beschreibung erfassen; dazu bedürfe es jener Sinnbilder, die sich in Religionen, Mythen und Kunstwerken ausdrücken. Weyers stellt in seinem sehr persönlich gehaltenen Essay eine interessante Parallele der Mythenbildung und des Kunstschaffens her: Kunst sei, in Anlehnung an den Religionsphilosophen Georg Picht, die „Wahrnehmung von Gestalt durch Schaffung von Gestalt“. Weyers hat grundsätzliche Fragen aufgegriffen. Sie beginnen mit der Feststellung, dass Symbole sich niemals erschöpfend behandeln ließen; sie enden mit der Feststellung, dass Mythen sich letztlich dem „Rätsel der Subjektivität“ verdanken. – Mit einem Bild des Redners soll die grundsätzliche, tagungsunabhängige Bedeutung dieses Vortrags hervorgehoben werden (W. H.).

Martin Weyers während seines Festvortrags bei der Tagung Erfurt 2021 (Foto: Werner Heinz)
Ein Beitrag zu Schamanen und dem Schamanismus scheint ein Fremdkörper in der Symbolforschung zu sein. In den üblichen Lexika der Symbole, auch in solchen neueren Datums, findet sich diese Begrifflichkeit nicht. Schamanismus wird gemeinhin nicht als eigene Religion, sondern als magische Praxis, als Mittlerschaft zwischen der Welt der Geister und der menschlichen Gemeinschaft verstanden. Gerade da setzen die Arbeiten von Thomas Höffgen an: Er sieht den Schamanismus für das europäische Altertum als gut belegt an. Gewisse schamanische Vorstellungen seien dem europäischen Denken nicht fremd, sondern mittels der Klassischen Philologie in die Wiege gelegt worden. Höffgen regt an, das schamanische Symbolsystem umzuschreiben auf das Symbolsystem klassischer Philosophie.
Schwellen – Pforten – Grenzen: Das sind Begriffe, die die Menschen seit Jahrtausenden umtreiben. Werner Heinz untersucht die Etymologie, bevor er sich anhand einer Reihe von Beispielen jenen Grenzen zuwendet, deren Bedeutung heute kaum mehr gesehen wird. So etwa die Klostermauer, die gemäß der Mönchsregel Isidors von Sevilla (um 560–636) den Feind – den Teufel – abwehren soll. Scheintüren grenzten in ägyptischen Gräbern die Welt der Lebenden von der der Toten ab. Das Kirchenportal ermöglicht den Zugang zur materiellen Kirche und führt damit in die geistliche Kirche hinein, wie eine Inschrift über dem Haupteingang der Kathedrale von Troia (Apulien) sagt. Die Kirchentür trennt zwei Welten: Drinnen die geistliche Welt, draußen unmittelbar vor der Tür neben dem Asylring die Welt der paganen Normen. Diese Grenzen werden heute in der Regel gar nicht mehr als solche wahrgenommen.
Der Rechtsphilosoph und Politikwissenschaftler Peter Cornelius Mayer-Tasch, der sich in mehreren Publikationen mit dem Begriff ‚Symbol‘ und dessen Hintergründen auseinandergesetzt hat, lenkt hier den Blick auf das Eigentliche: die „Ganzheitssymbole“; es seien die Symbole der höchsten Verdichtungsstufe. Wenn das Bewusstsein dafür verloren gehe, entstehe die Symbolnot. Um die zu beheben, müssen „wir das bis zur Unkenntlichkeit überlagerte und verfälschte Symbolgut wieder freilegen und zurechtrücken“. Es gelte, den „Weg zur Erkenntnis- und Heilkraft der Ganzheitssymbole“ zu finden.
Die Kunsthistorikerin Christa Lichtenstern – sie hat viel über Symbolforschung und moderne Kunst gearbeitet – thematisierte den „Rhythmus als Lebenssymbol“ anhand von drei zeitgenössischen Künstlern: Es handelt sich um den spanischen Bildhauer Eduardo Chillida, den Engländer Henry Moore und den „viel zu wenig beachteten deutschen Maler Theodor Werner“. Der Rhythmus als Gestaltungsmittel sei aus dem griechisch-antiken Proportionssystem entstanden. Generell werde er als Zeitgestaltung im Bereich der Musik, der Dichtung und des Tanzes verstanden, werde aber auch durch die „dynamisch–gerichtete Wiederholung gleichmäßiger Grundelemente zum wesentlichen Gestaltungsfaktor“. Auf Lichtensterns Feststellung der Allgegenwart des Symbols in der Kunst weist Martin Weyers in seinem Beitrag „Zwischen den Zeilen“ (hier im Band) ausdrücklich hin.
Mit einer Fülle von aussagekräftigen Beispielen erzählt Wolfgang Bauer von „Schwellen und Grenzen in Zaubermärchen“. Gerade in diesem Genre gibt es vielfältige Beispiele der verbotenen Tür (Blaubart), des Tores, an dem ein Urteil oder eine Belohnung vollzogen wird (Frau Holle), der Grenze, die zu überschreiten lebensgefährlich ist (Jorinde und Joringel) usw. Aber Bauer geht noch einen Schritt weiter und untersucht die Schwelle als Ort zauberischer Handlungen, als Sitz von Geistern, die es zu besänftigen gilt, oder als Platz des Eingrabens der Nachgeburt. Und es gibt die Pforten in die Anderswelt: Siehe Ischtars Gang in die Unterwelt. Ein Blick auf die Bedeutung der Torschwelle bei den Römern rundet den Beitrag ab.
Anhand etlicher Felszeichnungen im schwedischen Ort Tanum befasst sich Nicole Höffgen mit bronzezeitlicher Religiosität. Nach allgemeiner Auffassung sind diese mittlerweile zum Weltkulturerbe erklärten Darstellungen Ausdruck eines „wilden Denkens“. Die Ritzungen stellten „kein rationales, sondern wildes Symbolsystem dar“. Die Autorin befasst sich anhand dieser etwa 3000 Jahre alten Ritzungen mit der bronzezeitlichen Religiosität, auch wenn der „Interpretationsschlüssel vom heutigen zum damaligen Denken“ fehle. Die Symbole – „in Stein gemeißelt“ – würden „die Felsplatten zu einem kulturellen und religiösen Speicher- und Erinnerungsmedium“ machen. Dazu untersucht Höffgen das kulturelle Gedächtnis und die religiöse Kanonform, das Material und die Stätte.
Dem in der dritten Auflage erheblich erweiterten „Metzler Lexikon literarischer Symbole“ fehlten noch wenige Wochen bis zur Fertigstellung der Drucklegung, als Joachim Jacob, der sich mit Günter Butzer die Herausgeberschaft teilte, dieses Opus von nahezu 800 Seiten vorstellen konnte. Symbole – so Jacob – „entstehen nicht, sondern werden gemacht“. Sie verwiesen nicht auf eine „ursprüngliche Bedeutung“, sondern „auf die kulturelle Tätigkeit des Menschen“. So lassen sich dann auch literarische Symbole erfassen. Neu ist das Bedeutungsregister, das immerhin 45 Seiten umfasst. Die dort aufgeführten Lemmatitel ermöglichen auf einen Blick eine „Zusammenschau der Symbolbildungen“. Daraus ließen sich – so der Autor – zahlreiche Perspektiven für die Symbolforschung gewinnen.

An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die ausführliche Besprechung dieses Werks hinten in diesem Symbolon-Band verwiesen.
Der abschließende Beitrag ist Hermes A. Kick zu verdanken. Er spricht gleichermaßen als Psychiater und als Philosoph, dessen erkenntnisphilosophische Analysen sich auf die seinerzeit hochaktuellen Fragen der Corona-Debatte richteten. Kick stellt die Frage, ob Wagners Darstellung des Parsifal-Mythos „praktisch, persönlich und politisch“ heute noch etwas zu sagen habe. Parsifal sei „hellsichtig geworden durch die Konfrontation mit dem Zusammenhang von eigener Schuld, Verstrickung, Verwundung und Wiedergewinn durch Verzicht“. Jetzt sei er befähigt, „sehend in die Nähe des Leidenden zu kommen, um zusammenzufügen, was zusammengehört“. Damit spricht Kick die Grundbedeutung eines Symbols und der Symbolforschung an.
Diese vier Tagungen bereichern die Symbolforschung immens. Das eingangs bereits angesprochene Miteinander verschiedenster Fakultäten – der Begriff der Multidisziplinarität ist hier angebracht – vermittelt reichhaltige Impulse, mit denen auf breiter Basis weitergearbeitet werden kann. Dieser Reichtum bringt es mit sich, dass eine vereinheitlichende Darstellung der wissenschaftlichen Apparate nicht möglich ist: Der Theologe zitiert völlig anders als ein Naturwissenschaftler. Auch die Anmerkungen aus den Bereichen der Islamwissenschaft und der Medizin passen nicht in ein einziges System wissenschaftlicher Belegpflicht – es ließe sich mühelos noch ein halbes Dutzend weiterer hier vertretener Fakultäten benennen, deren Zitationsweisen nicht miteinander kompatibel sind. Sehr wohl aber ist auf die Vollständigkeit der Hinweise großer Wert gelegt worden, um das Auffinden zitierter Belege zu erleichtern. Aus diesem Grund sind auch die sonst fachspezifischen Abkürzungen nicht zugelassen.
Zwei weitere editorische Besonderheiten sollen noch kurz angesprochen werden. Der eine Punkt betrifft die Literaturlisten am Ende eines Beitrags. Die Texte in diesem Buch sind nicht nur fachspezifisch sehr differenziert, sondern auch in Bezug auf die Länge der Darstellungen. Bei kurzen Aufsätzen mit nur einigen übersichtlichen Anmerkungen ist es nicht sinnvoll, die wenigen Titel am Ende gesondert aufzulisten. Doch in den anderen Fällen ergibt sich aus einer solchen Liste ein schneller, konzentrierter Überblick über den zu erwartenden Inhalt. Noch interessanter sind jene Listen, die nach Bereichen gegliedert werden konnten, wenn z.B. Quellentexte und Sekundärliteratur getrennt aufgeführt sind. – Die zweite Besonderheit betrifft den in solchem Rahmen ungewöhnlichen Abdruck von Abstracts. Die mittlerweile überstandene Corona-Pandemie hat ihre Spuren auch in unserem Arbeitsgebiet hinterlassen und damit zu Schwierigkeiten und Ausfällen geführt. Wenn die Erstellung eines Aufsatzes – aus welchem Grunde auch immer – nicht möglich war, das Thema aber so bedeutsam ist, dass wenigstens ein Hinweis gegeben sein sollte, haben wir als kleinen Ersatz das Abstract eingesetzt.
Der Dank des Herausgebers richtet sich zunächst an alle Beiträger: Sie haben nicht nur wertvolles Text- und Bildmaterial zur Verfügung gestellt, sondern auch in Geduld eine dank der zeitgeschichtlichen Ereignisse überlange Bearbeitungszeit hingenommen. Für besondere fachliche Beratung geht der Dank an Andreas Mang, für Korrekturlesen an Isabel Bendt und Hubertus Manderscheid. Katrin Mang hat wertvolle Hilfe bei der Bildredaktion geleistet; dafür sei ihr ein besonderer Dank gesagt.
Dieses Buch hätte nicht ohne einen bedeutsamen Druckkostenzuschuss der Klett-Stiftung (Stuttgart) publiziert werden können. Dafür möchte die Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung ein herzliches Dankeschön sagen!
Martin Weyers
Auf Reisen. Symbolik des Unterwegsseins auf den »Symbolon«-Tagungen 2018–2021
Wer sich auf die Kunst des Reisens versteht, hat sich auch in Lebenskunst geübt, angesichts der Notwendigkeit steter Anpassung an unvorhergesehene Wendungen und Ereignisse die Fähigkeit erworben, sich immer wieder freudig im Ungewissen einzurichten, dabei unbeirrt aus dem gestern Erreichten zu schöpfen, um aus dem, was sich heute zeigt, das Morgen zu gestalten. Was wäre eine Reise wert, wenn wir uns nicht gelegentlich die Zeit nähmen, innezuhalten und auf die bisherigen Stationen zurückzublicken? Zehn Jahre sind vergangen, in denen ich unsere Jahrestagungen gestalten durfte; zehn Jahre auch der Zusammenarbeit mit Werner Heinz, der mit dem vorliegenden Band die Ergebnisse unseres gemeinsamen Forschens erneut einem breiteren Publikum zugänglich macht. Zehn Jahre Symbolon – auch die Arbeit am Symbol gleicht einer Reise, will man darunter eine physische Bewegung verstehen, die von einer geistigen begleitet ist. Die Metaphorik der Lebensreise kann auch heute noch Gültigkeit beanspruchen, nachdem das mühelose Konsumieren fremder Länder und exotischer Kulturen längst zum Massenphänomen geworden ist, sofern das Streben des Einzelnen immer noch darauf zielt, den eigenen Erfahrungsbereich oder gar den der eigenen Gruppe oder Domäne zu erweitern. Ein neuer Tagungsband gibt Anlass, den Blick auf die bisherigen Stationen gemeinsamen Unterwegsseins im Reich der Symbolik zu richten.
Geistigen und physischen Reisen ist gemein, dass sie den Reisenden in eben dem Maße mit Wissen und Erfahrung belohnen, in dem dieser bereit ist, Anstrengungen auf sich zu nehmen – wie es vor dem Zeitalter der durchorganisierten, billigen, schnellen Mobilität allen Generationen unabdingbar und selbstverständlich schien. Mit Internet und Chat-GPT sind wir heute derart komfortabel und kurzatmig in der Welt des Wissens unterwegs, dass mancher die Verarmung und Vereinseitigung nicht einmal mehr bemerkt, von denen das kollektive Informationsrecycling gezeichnet ist, kurzum: nicht gewahr wird, dass er seinen Verstand längst Maschinen, Medien und Manipulatoren überantwortet hat.
Dem steht der bewährte Ansatz einer Begegnung in Form von Symposien gegenüber, deren Resultate wir weiterhin in gedruckter Form vorlegen – ein langwieriger, aber gründlicher Prozess, dessen Resultate uns auch morgen oder in hundert Jahren noch bereichern können, unabhängig von Servererreichbarkeit und Konnektivität unserer Endgeräte, ja sogar von der Verfügbarkeit eines Stromnetzes: Dieses Buch können Sie zur Not noch bei Kerzenlicht lesen. Es ist auf säurefreiem Papier gedruckt, das die Zeiten überdauern wird, solange Menschen Respekt vor Büchern haben, während die meisten Internetpublikationen schon nach wenigen Jahren wieder aus dem Netz und damit aus dem Bewusstsein verschwinden.
Nach mehr als sechs Jahrzehnten setzen wir bei Symbolon also nach wie vor auf »physische« (will heißen: lebendige) Begegnungen und gedruckte (ergänzend auch elektronisch verfügbare) Jahrbücher, in denen sorgfältig ausgefeilt und für die Zukunft aufbereitet wird, was im Umfeld unserer Tagungen erarbeitet wurde. Nach Vollendung unseres Tagungszyklus über die kosmologische Symbolik entstand der Wunsch nach einem neuen übergreifenden Thema, das uns von Tagung zu Tagung trägt. Mit der Jahrestagung 2021 und dem vorliegenden, vier Jahre der gemeinsamen Arbeit zusammenfassenden Band hat nun auch dieser Zyklus einen runden Abschluss gefunden. Begonnen haben die gemeinsamen Erkundungen zum Themenkreis des Reisens und Wanderns, des Schlenderns und Spazierengehens, des Suchens und Fliehens, des Pilgerns und Eilens, des Flanierens und Verweilens, des Auskundschaftens von Gebieten und Grenzen in realen und imaginären Welten im Frühjahr 2018, wie immer ohne zu ahnen, wohin uns die kommenden Jahre der Beschäftigung mit der damit verbundenen Symbolik führen würden.
Symbole des Reisens und Verweilens (2018)
Als Alexander von Humboldt im Jahre 1802 vom Gipfel des Chimborazo die Welt betrachtete, die ihm von seinem privilegierten Standort aus wie ein riesenhafter Organismus erschien, wurde mit diesem inneren Bild von der Welt zugleich die Idee der Ökologie geboren. Mit Ernst Haeckel, einem weiteren Genius seiner Zeit, der in seiner Arbeit Forscherdrang und künstlerische Berufung zu verbinden suchte, sollte knapp sechzig Jahre später sein glühendster Anhänger daheim in der Schreibstube, inspiriert durch Humboldts Worte, den eine neue Wissenschaft begründenden Begriff erstmals im noch heute gültigen Sinne zu Papier bringen.1
Reisend und verweilend erzeugen wir Sinnbilder, die den Horizont der Daheimgebliebenen überschreiten. Beides sind Pole, die einander bedingen: Soll etwas von bleibendem Wert aus dem einen oder anderen erwachsen, haben wir uns in beidem zu üben. Unsere Jahrestagung 2018 handelt von diesem zweifachen Sinn: Wir thematisieren Sinnbilder der Mobilität und des Ruhens, erkunden das beiden Erlebnisformen innewohnende symbolschöpferische Potential.
Klang und Kosmos, Zeit und Zeitlosigkeit, Himmelsreisen und Höllenfahrten, und nun also: Symbole des Reisens und Verweilens – auch in diesem Jahr spielt sich unsere Auseinandersetzung mit der Welt der Symbole im Spannungsfeld eines polaren Begriffspaares ab. Die Aufhebung der Gegensätze zu veranschaulichen geeignet scheint mir ein zu Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenes Gemälde von Eduard Ender, das Humboldt und seinen französischen Reisegefährten Aimé Bonpland in ihrer improvisierten Hütte im Orinoco-Delta zeigt.
Lassen manche Andachtsbilder, etwa in Renaissance oder Manierismus, eine Unterteilung in Immanenz- und Transzendenzzone erkennen (etwa Betende und Angebetete in Sacra Conversazione), finden wir hier ungebändigtes Leben und improvisiertes Studierzimmer gegenübergestellt – ein reisend erzeugter Schnittpunkt zwischen Natur und Kultur. In der Zone mobiler Gelehrsamkeit (links) offenbaren sich dem verweilenden Blick aus dunklen Schatten hervortretende Bücher und Forschungsinstrumente: aus dem Dunkel des Unwissens heraus kristallisiert sich die Klarheit des analytischen Geistes. Demgegenüber
sprießt, nur zögerlich dem Wissenschaftsgeist zu offenbaren bereit, in prachtvoller Üppigkeit fremdartige Natur – Wildnis, die mit den Mitteln von Leib, Geist und Seele gleichermaßen erkundet werden will.
Humboldt war mehr als ein kalt sezierender Analytiker. In seinen wort- und bildreichen Berichten verbinden sich Empathie, Kontemplation und Präzision. War James Cook auf die Dienste der von ihm angeheuerten Zeichner angewiesen, konnte Humboldt, geübt im Umgang mit Pinsel und Zeichenstift, diese Position mit Leichtigkeit selbst einnehmen. Sogar jene Stiche, die nicht unerheblich zur Verbreitung seiner Bücher beitragen sollten, stammen von eigener Hand; der Gelehrte hatte sein künstlerisch-technisches Rüstzeug bei den besten Pariser Kupferstechern erlernt.
Als Zeichner reist es sich anders; Zeichnen bedeutet Einüben in die Langsamkeit des Sehens. Ungeachtet einer ihm zuweilen nachgesagten Unrast, verfügte Humboldt offenbar über die Gabe der kontemplativen Schau, wie sie den in sensiblen Naturstudien geübten Graphiker auszeichnet. Ökologie leitet sich ab von Oikos, griechisch für Haus oder Heimstatt; vielleicht hilft die Sichtweise von der Natur als einer allen Wesen gemeinsamen Wohnstätte verstehen, was solche Forschungsreisenden umtrieb, und wie es ihnen gelang, sich auf ihren abenteuerlichen Reisen, ungeachtet aller Strapazen und Gefährdungen, noch im venezolanischen Dschungel oder auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt2, beobachtend, zeichnend und schreibend vergleichsweise gemütlich einzurichten. Reisend erfuhren sie sich in der Natur als daheim, als Teil eines übergeordneten Ganzen, das sie wohl nicht länger als Resultat eines göttlichen Schöpfungsprozesses zu begreifen vermochten, wohl aber als von immanenten Naturkräften durchwaltet, die ihnen von nicht minderer Faszination erschienen.3

Abb. 1:Eduard Ender, »Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland in der Urwaldhütte« (Mitte 19. Jhd.). Bildnachweis: Gemeinfrei laut Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eduard_Ender_-_Alexander_von_Humboldt_und_Aime_Bonpland.jpg#filelinks. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus 100 years or fewer – published anywhere (or registered with the US Copyright Office) before 1928 and public domain in the US.
Soweit mein Ankündigungstext, der 2018 zu einer Reise nach Erfurt verführen sollte, um im Kreise Gleichgesinnter zu verweilen. Die idealisierte Darstellung auf dem Gemälde von Eduard Ender mag kaum den realen Gegebenheiten entsprechen, ist jedoch geeignet, die Vorstellung eines Unterwegs- Zuhauseseins eindrucksvoll vor Augen zu führen. Die Tagung begannen wir mit einer unscheinbaren Frucht, die viele symbolisch mit Fruchtbarkeit assoziieren mögen, einer orientalischen Köstlichkeit, der gleichwohl, wie wir sehen werden, ein traumhafter Kosmos keimhaft innewohnt. Die geträumte Quitte (arabisch: safargal4) wird im arabischen Kulturraum als Vorzeichen einer Reise gedeutet. Ein sich in Gänze erst reisend zu erschließender, jedoch tag- und nachtträumend antizipierter Erlebnisraum entfaltet sich, wann immer wir uns kraft unserer Fähigkeit der Imagination zu einer inneren Reise aufmachen: in Träumen, Gedanken, Visionen, oder beim Lesen eines Romans. Die polaren Erfahrungsweisen des Reisens und Verweilens fallen somit häufiger in eins, als uns gemeinhin in den Sinn kommen mag.
Phantastische Welten und imaginäre Länder (2019)
In Mythen, Märchen, Filmen und bildender Kunst, sowie in den fiktiven Reiseberichten der phantastischen Literatur, begegnen uns Welten, die sich allein der Kraft der Imagination verdanken. Obwohl diese Landschaften mit ihren Bewohnern im historisch-faktischen Sinne niemals existiert haben und allein im Geiste bereist werden können, sind sie doch symbolisch oftmals stark aufgeladen und wirken daher machtvoll auf uns zurück. Doch auch reale Länder und Orte werden in unserer Vorstellung als innere Bilder neu erschaffen, wobei Emotionen vielerlei Art, wie etwa Ängsten oder Sehnsüchten, symbolbildende Kraft zukommt. Gerade das Unbekannte, der Raum jenseits des Erforschten, bietet Anreiz als Projektionsfläche.
Das reiche symbolische Potential imaginär erzeugter und imaginativ umgestalteter Orte, an denen allein die Grenzen unserer Vorstellungskraft Beschränkungen unterliegen, lockt auch den Symbolforscher zur Erkundung mit den ihm eigenen Mitteln. Dabei begnügen wir uns nicht damit, Produkte der Phantastik in Kunst und Unterhaltung im Hinblick auf einschlägige Motive und deren mythische Wurzeln zu analysieren; durch die Gegenüberstellung themenrelevanter Symbolik in Religion und Mythos, Literatur, Filmen und Computerspielen ergibt sich die Möglichkeit einer differenzierten Untersuchung von symbolischen Zusammenhängen in den unterschiedlichen Medien.
Visionen, Imaginationen und Phantastereien im Sinne von Vorstellungsbildern und inneren Landschaften, die wir mit Hilfe unserer Einbildungskraft (facultas imaginandi) bereisen, wohnt ein unterschiedlicher Welt- und Wirklichkeitsbezug inne, der im Anschluss an unsere Tagung im Vorjahr zum Thema Symbole des Reisens und Verweilens herausgearbeitet werden will.
Gary Lachman brachte in seinem Vortrag The Lost Knowledge oft the Imagination5, basierend auf dem (fast) gleichnamigen Buch,6 die auf Coleridge zurückgehende, unterscheidende Definition7 ins Spiel, wonach Fantasy (bei Coleridge eigentlich: Fancy) sich durch das Spiel des Zusammenfügens und Montierens von Vorgefundenem auszeichnet, während Imagination im eigentlichen und ursprünglichen Sinne die Fähigkeit einer Wahrnehmung in inneren Bildern, und damit letztlich eine Erkenntnisform bezeichnet. Nicht immer jedoch lässt sich zwischen beidem eine scharfe Trennlinie ziehen. Die meisten Werke der Kunst dürften, Coleridges Begriffsverständnis folgend, eher als Erzeugnisse der Phantasie zu bewerten sein, während reine und unverfälschte Imagination selten vorkommt, muss doch selbst die kühnste Vision unweigerlich eine Einkleidung in kulturell überlieferte Farben und Formen über sich ergehen lassen, spätestens im Versuch, diese festzuhalten und zu kommunizieren. Mitunter vermischen sich zudem historische Fakten und authentische innere Wahrnehmungen oder eben auch Erzeugnisse eines phantasierenden Umherschweifens.
Einem Künstler vom Format eines Rainer Maria Rilke wird man ohne weiteres die Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung in imaginativen Bildern an den Grenzen des sprachlich Möglichen zugestehen. Mit dem Filmemacher Rüdiger Sünner – seit vielen Jahren der Symbolon-Gesellschaft eng verbunden – konnte ich im Anschluss an eine Filmvorführung8 etwa Rilkes kosmische Vision diskutieren, die diesen auf Reisen in Ägypten in einer Nacht ereilte, die er unter dem Angesicht der Großen Sphinx von Gizeh zubrachte, das sich ihm in das Gesicht des Kosmos schlechthin verwandelte.9
Dieter Borchmeyer vermittelte Einblicke in das teils historische, teils imaginierte Ägypten Thomas Manns, wie es in Joseph und seine Brüder aufscheint, für dessen kommentierte Neuausgabe10 er zusammen mit Jan Assmann und Stephan Stachorski verantwortlich zeichnet. Im Anschluss an die Tagung machte er sich gleich an ein neues, umfassendes Buch in Form einer Biographie über Thomas Mann,11 die mittlerweile ebenfalls erschienen ist. Insofern gestaltete sich sein Beitrag zur Jahrestagung sowohl als Resultat einer Beschäftigung mit dem imaginären Blick in den tiefen Brunnen der Vergangenheit, den uns dieser große deutsche Schriftsteller mit seiner Roman-Trilogie ermöglicht hat, wie auch als Vorgriff auf die ausführliche Darstellung von Leben und Werk dessen Schöpfers in der nachfolgenden Veröffentlichung.
Über das Symbolon-Vortragsprogramm hinaus waren die Teilnehmer eingeladen, an Veranstaltungen im Rahmen des parallel im selben Hause stattfindenden Symposiums der Gesellschaft für Archäoastronomie teilzunehmen, die sich thematisch auf die ihr eigene Weise an unserem Tagungsthema orientierte: Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen12 lautete hier das Leitthema der Veranstaltung, deren Teilnehmer wiederum umgekehrt von der Möglichkeit, unsere Symbolarbeit kennenzulernen, reichlich Gebrauch machten. Im Anschluss an die beiden Tagungen waren alle Beteiligten zur gemeinsamen Exkursion eingeladen, organisiert von Michael Rappenglück, Vorsitzender der Gesellschaft für Archäoastronomie und zugleich eng verbunden mit der Symbolon-Gesellschaft. Höhepunkt der Tagesfahrt markierte der Besuch von Tüttensee und Relikten des mutmaßlichen Chiemgau-Impakt-Kraterstreufelds. Ist hier vor mehr als zwei Jahrtausenden ein Meteorit eingeschlagen, dessen zerstörerische Kraft die heutige Landschaft formte? Lässt sich womöglich gar der Mythos von dem unglücklichen Himmelslenker Phaethon auf eine solche Katastrophe zurückführen? Die Historie des Expertenstreits, der sich an den Thesen einer Forschergruppe um die Symbolon-Autoren Barbara und Michael Rappenglück13 entzündet hat – ohne dass ein Ende in Sicht wäre –, ist eine eigene Geschichte, die hier nicht erzählt werden kann. Auch hier wurden wir wieder mit den zentralen Fragen konfrontiert, die sich aus dem Tagungsthema ergeben und auch vor der Naturwissenschaft nicht Halt machen: Fakt oder Phantasie? Mythos oder Historie?

Abb. 2:Exkursion zum Tüttensee. ©Martin Weyers
Symbole von Heimat und Fremdnis (2020)
Heimat wird häufig erst dann zum Thema, wenn ihr Verlust droht oder bereits erlitten wurde, also die Erfahrung von Fremdheit oder Identitätsverlust eintritt. Umgekehrt hat die Fremde schon manchen seines vertrauten Umfelds überdrüssig Gewordenen verlockt, eine neue Heimat zu suchen oder zu kreieren.
Details
- Seiten
- 714
- Erscheinungsjahr
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631922323
- ISBN (ePUB)
- 9783631922330
- ISBN (Hardcover)
- 9783631922316
- DOI
- 10.3726/b22031
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2025 (Februar)
- Schlagworte
- Archäoastronomie Harmonie der Sphären Nahtod Schöpfungsmythen Zeit Kunstgeschichte Symbolforschung Utopie Reisen
- Erschienen
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 714 S., 62 farb. Abb., 36 s/w Abb.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG