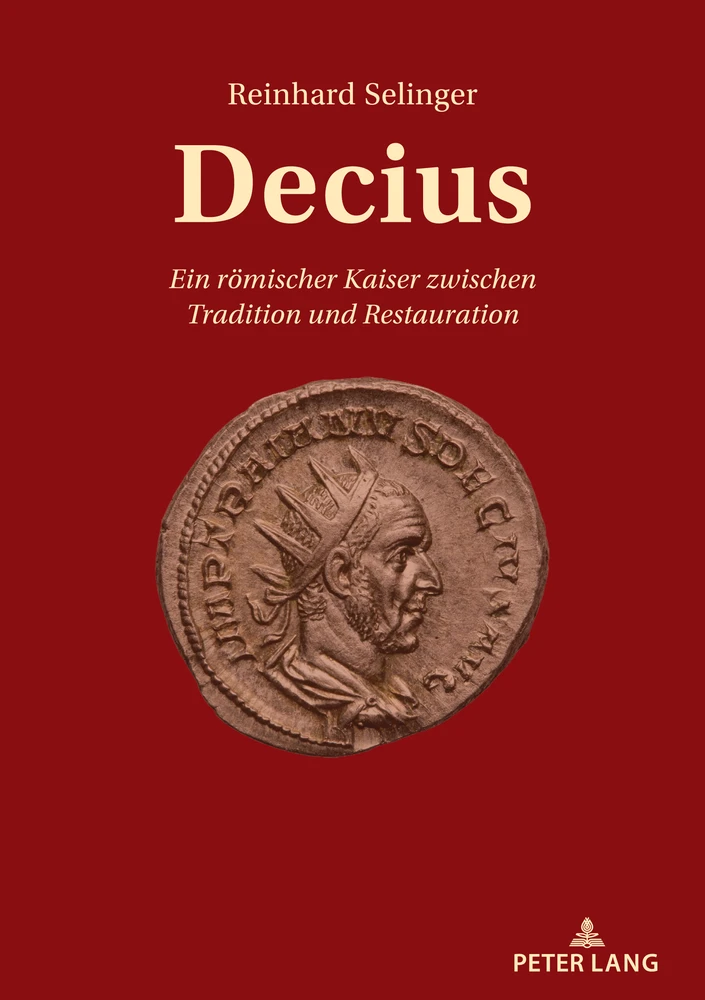Decius
Ein römischer Kaiser zwischen Tradition und Restauration
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- INHALTSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- DECIUS’ PERSÖNLICHKEIT
- Decius’ Machtübernahme
- Decius’ Politik
- Decius’ Religiosität
- Die Konsekrationsmünzen
- Decius’ und Herennius’ Reskript an die Aphrodisier
- Decius’ Weiheinschrift in Aquileia
- Decius’ Ehreninschrift in Cosa
- Decius’ Ehreninschrift in Oescus
- Hostilians’ Schlachtensarkophag?
- Ergebnis
- DECIUSʼ OPFEREDIKT
- Anlass
- Supplicatio
- Dies imperii
- Supplicatio zum dies imperii
- Die Anordnung einer supplicatio zum dies imperii
- Die Kultaktivitäten
- Die zeitliche Dauer der Kultfeiern
- Die Beteiligung der Bevölkerung
- Die Götter
- Die Kultformen
- Die Anordnung des decianischen Opferedikts
- Die Veröffentlichung des Opferedikts in Rom
- Das Bekanntwerden des Opferedikts in Karthago
- Die Ankunft des Opferedikts im Osten des Reichs
- Die Ursachen für die zeitliche Verzögerung
- Die Kultaktivitäten
- Die zeitliche Dauer der Kultfeiern
- Die Beteiligung der Bevölkerung
- Die Götter
- Die Kultformen
- Die Opferkommissionen
- DIE OPFERBESTÄTIGUNGEN
- Grundschema eines libellus
- Vergleichende Analyse der Texte
- Adressat (Spalte A)
- Antragsteller (Spalte B)
- Opfervollzug (Spalte C)
- Bestätigungsbitte (Spalte D)
- Datum (Spalte F)
- Kommissionsbestätigung (Spalte E)
- Libellus und Zensuseingabe – ein Vergleich
- Der libellus in der Tradition der dokumentarischen Papyri
- Formbeschreibung
- Formvergleich
- Der libellus und die christlichen Autoren
- Geschlecht und Alter
- Der Opfervollzug durch Stellvertreter
- Opferaufforderung an Sklaven?
- Juden und das Opferedikt
- Soldaten und das Opferedikt
- Der libellus: Versuch einer Deutung
- DIE FOLGEN FÜR DIE CHRISTEN
- Rom
- Karthago
- Alexandria
- Neocaesarea
- Smyrna
- Der Streit um die Einheit der Kirche
- (K)eine Christenverfolgung?
- DIE SUPPLICATIONES ZUM DIES IMPERII (Dok. 1–44)
- DIE OPFERBESTÄTIGUNGEN (Pap. 1–47)
- Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Decius – Die Charakterisierung seiner Person ist geprägt von den Auswirkungen seiner „Christenverfolgung“. Die Opfer seiner Religionspolitik haben beeindruckende Zeugnisse ihres Glaubens hinterlassen, welche noch heute das Bild des Kaisers bestimmen. Eine unabhängige Sicht ist erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts durch den Fund von derzeit siebenundvierzig Opferbestätigungen auf Papyri möglich. Die libelli haben daher zentrale Bedeutung für jede Studie über die decianische Krise.
Andere Ereignisse aus Decius’ Regierungszeit müssen aus Fragmenten rekonstruiert werden. Eine Darstellung, wie sie etwa der Historiker Tacitus für die julisch-claudische Dynastie oder der Zeitzeuge Euseb für die Konstantinische Wende vorgelegt hat, fehlt für die Epoche der Krise des 3. Jahrhunderts. Die Forschung ist daher angewiesen auf die zeitgleiche Überlieferung auf Papyrus, Stein und Münze oder auf literarische Notizen aus späterer Zeit.
Die Arbeit mit primärem Quellenmaterial ist mühsam, selbst noch für den Leser. Sie ermöglicht dafür, Methoden und Ergebnisse der Forschung durch akribische Analysen zu hinterfragen. Synthesen erfolgen mit Bedacht, nicht mit dem Ziel, endgültige Ergebnisse vorzulegen, sondern um zu weiterer Beschäftigung anzuregen.1
1 Dieses Buch ist Ergebnis einer Jahrzehnte langen Arbeit an dem Thema (Selinger 1994; Selinger 20042). Ich danke allen, die mit ihren Veröffentlichungen erst meine ermöglicht haben! Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Fustel de Coulanges: pour un jour de synthèse il faut des années d’analyse.
I. DECIUS’ PERSÖNLICHKEIT
In diesem Kapitel wird anhand von drei Problembereichen, die als exemplarisch für Decius’ Regierungstätigkeit gelten dürfen, danach gefragt, unter welchen Zwängen der Kaiser stand, seiner Politik Geltung zu verschaffen:
- 1. Bezeichnend ist die Problematik, entweder (meist späte) widersprüchliche Darstellungen in Einklang zu bringen, oder inhaltsgleiche Überlieferung auf einen Traditionsstrang zurückzuführen. Die unkritische Übernahme der negativen Stigmatisierung von Person und Politik des Kaisers durch christliche Autoren ist ebenso zu vermeiden wie die Versuchung, unzureichendes Quellenmaterial zu voreiligen Synthesen zu verarbeiten.
- 2. Decius’ Haupttätigkeit während seiner kurzen Regierungszeit bestand fast ausschließlich in der Niederwerfung von inneren Aufständen und der Abwehr von äußeren Feinden.
- 3. Decius’ Religionspolitik stellte einen Nebenaspekt seiner Regierungstätigkeit dar. Einzelne Maßnahmen im religiösen Bereich sind zwar bemerkenswert, doch eine ausformulierte religionspolitische Absicht ist nicht nachweisbar.
1. Decius’ Machtübernahme
„Auf Philipp, der sieben Jahre regiert hatte, folgte Decius. Aus Hass gegen Philipp begann dieser eine Verfolgung gegen die Kirchen.“2 Diese Schlussfolgerung zieht rund fünfzig Jahre nach den Ereignissen der christliche Autor Euseb in seiner Kirchengeschichte. Seine Argumentation beruht auf folgenden Einzelinformationen über Decius’ Vorgänger Kaiser Philipp (244–249):
- a. Der bedeutende alexandrinische Theologe Origenes soll an Philipp einen Brief gerichtet und mit Severa, der Gattin des Kaisers, einen regelrechten Briefverkehr geführt haben.3
- b. Euseb weiß ferner von einem Gerücht, dass Philipp einmal an einem christlichen Kultakt teilnehmen wollte, aber auf Anordnung eines namentlich nicht genannten Bischofs daran gehindert wurde, bis er der strengen christlichen Bußpflicht nachgekommen sei.4
- c. Bürgerkriegsähnliche Unruhen, welche in Alexandria unter Philipp ausbrachen und sich auf diese Stadt beschränkten, machten die Christen zu Opfern einer grausamen Repressionspolitik. Der Gewaltausbruch geschah zwar ohne den Willen des Kaisers, aber auch ohne seinen mäßigenden Einfluss. Der damals in Alexandria regierende Bischof Dionys zählt die Ereignisse nicht zur Regentschaft des Philipp, sondern rechnet sie quasi als vorweggenommene Maßnahme dessen Nachfolger zu: „Bei uns nahm die Verfolgung nicht erst mit dem kaiserlichen Edikt ihren Anfang. Sie hatte bereits ein ganzes Jahr vorher begonnen.“5 Dennoch bewertet Dionys die Regierungstätigkeit von Philipp positiv, denn es sollte noch schlimmer kommen: „Doch gar bald erhielten wir die Nachricht, dass es in der kaiserlichen Regierung, die uns so gut gesinnt war, einen Wechsel gegeben habe. Die Furcht vor dem, was uns drohte, steigerte sich gewaltig. Schon war auch das Verfolgungsedikt erschienen.“6
Euseb zitiert Dionys’ Brief (c.) wörtlich in seiner Kirchengeschichte, versieht ihn aber mit einem Vorwort, das den Eindruck erweckt, dass diese Ausschreitungen erst unter Decius stattfanden: „In seinem Brief an Fabius, den Bischof von Antiochia, berichtet Dionys über die Kämpfe derer, welche unter Decius (!) in Alexandria gemartert wurden, folgendermaßen …“7 All diese Informationen – die Kunde vom Briefwechsel des Origenes mit dem Kaiserhaus (a.), die Gerüchte über eine heimliche Verehrung des christlichen Gottes durch Philipp (b.) und die Ausschreitungen in Alexandria (c.) - führen Euseb schließlich zu einem Resümee, das er allerdings nicht an das Ende, sondern an die Spitze seines Berichts über Decius stellt: „Auf Philipp, der sieben Jahre regiert hatte, folgte Decius. Aus Hass gegen Philipp begann dieser eine Verfolgung gegen die Kirchen.“8 Er stellt damit einem guten Kaiser einen bösen gegenüber, d.h. einem christenfreundlichen einen christenfeindlichen. Durch diese Antithese treibt Euseb die nachfolgenden Ereignisse dramaturgisch an die Spitze. Mit diesem stilistischen Trick arbeitet er auch bei seiner Schilderung des Machtwechsels von Severus Alexander zu Maximinus Thrax (235), wobei der Letztgenannte ebenfalls nach Eusebs Meinung „aus Hass“ gegen christliche Mitglieder des kaiserlichen Haushalts zu wüten begann.9 Subtil weiter entwickelt hat Euseb diese Form der Darstellung bei seiner Bewertung der Regierungstätigkeit der Tetrarchen (284–324): die Urheber der größten Christenverfolgung der Antike, Diokletian und Maximian, nennt er in seiner Kirchengeschichte nur dann namentlich, wenn er Gesetzestexte dieser Kaiser zitiert oder chronologische Angaben macht10, sonst umschreibt er den Namen des Diokletian mit Begriffen wie „der Älteste“, „der Eine“ oder „der Herrscher“, den Namen des Maximian mit „der Mann“.11 Den drei christenfeindlichen Nachfolgern Licinius, Maximinus und Maxentius wirft er jeweils getrennt gewalttätige Regierungsführung12, Steuererhöhungen aus Geldgier13, Heuchelei14 und Aberglauben15 vor, während er beim christenfreundlichen Konstantin dagegen nur milde Regierungstätigkeit16, Steuererleichterungen17, Aufrichtigkeit18 und Ablehnung jedes Aberglaubens19 finden kann.
Von einem Hass des Decius gegen Philipp wissen christliche Zeitgenossen freilich nichts zu berichten, obwohl Dionys die Ausschreitungen unter Philipp Decius anlastet und Cyprian sogar eine persönliche Aussage des Kaisers kennen will.20 Auch Laktanz, der mit seinem Werk über die Todesarten der Christenverfolger zeitlich vor dem Werk des Euseb anzusetzen ist, berichtet darüber nichts, obwohl gerade ein politisches Motiv in der Öffentlichkeit am ehesten bekannt gewesen sein müsste.21
Und dennoch hatte die von Euseb geschaffene Sichtweise großen Einfluss auf die nachfolgende Literatur. Die Chroniken22 geben sie ebenso weiter wie die Sibyllinischen Orakel,23 deren Abhängigkeit von der Kirchengeschichte des Euseb wahrscheinlich scheint, da hier nicht nur das Motiv von Decius’ Hass gegenüber seinen Vorgänger übernommen wurde, sondern auch die Bemerkung des Dionys, dass die Verfolgung unmittelbar nach dem Wechsel in der Herrschaft begann: „Unmittelbar darauf (nach der Ermordung der Brüder und Freunde des Philipp) wird die Plünderung und der Mord der Gläubigen veranstaltet wegen des früheren Königs“.24
Ebenso ist Euseb der Begründer der Tradition, dass Philipp der erste christliche Kaiser Roms gewesen sein soll.25 Johann Chrysostomos konnte sich kaum auf eine lokale Überlieferung stützen, als er Jahrhunderte später dem Bischof Babylas die Zurückweisung eines unbekannten Kaisers zuschreibt.26 Die Harmonisierung des ungenannten Bischofs bei Euseb mit Babylas und des unbekannten Kaisers bei Chrysostomos mit Philipp ließ nicht lange auf sich warten.27 Historische Erfahrungen im Verhältnis von Staat und Kirche nach der Konstantinischen Wende förderten diese Sichtweise. Für die decianische Zeit stellte sie jedoch einen Anachronismus dar. Erst ein Bischof mit der Autorität des Ambrosius konnte es sich leisten, einen Kaiser vor dem Kirchentor abzuweisen. Ein christlicher Schriftsteller der konstantinischen Zeit wie Euseb konnte von solchem Ansehen nur träumen.28
Dem von Euseb geschaffenen Motiv zweier unversöhnlicher Kaiser, von denen der eine den Christen freundlich begegnet, der andere ihnen deswegen umso feindlicher gesinnt ist, stehen Quellen entgegen, die eine differenzierte Bewertung erlauben:29 Denn zunächst hat Philipp großes Vertrauen in Decius30 gesetzt, als er ihn im Jahr 249 mit einem Sonderkommando betraute und ihn in die Donauprovinzen schickte. Die Legionen dieser Gegend hatten nach dem Einfall der Gepiden und Goten ihren Feldherrn Pacatianus31 zum Gegenkaiser ausgerufen, in der Hoffnung, dieser würde die Gefahr bewältigen. Als sie sich in ihrer Hoffnung getäuscht sahen, ermordeten sie ihn. Decius sollte nun als dux Moesiae et Pannoniae die Ordnung wiederherstellen. Er ging widerwillig in die Provinzen, da er fürchtete, auch er könnte in die Rolle des Usurpators gedrängt werden. Decius stellte die Disziplin der Truppen wieder her, wobei er nicht den Erfolg hatte, den er gewünscht hatte. Denn ein Teil der Truppen entwich seinem Druck durch Desertion zu den Feinden,32 während ein anderer von seiner Armeeführung so sehr begeistert war, dass er Decius gegen seinen Willen zum Kaiser proklamierte. Philipp nunmehr von Misstrauen erfüllt, veranlasste Vorbereitungen für eine Entscheidungsschlacht. Von einem Brief, in dem Decius Philipp darlegte, dass er von den Truppen zur Übernahme der Herrschaft und einem nun folgenden Marsch nach Italien gezwungen worden wäre und er nach seiner Ankunft in Rom den Kaisertitel zurücklegen würde, weiß der byzantinische christliche Mönch Zonaras.33 Der ebenfalls byzantinische heidnische Autor Zosimus hingegen teilt nichts von so einem Brief mit, obwohl er sonst die Persönlichkeit des Decius in den buntesten Farben alter senatorischer Noblesse beschreibt und Interesse an einem positiven Bild des heidnischen Usurpators gehabt hätte.34 Tatsache ist jedenfalls, dass im September/Oktober 249 die kampferprobten Donaulegionen des Decius entweder bei Verona35 oder bei Beroia36 über die größere Truppenzahl Philipps siegten und der unterlegene Kaiser in der Schlacht das Leben verlor.37 Obwohl Zonaras soeben erst geschrieben hat, dass Decius gegen seinen Willen zur Usurpation gezwungen wurde, behauptet er anschließend, dass Decius, seine Christenverfolgung aus Hass gegen seinen Vorgänger Philipp begonnen hätte. Er folgt damit einer Tradition, welche der Kirchenhistoriker Euseb begründet hatte.38
2. Decius’ Politik
Die ersten Maßnahmen des erfolgreichen Feldherrn nach der Ankunft in Rom galten der Herrschaftssicherung:39 Decius ließ sich vom Senat als Imperator Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Pius Felix Invictus Augustus anerkennen. Durch die Annahme des Cognomens Traianus, der als allseits respektierter guter, d.h. senatsfreundlicher Kaiser und ausgezeichneter Feldherr, galt, stellte Decius hohe Anforderungen an seine Politik. Eine Stabilisierung der Herrschaft erhoffte der Kaiser ferner durch die Einbindung seiner Familie in die Regierungspolitik. Seine Ehefrau Herennia Etruscilla ernannte er zur Augusta, seine beiden Söhne Herennius Etruscus und Hostilianus zunächst zu Caesares, später den älteren von beiden, Herennius, zum Augustus und damit zum Thronfolger. Decius leistete die obligate Geldspende an die stadtrömische plebs und ließ seine Usurpation nachträglich durch den Senat legalisieren. Dieser setzte bereitwillig den Tag als dies imperii fest, an dem Decius vom Heer Pannoniens zum Kaiser ausgerufen worden war – zwischen dem 23. September und dem 16. Oktober 249. Die Truppen, welche dem Kaiser zur Herrschaft verhalfen, wurden mit der Münzlegende genius Illurici bzw. genius exercitus Illuriciani geehrt; die Prägungen mit der Personifikation Dacia bzw. Dacia felix erinnerten an die großen Erfolge seines Vorbilds Trajan; seine Heimatprovinz ehrte Decius mit einer Münzemission der personifizierten Pannonia.40 Im Zentrum der Reichsprägung des ersten „illyrischen Kaisers“ standen generell Motive aus der Donauregion bzw. den Balkanprovinzen.41
Die acht erhaltenen Reskripte in den Rechtskodizes stehen in Sprache und Inhalt ganz in der Tradition des klassischen Römischen Rechts.42 Die Rechtspflege wurde unter Decius wie in der gesamten Soldatenkaiserzeit ohne Unterbrechung und größere Änderungen weiter geführt.43 Der Decius-Portraittypus zeigt die üblichen Tendenzen, die Physiognomie des Kaisers realistisch, d.h. mit verhärteter Miene, darzustellen.44 Die kaum zweijährige Regierungstätigkeit des Decius ist von einer nicht unbeachtlichen Bautätigkeit gekennzeichnet. Die Thermenanlage auf dem Aventin in Rom verdankt ihren Ursprung diesem Kaiser.45 Die Anlegung von Militärstraßen entsprach den Erfordernissen der Zeit.46
Der Nachricht in der Historia Augusta, dass unter Decius die seit Domitian verfemte Zensur wieder eingeführt wurde, ist kaum Glauben zu schenken. In der Biographie des Kaisers Valerian (253–260) wird ihre Wiedereinrichtung in den buntesten Farben altrömischer republikanischer Tradition beschrieben: Der Senat habe die Zensur dem damaligen Senator Valerian angeboten. Dieser habe die Verleihung mit der Begründung abgelehnt, dass allein dem regierenden Kaiser dieses Amt zustehen würde.47 Das Fehlen eines Hinweises in der epigraphischen und vor allem numismatischen Überlieferung und der noch dazu bekannt unverlässliche Charakter der Historia Augusta lassen an der Historizität dieser Behauptung Zweifel aufkommen.48 Darüber hinaus wäre kaum einzusehen, warum der Senat auf eigene Veranlassung eine ihm so verhasste Institution wieder eingeführt hätte. Unabhängig von der singulär überlieferten Behauptung in der Historia Augusta berichtet der byzantinische christliche Autor Zonaras, dass Decius Valerian für die Finanzverwaltung herangezogen und beide sich gegenseitig zum Kampf gegen die Christen ermuntert hätten.49 Ein wahrer Kern mag in den Nachrichten der Historia Augusta und des Zonaras nur darin liegen, dass Valerian eine nicht unwichtige, wohl jedoch reguläre Stellung unter Decius eingenommen hat und in dieser Funktion auch mit der Durchführung des Opferedikts zu tun gehabt haben könnte.50
Die zweifellos wichtigste Aufgabe des Kaisers war die Niederschlagung von Aufständen und die Verteidigung der Grenzprovinzen. Diese Tatsache muss betont werden, da die Quellen für diese Aktivitäten spärlich fließen, im Gegensatz zu den christlichen Quellen, die bei einem flüchtigen Studium den Eindruck erwecken, dass der ganze römische Staatsapparat unter Decius pausenlos mit der Lösung der Christenfrage beschäftigt gewesen wäre. In Gallien soll Decius einen Aufstand niedergeschlagen haben.51 Die Legende victoria Germanica auf einer seiner Münzen weist auf einen Sieg gegen germanische Eindringlinge.52 In der zweiten Hälfte des Jahres 250 erhob sich Iulius Valens Licinianus in Rom, wurde zum Kaiser ausgerufen und kurz danach beseitigt.53 Die massivste Bedrohung des Reiches und der Herrschaft des Decius erfolgte jedoch an der unteren Donau.54 Am Beginn des Jahres 250 brachen germanische Verbände unter der Führung des Gotenkönigs Kniva in Mösien ein. Große Teile Thrakiens, Dakiens und Moesiens standen Plünderungen offen. Nach der Überwindung des Flusses Alutus trennten sich die Karpen von den Goten und marschierten nach Dakien, während Kniva mit seinen Einheiten die Donau überschritt und in Niedermoesien einfiel; andere Truppenteile durchstreiften die niedermoesische Dobrudscha und begannen Vorbereitungen, das thrakische Philippopolis zu belagern. Hatte Decius selbst die großen Erfolge der Goten verursacht, nachdem er für seine Usurpation große Truppenteile abgezogen hatte,55 sie in Italien stationiert hielt,56 weil er einen Persekrieg plante?57 Zunächst schickte er seinen Sohn Herennius mit einem Heer gegen die Goten, griff jedoch im Hochsommer 250 persönlich in die Kämpfe ein. Dakien konnte Decius von den Karpen befreien58, während Trebonianus Gallus, der Statthalter beider Moesien, Novae von der Umklammerung durch die Goten unter Kniva zu befreien vermochte. Danach war Trebonianus Gallus jedoch gezwungen, sich mit den geschwächten Einheiten nach Nikopolis ad Istrum zurückzuziehen, wo er prompt von nachsetzenden Goten belagert wurde. Die Eroberung der Stadt konnte gerade noch durch das überraschende Auftreten des Kaisers verhindert werden und die Goten erlitten sogar eine Niederlage. Sie zogen sich jedoch nicht über die Grenze zurück, sondern drangen weiter nach Süden vor, um sich mit jenen Goten zu vereinigen, die das thrakische Philippopolis belagerten. Bei der Verfolgung erlitten die Truppen des Kaisers eine schwere Niederlage und mussten sich nach Moesien zurückziehen. Ein Einsatz der geschwächten Einheiten war nicht mehr möglich, Philippopolis konnte auf keine Befreiung mehr hoffen. Der Befehlshaber der Stadt, Priscus, konnte auch durch die Ausrufung zum Kaiser und einem Abkommen mit den Goten nicht mehr ihre Eroberung und Plünderung verhindern. Im Frühjahr 251 setzte der Kaiser die militärischen Operationen fort. Nachdem er Verhandlungen abgelehnt hatte, stellte er die Goten, die mit reicher Beute beladen den Rückmarsch antraten, bei Abrittus im unteren Moesien zur Entscheidungsschlacht. Zunächst hatten die römischen Truppen die Oberhand, obgleich gleich zu Beginn der Schlacht Herennius, der Sohn des Kaisers, gefallen war. Als fatal erwies sich jedoch, dass der Kaiser mit einem großen Teil seiner Armee in einen Sumpf geriet und umkam.59 Trebonianus Gallus wurde nun von den Soldaten zum Kaiser ausgerufen und musste mit den Goten einen Vertrag schließen, der ihnen freies Geleit und die Zahlung von Jahresgeldern zusicherte.60
3. Decius’ Religiosität
Direkte Zeugnisse der Religionspolitik des Kaisers gibt es auf Grund seiner nur zwei Jahre langen Regierungsdauer nur in geringer Zahl.
Das geistige Umfeld der Zeit hat die Forschung wiederholt für Vergleiche herangezogen. Das dritte Jahrhundert war von einem tiefen Wandlungsprozess erfasst. Äußerer Anlass waren die häufigen Einfälle von germanischen Stämmen in die westlichen und nördlichen Provinzen am Rhein und an der Donau; während die aggressive Politik des Neuperserreichs die östlichen Provinzen stark in Mitleidenschaft zog. Die Zeitgenossen maßen die Verhältnisse an der Vergangenheit und erwarteten von der Regierung energische Maßnahmen: Am Beginn des dritten Jahrhunderts forderte Cassius Dio in seiner Mäcenasrede im zweiundfünfzigsten Buch seiner römischen Geschichte einschneidende Reformen, die sich an denen des Kaisers Augustus orientieren sollten.61 Sein jüngerer Zeitgenosse Herodian kritisierte aktuellen Fehlentwicklungen, während der unbekannte Verfasser eines Panegyrikus in der Mitte des Jahrhunderts seinen Traum von einem Kaiser wiedergab, der auf wunderbare Weise allen Problemen Herr werden konnte. Zur gleichen Zeit sah der karthagische Bischof Cyprian aufgrund der irdischen Verhältnisse dagegen schon das Weltende heran gekommen.62 Gar von einem „Zeitalter der Angst“ hat die Forschung gesprochen.63 Zahllose Münzemissionen kurzlebiger Kaiser, die unzählige Siege und ungezählte Restaurationserfolge feierten, konnten kaum die Stimmung unter der Bevölkerung heben. Doch zeigt dieses Jahrhundert einen ambivalenten Charakter. Entscheidende Anpassungen in Verwaltung und Armee wurden begonnen, gefährdete Grenzregionen erhielten besondere Förderung, neue, allerdings befestigte, Wirtschaftsagglomerate entstanden, und schließlich wurden trotz dem äußeren Druck und inneren Widerständen mit dem Herrschaftsantritt des Diokletian stabilere Verhältnisse erreicht, allerding erst über dreißig Jahre nach Decius’ Tod.64 All diese Erscheinungen und Entwicklungen standen zwar auch im Hintergrund der Regierungspolitik des Decius, doch können sie nicht undifferenziert für spezifische Maßnahmen des Decius verantwortlich gemacht werden. Wohin das führt, zeigt die brillante, aber dennoch verfehlte Konzeption von Joseph Vogt, die als „großer Wurf“ noch immer einen immensen Einfluss ausübt.65 Vogt entwirft ein politisches Programm reich an Ideologie und Religion auf heidnischer Seite, jedoch ohne einen quellenmäßig relevanten Bezug zu Decius selbst herstellen zu können, während er auf christlicher Seite vor allem durch die Schriften des Tertullian ein ideologisch-religiöses Gegenkonzept zu den dii populi Romani66 entwirft, ohne jedoch einen Beleg von christlicher Seite zu einem Ereignis der decianischen Zeit finden zu können. Bedenkenlos wird dann der wissenschaftsgeschichtlich traditionell verankerte Begriff der „Krise des 3. Jahrhunderts“67 pauschal für die Regierungspolitik des Decius beansprucht. Schließlich wird die Parallele zu einer anderen „Christenverfolgung“, in diesem Fall zu einer in Japan am Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als Vergleich herangezogen.68
Erst eine detaillierte Analyse der Quellen, die ihre Entstehung dem direkten Einfluss des Kaisers verdanken oder zumindest seine Taten reflektieren, könnte religiöse Vorstellungen des Decius erkennen lassen.
A. Die Konsekrationsmünzen
In der römischen Münzprägung nimmt Decius’ Serie der divi eine einmalige Stellung ein.69 Die Emission einer Konsekrationsmünze zu Ehren eines einzelnen verstorbenen Mitglieds des Kaiserhauses war nicht ungewöhnlich, die Prägung einer ganzen Serie dagegen schon. Decius’ Sonderemission erfolgte in der Form von Doppeldenaren, den Antoninianen, deren Vorderseite jeweils die Legende divo mit dem Namen des geehrten Kaisers trägt und sein Haupt mit der Strahlenkrone abbildet. Die Hinterseite trägt die Legende consecratio und zeigt die Symbole der Divinisierung, d.h. entweder einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln oder einen Altar mit Brandopfer.
Für die Politik des Kaisers Decius von Bedeutung sind zwei Fragen: 1. nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der divi? Dieser Frage wird hier nachgegangen. 2. welche Bedeutung hatte die kultische Verehrung der divi bei der Durchführung des Opferedikts? Diese Frage wird später untersucht.70
Die Zahl der divi ist elf, ihre Auswahl beschränkt sich auf Augustus, Vespasianus, Titus, Nerva, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimius Severus und Severus Alexander. Die berücksichtigten Kaiser sind ebenso auffällig wie die übergangenen: so fand der für seine skurrilen Eigenheiten berüchtigte Claudius ebenso wenig Berücksichtigung wie Lucius Verus, der wohl in der Vorstellung seiner Nachfolger zu sehr im Schatten seines Mitregenten Mark Aurel stand. Commodus hingegen fand trotz seiner ruhmlosen Regierung Aufnahme. Seine Divinisierung durch Septimius Severus, der seinerseits durch eine fiktive Adoption durch Mark Aurel zum Stiefbruder des Commodus aufstieg, hob die damnatio memoriae des Senats auf. Pertinax hingegen fehlt in der Ahnengalerie, obwohl er ebenso auf Betreiben des Septimius Severus divinisiert wurde und darüber hinaus als senatstreuer Kaiser anerkannt war. Das Fehlen des Caracalla ist vor allem deswegen auffällig, da er bei den Soldaten beliebt gewesen war und ein bedeutender Teil von Neuprägungen üblicherweise für den Sold der Soldaten bestimmt war. Die Versuche, die Aufnahme bzw. das Fehlen einzelner Kaiser zu klären, greifen meiner Meinung nach zu kurz.71 Ein Vergleich mit Quellengattungen, die Serien von Mitgliedern des Kaiserhauses verzeichnen, verspricht hier überzeugendere Ergebnisse:
Davor sind jedoch noch einige Bemerkungen zur Entstehung des Kaiserkults nötig. Die Vergöttlichung von Menschen geht auf eine vorrömische Tradition zurück. Mit ihr verknüpfte Vorstellungen stehen mit dem griechischen Heroenkult und darauf aufbauend seit Alexander dem Großen mit dem Herrscherkult in Verbindung. In Rom erlangt seit der Machtübernahme des Augustus die Vergöttlichung des Vorgängers, d.h. in diesem Fall Cäsars, eine besondere Rolle in der Herrschaftslegitimation. Augustus wird damit als adoptierter Sohn und Nachfolger Cäsars zum divi filius. Die Kaiser nach Augustus schließen durch die consecratio ihres jeweiligen Vorgängers direkt an deren Machtposition an. Neue Dynastien halten an diesem Brauch fest und knüpfen so an die Vorgängerdynastien an. An der consecratio selbst ändern die christlichen Kaiser seit Konstantin wenig, ihr religiöser Gehalt tritt jedoch ganz in den Hintergrund.72
Ebenso alt ist die Idee, eine Serie von Personen in einem einheitlichen künstlerischen Rahmen zu vereinen.73 Als literarisches Werke sind etwa die Heldenschau im sechsten Buch des Vergil zu nennen oder die Imagines des Terentius Varro, in denen siebenhundert Römer ebenso vielen Griechen in Text und Bild gegenüber gestellt sind.74 Sueton wiederum widmet den frühen Kaisern eine Serie von Biographien. Die Aufstellung von Statuengruppen erfolgte schon bei den Griechen. Standen in archäischer Zeit neben Göttern nur Heroen, so waren es später auch Sterbliche – Könige, Feldherren, Stifter.75 Noch später schuf man Portraitreihen von Philosophen und Dichtern.76 Seit dem Durchbruch des dynastischen Denkens und damit auch des Herrscherkults unter Alexander dem Großen kamen Denkmäler von lebenden und verstorbenen Mitgliedern hellenistischer Königshäuser hinzu. Die Senatoren der römischen Republik folgten diesem Brauch der Griechen,77 seit Augustus beherrschte schließlich der Kaiser mit seiner Familie in Form wirklicher oder fiktiven Ahnengalerien den öffentlichen Raum.78 So waren Plätze,79 Tempel80 und Privatheiligtümer81 voll mit ihren Statuen.82 Ein eindrucksvolles Ensemble83 bildet etwa das Sebasteion von Boubon in Nordkilikien. Es wurde unter Nero gegründet und hatte bis über die Regierungszeit des Decius Bestand. Das Sebasteion zeichnet sich architektonisch weder durch Gliederung noch Schmuck besonders aus. Es hat einen u-förmigen Grundriss und die geringe Größe von 4,80 m x 6,50 m. Es besteht eigentlich nur aus einem Raum von mehreren, die sich alle zu einer Stoa, einer Agora oder einem Temenos hin öffnen. Im Sebasteion standen Statuenbasen mit Aufschriften und einige Bronzestatuen von hoher Qualität. In seiner letzten Phase befanden sich in ihm vierzehn Statuen von Kaisern und Kaiserinnen und ihren Söhnen.84 Caracalla war zweimal vertreten, einmal als Kind und ein anderes Mal als Erwachsener. Offenbar wurden routinemäßig lebende Mitglieder der herrschenden Dynastie neben die Statuen verstorbener divinisierter Kaiser gestellt.85 Solche Serien auf Inschriften und in Kalendern übten neben den Emissionen für Einzelpersonen der kaiserlichen Familie Einfluss auf die Konsekrationsmünzen des Kaisers Decius aus.
Dass Decius und seine Berater die Auswahl der divi nicht zufällig trafen, sondern mit ihr einer Tradition folgten, zeigt ein Vergleich mit Serien von divi bzw. divae in anderen Quellen: 1. nach der modernen Forschung,86 2. nach den Akten der fratres Arvales,87 3. nach dem feriale Duranum,88 4. nach den Konsekrationsmünzen,89 5. nach der Serie der decianischen Konsekrationsmünzen, 6.–8. nach den Listen des Chronographen von 354.90
| 1. Divi et divae | 2. Arvalakten | 3. Feriale Duranum | 4. Konsekrationsmünzen | 5. Decius’ Konsekrationsmünzen | 6. Chronograph: imperia caesarum | 7. Chronograph: natales caesarum | 8. Chrono- graph: fasti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Caesar | x | x | |||||
| AUGUSTUS | x | x | x | X | x | x | x |
| Livia | x | x | |||||
| Drusilla | |||||||
| Claudius | x | x | x | ||||
| Agrippina | |||||||
| Claudia | |||||||
| Poppaea | x | ||||||
| Nero | |||||||
| Galba | |||||||
| VESPASIAN | x | ? | x | X | x | x | o |
| Domitilla mai. | |||||||
| Domitilla min. | x | ||||||
| TITUS | x | ? | x | X | x | x | x |
| Julia | x | ||||||
| Sohn Domitians | x | ||||||
| NERVA | x | ? | x | X | x | o | |
| TRAJAN | x | x | x | X | x | o | |
| Vater Trajans | x | ||||||
| Marciana | x | x | |||||
| Matidia | x | x | |||||
| Plotina | x | x | |||||
| HADRIAN | x | x | x | X | x | x | |
| Antinoos | |||||||
| Sabina | x | x | |||||
| ANT. PIUS | x | x | x | X | o | o | |
| Faustina maior | x | x | |||||
| M. AUREL | x | x | x | X | o | o | |
| Lucius Verus | x | ? | x | x | x | x | |
| Faustina min. | x | x | x | ||||
| Lucilla | |||||||
| COMMOD. | x | x | x | X | |||
| Crispina | ? | ||||||
| Pertinax | x | x | x | x | x | ||
| SEPT. SEV. | x | x | x | X | x | x | x |
| Caracalla | x | x | x | ||||
| Julia Domna | x | ||||||
| Julia Maesa | x | x | |||||
| SEV. ALEX. | o | X | x | o | |||
| Paulina | x | ||||||
| Gordianus I. | |||||||
| Gordianus II. | |||||||
| Gordianus III. | x | o | |||||
| Philippus Arabs | |||||||
| Decius |
Auffällig ist, dass die Serie des Decius mit den anderer Quellen weitgehend übereinstimmt: Die frühen diviniserten Kaiser – Augustus, Vespasianus, Titus, Nerva, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius und Marcus Aurelius scheinen in allen Listen auf. Commodus wird von Decius noch berücksichtigt, findet jedoch im hundert Jahre jüngeren Chronographen von 354 keine Aufnahme mehr. Der Begründer der severischen Dynastie, Septimius Severus, hingegen ist wieder überall vertreten, während Severus Alexander erst von Decius einer Konsekrationsmünze wert befunden wird und er noch bis zum Chronographen von 354 populär bleibt. Das Interesse an Claudius ist kurz nach seinem Tod ebenso erloschen, wie das an Caracalla. Nach dem Ausweis der anderen Listen hätte Lucius Verus und Pertinax eine Aufnahme in der Konsekrationsserie des Decius verdient. Decius selbst findet, wie viele andere kurz regierende Soldatenkaiser, keine Aufnahme im Chronographen von 354. Divinisierte weibliche Mitglieder des Kaiserhauses erhalten bestenfalls in Einzelfällen kurz nach ihrem Tod eine Konsekrationsmünze, ihre Namen scheinen in den Kalendern nur auf, solange die Dynastie, der sie angehören, an der Macht ist. Die divae fehlen auch in der Konsekrationsserie des Decius.
Die Serie der decianischen Konsekrationsmünzen besteht aus elf Kaisern.91 Diese Zahl findet keine Übereinstimmung in anderen Quellen. Wie der Vergleich in der Tabelle zeigt, ist die Anzahl der tatsächlich divinisierten Personen bis zur Zeit des Decius größer. Johannes Chrysostomos (4. Jh.) will wissen, dass mit der Konsekration des Alexander Severus (235) die Zahl von dreizehn Göttern, d.h. vergöttlichten Kaisern, erreicht worden sei.92 Diese Zahl stimmt jedenfalls mit keiner historisch überlieferten Zahl zusammen. Im Gegenteil, sowohl die Zahl der divinisierten Personen war unterschiedlich als auch deren Auswahl veränderlich. Es gibt zwar große Übereinstimmung, Listen93 wurden jedoch ständig dem dynastischen Interesse angepasst bzw. nach politischen Opportunitäten verändert. Besonders Berücksichtigung finden: jüngst verstorbene Mitglieder des regierende Kaiserhauses und Kaiser am Anfang und Ende einer bedeutenden Dynastie, wobei vor allem die Letztgenannten den Anschluss an die großen römischen Kaiser der Vergangenheit garantierten.
Was hat Decius zur Emission der Konsekrationsmünzen veranlasst? Die politische Bedeutung von Religion wird durch die Betonung der divi sicher unterstrichen. In der übrigen Reichsprägung94 des Decius gibt es hingegen zwar allegorische Motive abstrakter Tugenden und Gottheiten, aber heidnische anthropomorphe Götter sucht man vergeblich, mit Ausnahme der Göttin Roma.95 Dieser Befund deckt sich erstaunlicherweise mit der Münzprägung der späteren, christlichen Kaiser, die ebenfalls von den alten Göttern allein Roma als Personifikation des Imperium Romanum noch Platz in ihrer Münzprägung einräumten. Ein genuin religiöses Motiv scheint also nicht in Decius’ Interesse gestanden zu haben, eher war es der Versuch, an die großen Kaiser der Vergangenheit anzuschließen. Ein Bestreben, das sich auch durch Decius’ Annahme des Namens Traianus zeigt.96 Trajan als optimus princeps ist auch in seiner Konsekrationsserie vertreten. Die Betonung dynastischer Kontinuität lag ganz im Interesse des durch Usurpation an die Macht gelangten Kaisers. Der religiöse Aspekt tritt gegenüber dem dynastischen dagegen weitgehend in den Hintergrund. Eine persönliche religiöse Überzeugung bzw. eine eigenständige Religionspolitik des Decius vermag ich in seiner Serie von Konsekrationsmünzen nicht zu erkennen.
B. Decius’ und Herennius’ Reskript an die Aphrodisier
Direkten Einfluss übte Decius auf seine Gesetzgebung aus. Die wenigen Fragmente von ihr im Codex Justinianus geben jedoch keinen Aufschluss über die Politik des Kaisers.97 Aus literarisch überlieferten Paraphrasen seiner Gesetze ist wiederum ihr ursprünglicher Wortlaut nicht von der Interpretation des – meist christlichen – Autors zu trennen. Die Folgen von Decius’ Gesetzgebung mögen sich in ihren Darstellungen noch widerspiegeln, die Versuche moderner Autoren, aus ihnen Ursachen abzuleiten, bleiben aber hypothetisch.98
Die Abschrift eines Dokuments hat jedoch beinahe unbeschädigt die Jahrhunderte überdauert. Es ist ein Brief an die Bewohner von Aphrodisias in Karien, der als Absender Kaiser Decius und seinen Sohn Herennius getragen hat.99 Der Brief wurde eingemeißelt auf einem Steinblock gefunden, der sekundär in der Stadtmauer von Aphrodisias verbaut war. Die Nennung der Titulatur erlaubt eine Datierung zwischen dem 10. und 31. Dezember 250. Der Brief wurde als Antwortschreiben (rescriptum) abgefasst, der Gesetzescharakter besaß. Der Kaiser bedankte sich schriftlich für erwiesene „gerechte Opfer und Gebete“100 aus Anlass seines Herrschaftsantritts:
αὐτοκράτωρ Καῖσαρ [Γάϊος̣ Μέσ̣σ̣ι̣ος̣ Κόϊν̣τ̣ος̣ Τ̣[ραϊα]ν̣ὸς̣] | [Δ̣[έκ]ι̣ος̣] Εὐσεβὴς Εὐτυχὴς Σεβαστός, δημαρχικῆς | ἐξουσίας τὸ γʹ, ὕπατος τὸ βʹ, ἀποδεδειγμένος τὸ τρίτον, | πατὴρ πατρίδος, ἀνθύπατος καὶ [Κόϊν̣τ̣ος̣ Ἑ̣ρ̣έν̣ν̣ι̣ος̣ Ἐ̣τ̣ρ̣οῦσ̣κ̣ο[ς]] | [Μέσ̣σ̣ι̣ος̣ Δ̣έκ̣ι̣ος̣,] ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας | τὸ πρῶτον, ὕπατος ἀποδεδειγμένος, Ἀφροδεισιέων τοῖς | ἄρχουσιν καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν· | εἰκὸς ἦν ὑμᾶς καὶ διὰ τὴν ἐπώνυμον τῆς πόλεως θεὸν καὶ | διὰ τὴν πρὸς Ῥωμαίους οἰκειότητά τε καὶ πίστιν ἡσθῆναι | μὲν ἐπὶ τῇ καταστάσει τῆς βασιλείας τῆς ἡμετέρας | θυσíας δὲ καí εὐχὰς ἀποδοῦναι δικαíας καὶ ἡμεῖς δὲ | τήν τε ἐλευθερίαν ὑμεῖν φυλάττομεν τὴν ὑπάρχουσαν | καὶ τὰ ἄλλα δὲ σύνπαντα δίκαια ὁπόσων παρὰ τῶν πρὸ ἡ-|μῶν αὐτοκρατόρων τετυχήκατε συναύξειν ἑτοίμως | ἔχοντες ὑμῶν καὶ τὰς πρὸς τὸ μέλλον ἐλπίδας. | v ἐπρέσβευον Αὐρήλιοι Θεόδωρος καὶ Ὀνήσιμος. | vacat εὐτυχεῖτε vacat.
Details
- Pages
- 252
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631913628
- ISBN (ePUB)
- 9783631913635
- ISBN (Softcover)
- 9783631889855
- DOI
- 10.3726/b21487
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (July)
- Keywords
- Decius und Cyprian Kaiser Philipp ein Christ? Konsekrationsmünzen Supplicatio zum dies imperii Juden, Soldaten bzw Sklaven und das Opferedikt Opferbestätigung und Zensuseingabe Eine Christenverfolgung?
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 252 S., 12 farb. Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG