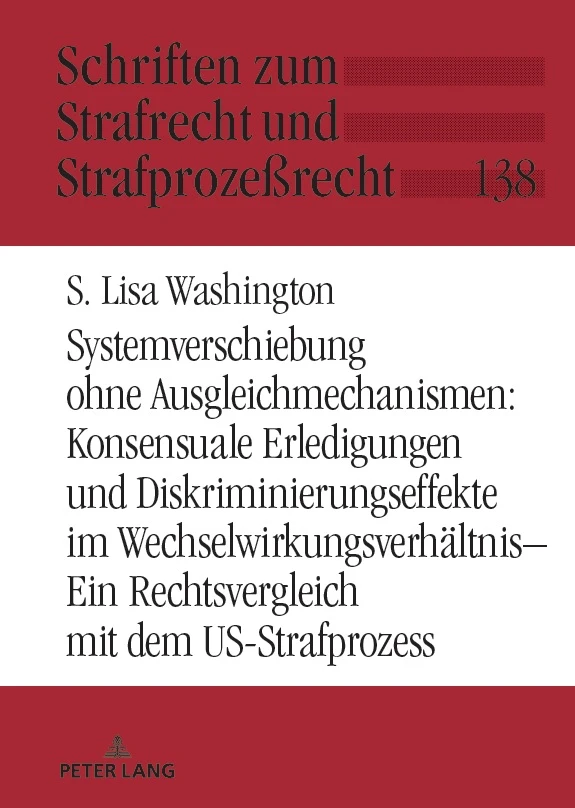Systemverschiebung ohne Ausgleichmechanismen: Konsensuale Erledigungen und Diskriminierungseffekte im Wechselwirkungsverhältnis
Ein Rechtsvergleich mit dem US-Strafprozess
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Grundlagen
- A. Telos strafrechtlicher Rechtsvergleichung in einer globalisierten Welt
- B. Methodik der Rechtsvergleichung
- I. Die Funktionale Methode
- 1. Prämisse und Inhalt
- 2. Kritik
- II. Alternativen zur funktionalen Methode
- 1. Ökonomische Analyse und Rechtsvergleichung
- 2. Konzeptuelle Methode der Rechtsvergleichung von Brand
- 3. Das Drei-Phasen-Modell
- 4. Dialektische Methode
- 5. Postmoderne Strömungen
- 6. Stellungnahme
- III. Absprachen in den USA und Deutschland im Rechtsvergleich
- C. Konsensuale Erledigung – eine Begriffsbestimmung
- Kapitel 2: Plea Bargaining als Ursache und Symptom der US-amerikanischen Criminal Justice Krise – Risiken Entsprechender Effekte in Deutschland
- A. Moderne Entwicklungen des US-Strafjustizsystems
- I. Überkriminalisierung und Abkehr vom Rehabilitationsgedanken
- II. Diskriminierungseffekte: Fehler oder inhärenter Bestandteil des Systems?
- III. Vorverlagerung
- IV. Reformüberlegungen und Kritik
- V. Parallele Entwicklungen in Deutschland
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Insbesondere: Fehlurteile
- 3. Insbesondere: Diskriminierungseffekte
- B. Wechselwirkungsverhältnis von Plea Bargaining, Vorverlagerung und Diskriminierungseffekten
- I. Einfallstore für Plea Bargaining
- II. Diskriminierungseffekte als Symptom von Plea Bargaining
- Kapitel 3: Strukturelle Systemverschiebungen im deutschen Strafprozess im Kontext konsensualer Erledigungsmethoden: Vorverlagerung und Entformalisierung
- A. Ausweitung Konsensualer Erledigungsmethoden
- I. Einstellung unter Weisungen und Auflagen als konsensuale Erledigungsmethode gem. § 153a StPO
- 1. Empirie
- 2. § 153a StPO als konsensuale Erledigungsmethode
- 3. Vorverlagerung und Entformalisierung
- a. Vorverlagerung
- b. Entformalisierung
- aa. Vorüberlegungen
- bb. Informelle und Formelle Ausweitung
- cc. Auflagen, Weisungen und fehlende Richtlinien und Vorgaben
- dd. Zusammenfassung
- 4. Zwischenergebnis
- II. Der Strafbefehl als konsensuale Erledigungsmethode gem. §§ 407 ff. StPO
- 1. Empirie
- 2. Der Strafbefehl als konsensuale Erledigungsmethode
- 3. Vorverlagerung und Entformalisierung
- a. Vorverlagerung
- aa. Vorverlagerung in eine „Strafzumessungsphase“ – sachliche Vorverlagerung
- bb. Entscheidungen ohne Anhörung des Beschuldigten – personelle Vorverlagerung
- b. Entformalisierung
- 4. Zwischenergebnis
- III. Die Kronzeugenregelung gem. § 46b StGB als konsensuale Erledigungsmethode
- 1. Empirie
- 2. § 46b StGB als konsensuale Erledigungsmethode
- 3. Vorverlagerung und Entformalisierung
- a. Vorverlagerung
- b. Entformalisierung
- 4. Zwischenergebnis
- IV. Verständigungen nach § 257c StPO als konsensuale Erledigungsmethode
- 1. Empirie
- 2. Konsensuale Erledigungsmethode
- 3. Vorverlagerung und Entformalisierung durch Verfahrensabsprachen
- a. Vorverlagerung trotz Hauptverhandlung
- b. Entformalisierung
- 4. Zwischenergebnis
- V. Weitere konsensuale Erledigungsmethoden
- VI. Bewertung
- B. Strukturelle Systemverschiebung
- I. Grundidee des reformiert inquisitorischen Strafprozesses
- II. Strukturelle Systemverschiebung durch die Verlagerung von Prozessphasen
- 1. Vorüberlegungen zur Bedeutungssteigerung des Ermittlungsverfahrens
- 2. Beweismitteltransfer und Unmittelbarkeitsgrundsatz
- a. Grundlagen des Unmittelbarkeitsgrundsatzes
- b. Relativierung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes und Einschränkungen des Konfrontationsrechts
- 3. Zwischenergebnis
- III. Strukturelle Systemverschiebung durch personelle Verlagerung
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Ermessen als Grundlage staatsanwaltschaftlicher Machtsteigerung
- 3. Die Staatsanwaltschaft – Eine „neutrale Behörde“?
- a. Mangelnde Ausgestaltung der rechtlichen Stellung der Staatsanwaltschaft
- b. Die Relativierung des Legalitätsprinzips durch das Opportunitätsprinzip
- c. Kein Ablehnungs- oder Überprüfungsrecht staatsanwaltschaftlicher Entscheidungen (h.M.)
- d. Zwischenergebnis
- IV. Strukturelles Teilhabedefizit des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Status Quo
- a. Rechtslage
- b. „Prozesskultur“
- C. Ausblick
- Kapitel 4: Grundlegende Strukturelle Diskriminierungseffekte – Confirmation Bias & Verteidigungsdefizite im Ermittlungsverfahren
- A. Confirmation Bias und kognitive Dissonanzen
- I. Das Ermittlungsverfahren – Ausgangspunkt für „confirmation bias“
- II. Forschungsstand in den USA
- III. Zwischenbewertung – Fehlende Filtermechanismen im deutschen Strafverfahren?
- B. Verteidigungsdefizite im Ermittlungsverfahren im Wechselwirkungsverhältnis zu struktureller Prozessverschiebung
- I. Grundsätzliche Überlegungen
- II. Das Recht auf frühzeitige (Pflicht)Verteidigung im Ermittlungsverfahren
- 1. Organisation und Zugang
- a. Allgemeines
- b. Infrastrukturelle Besonderheiten
- 2. Europarechtlicher Einfluss
- a. Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
- b. Richtlinie 2016/1919 des Europäischen Parlaments und des Rates (PKH-Richtlinie)
- c. Art. 6 Abs. 3 EMRK und die Rechtsprechung des EGMR
- 3. Das System der notwendigen Verteidigung und die Pflichtverteidigung – Reform der §§ 140 ff. StPO
- a. Reform der §§ 140 ff. StPO im Einzelnen
- b. Vorläufige Bewertung der Reform der §§ 140 ff. StPO
- aa. Allgemeines
- bb. Insbesondere: Konsensuale Erledigungen und Schutzbedürftigkeit
- cc. Insbesondere: Antragserfordernis
- 4. Die Belehrung des Beschuldigten über die Verteidigerkonsultation
- a. Inhalt, Umfang und Beweisverwertungsverbote
- aa. Schweigerecht und Verteidigerkonsultation
- bb. Anwaltlicher Notdienst
- cc. Recht auf Pflichtverteidigung
- dd. Kostenfolgen
- ee. Zwischenergebnis
- b. Ein Überblick über die Belehrungspflichten in den USA
- aa. Miranda Warnings
- bb. Gideon
- c. Bewertung
- aa. Die Belehrung über die Kostenfolge nach § 465 StPO
- bb. Beweisverwertungsverbote
- 5. Zwischenbewertung: Diskriminierung ressourcenarmer Beschuldigter im Ermittlungsverfahren
- a. Vorüberlegungen
- b. Belehrung und Beweisverwertung als Einfallstor für Diskriminierungseffekte
- c. Strukturelle Abhängigkeit des Pflichtverteidigers – die Perpetuierung bestehender Diskriminierungseffekte
- III. Inhalt des Verteidigungsrechts im Ermittlungsverfahren
- 1. Beweisantragsrecht im Ermittlungsverfahren
- 2. Anwesenheits-, Hinweis-, und Fragerecht im Ermittlungsverfahren
- 3. Direkte Mitteilungspflichten
- C. Zwischenergebnis
- Kapitel 5: Spezifische Strukturelle Diskriminierungseffekte
- A. Vorüberlegungen
- I. Ausgewählte Schutzgruppen
- 1. „Race“ und rassistische Diskriminierung
- 2. Rassismuskritischer Ansatz
- 3. Der Mythos der post-rassistischen neutralen Justiz
- 4. Intersektionale Perspektive
- II. Die Disparate Impact Lehre und Implicit Bias
- III. Methode der Untersuchung
- 1. Einzelberichte, marginalisierte Wissensbestände und ihre Diskreditierung
- 2. Anwendung auf konsensuale Erledigungsmethoden – spezieller Fokus auf das Ermittlungsverfahren
- B. Biased investigations in Deutschland
- I. Bisheriger Forschungsstand
- II. Beispiel: NSU-Ermittlungen
- C. Konsensuale Erledigung
- I. Einstellung nach § 153a StPO
- 1. Strukturelle Risiken – öffentliches Interesse zwischen Neutralität und Implicit Bias
- 2. Beispiel 1 – Ablehnung des § 153a StPO, weil der Beschuldigte „Ausländer“ ist
- a. Sachverhalt und Entscheidung
- b. Kritische Analyse der staatsanwaltschaftlichen Entscheidung
- 3. Beispiel 2 – Freiheitsentziehung in einem Bagatellfall
- c. Sachverhalt und Entscheidung
- d. Kritische Analyse der Entscheidung
- 4. Zwischenergebnis
- II. Strukturelle Probleme des Strafbefehls gem. § 407 StPO
- 1. Sprachbarrieren im schriftlichen Verfahren
- 2. Immigrationsstrafrecht und Strafbefehle
- a. Direkte Effekte
- b. „Kollaterale“ Konsequenzen: Gravierende Rechtsfolgen durch immigrationsrechtliche Sanktionen
- D. Zusammenfassung
- Kapitel 6: Rechtsfiguren aus den USA – Ein Vorschlag zum Ausgleich der strukturellen Verschiebung des deutschen Strafprozesses
- A. Vorüberlegungen: Der US-Strafprozess als Vergleichsobjekt
- I. Lösungskonvergenzen
- II. „German Exceptionalism“? – Neutralität im reformiert inquisitorischen Strafprozess
- III. Zwischenergebnis
- B. Ausgleichmechanismen in den USA und ihre Übertragung auf den deutschen Strafprozess
- I. Institutionalisierte Pflichtverteidigung – Public Defense Model
- 1. Assigned counsel vs. Public defense
- a. Qualität, Unabhängigkeit und Spezialisierung
- b. Institutionalisiertes Wissen
- c. Frühzeitige Verteidigung
- d. „Holistic Defense“
- 2. Historischer Kontext – Gideon v. Wainright
- 3. Kritik und Zukunft des institutionalisierten Public Defense Systems
- 4. Anwendung
- a. Status Quo der Pflichtverteidigungsorganisation in Deutschland
- b. Zwischenergebnis
- II. Inhalt des Verteidigungsrechts – „Recht auf eigene Ermittlungen“
- 1. Subpoena vs. Beweisantragsrecht
- 2. Zwischenergebnis
- III. Ineffective assistance of counsel – Anforderungen an die Verteidigung
- 1. Vorüberlegungen
- 2. Strickland v. Washington als Ausgangspunkt
- 3. Konsensuale Erledigung und ineffective assistance
- a. Missouri v. Frye
- b. Lafler v. Cooper
- c. Padilla v. Kentucky
- 4. Zwischenergebnis
- 5. Ineffective assistance Diskussion in Deutschland
- a. Ineffective assistance als Revisionsgrund
- aa. Rechtsprechung des BGH
- bb. Darstellung der Literaturansicht unter Einbeziehung der EMRK
- b. Bewertung
- C. Zusammenfassung – Aktive Verteidigungskultur im strafprozessualen Wandel
- Ergebnisse und weiterführende Überlegungen
- A. Schutzmechanismen und Forschungsbedarf
- B. Diskriminierungseffekte und Forschungsbedarf
- Schrifttumsverzeichnis
Einleitung
Konsensuale Erledigungsmethoden sind in der deutschen Strafprozessordnung schon lange kein Randphänomen mehr. Im Gegenteil – in vielerlei Hinsicht dominieren sie den modernen deutschen Strafprozess. Die Einführung des § 257c StPO hat in der Praxis und der juristischen Literatur heftige Diskussionen ausgelöst. Zum Teil wird von dem Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren1 als vom „schwerste[n] Eingriff in das Gefüge der StPO […] seit 1877“2 gesprochen. Andere befürchten eine Amerikanisierung der deutschen Strafprozessordnung.3 Absprachen markieren aber keinesfalls den Beginn des Wandels hin zu konsensualen Erledigungen. Viel mehr reihen sie sich in eine gesetzliche und tatsächliche Prozessentwicklung ein, die schon lange Elemente konsensualer Erledigungen stärkt. § 257c StPO ist weder die älteste noch die in der Praxis bedeutendste konsensuale Erledigungsvorschrift.
Mit der Einführung der Einstellungsregelung in § 153a StPO durch das EGStGB von 1974 sollte ein Instrumentarium zur flexiblen und praktikablen Handhabung der Bagatellkriminalität geschaffen werden.4 Im Jahr 2019 gab es laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland 163.757 Einstellungen unter Auflage oder Weisungen nach § 153a StPO. Bei einer Gesamtzahl von ca. 5 Millionen erledigten Strafsachen handelt es sich mit ca. 3,4 % zunächst um einen kleinen Anteil aller Strafsachen.5 Vergleicht man diese Zahl jedoch mit dem Prozentsatz der Strafsachen, in denen die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren mit einem Antrag auf Anklage beendet – ca. 8,5 %6 –, wird die quantitative Bedeutung des § 153a StPO deutlicher. § 153a StPO ist allerdings nur eine von vielen Einstellungsvorschriften mit konsensualem Erledigungscharakter. Der Antrag auf Strafbefehl ist nach der Einstellung aus Opportunitätsgründen (§§ 153 ff. StPO) und der Einstellung wegen mangelnden Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO (ca. 28,5 %) die von der Staatsanwaltschaft am häufigsten gewählte Erledigungsform.7 Eine Gesamtzahl von 547.665 Strafbefehlsanträgen macht etwa 11 % aller Ermittlungsverfahren im Jahre 2019 aus. Mit dem Strafverfahrensänderungsgesetz (StVÄG) von 1987 sollte die Effizienz des Strafbefehlsverfahrens gesteigert werden. Heute wird dieses, neben den Einstellungsvorschriften, als „eines der wichtigsten Institute der Strafprozeßordnung zur ökonomischen Verfahrenserledigung“8 bezeichnet.
Ausgangspunkt für konsensuale Erledigungsmethoden ist nicht zuletzt die seit den 90er Jahren stattfindende Ausdehnung und Verschärfung des materiellen Strafrechts. Zum Teil wird von einem „reflexartigen Rückgriff auf das Strafrecht“ als gesellschaftlichen Steuerungsmechanismus gesprochen9 – ein Phänomen, das auch in den USA unter dem Begriff „overcriminalization“ heftig diskutiert wird.10
Ähnlich wie in Deutschland ist auch in den USA die Hauptverhandlung als zentrale Prozessphase ausgestaltet. Die Prozessrealität zeigt jedoch, dass etwa 97 % aller Strafverfahren ohne Hauptverhandlung erledigt werden.11 Dabei handelt es sich aber nicht um eine systemimmanente Entwicklung, sondern eine seit den 70er Jahren stattfindende Systemverschiebung (Kapitel 2). Die funktionale Methode der Rechtsvergleichung (Kapitel 1 B.) erlaubt es strafprozessuale Entwicklungen in Deutschland und den USA anhand ihrer Funktion in der jeweiligen Rechtsordnung zu analysieren, strukturelle Vergleiche zu ziehen und wenn möglich, entsprechende Schlüsse für die deutsche Rechtsordnung zu identifizieren und nutzbar zu machen (Kapitel 6 B.).
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt nicht auf der viel diskutierten Verfassungsmäßigkeit konsensualer Erledigungsmethoden, sondern auf strukturellen Implikationen, die de facto bereits zu einer Systemverschiebung des Strafprozesses geführt haben. Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden hierdurch produzierte oder perpetuierte Diskriminierungseffekte.12 Konsensuale Erledigungen stehen in direktem Zusammenhang zur Entformalisierung und Vorverlagerung des Strafprozesses. Entformalisierung meint hier primär die informelle Erledigung von Strafsachen außerhalb oder unter Verkürzung der Hauptverhandlung. Vorverlagerung bezieht sich in dieser Arbeit sowohl auf die Vorverlegung der Prozessphasen als auch auf die Vorverlagerung in personeller Hinsicht (Kapitel 1 C.). Die Bedeutungssteigerung des Ermittlungs- und Zwischenverfahrens zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Einerseits können Strafverfahren mittels konsensualer Erledigung bereits im Ermittlungsverfahren zu einem Abschluss kommen.13 Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft bilden hierfür die primäre Entscheidungsgrundlage. Gleichzeitig entsteht aus Sicht des Beschuldigten ein immer stärkerer Druck schon in einem frühen Verfahrensstadium zu kooperieren.14 Das liegt unter anderem an dem Beweismitteltransfer von Ermittlungs- und Zwischenverfahren in die Hauptverhandlung. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die hohe statistische Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung in der Hauptverhandlung. Ein Freispruch ist in der deutschen Strafpraxis selten und wird zum Teil sogar als „Fehler“ oder „unerwünschtes“15 Ergebnis gesehen. Unschuldige Personen sollen bereits im Ermittlungs- und Zwischenverfahren identifiziert und aus dem System herausgefiltert werden. Im Jahre 2019 gab es deutschlandweit 287.689 Urteile vor den Amtsgerichten, davon waren 252.203 Verurteilungen und 27.445 Freisprüche.16 Etwa 87,7 % der Hauptverfahren endeten also mit einer Verurteilung des Angeklagten.
Von einer signifikanten Filterwirkung des Hauptverfahrens kann kaum gesprochen werden. Die größte Filterwirkung hat das Vorverfahren. Umso problematischer ist der Mangel an Partizipationsmöglichkeiten des Beschuldigten und aktiver bzw. offensiver Verteidigung in diesem Stadium. Mit dem Bedeutungszuwachs des Vorverfahrens eng verbunden ist eine Machtzunahme der Ermittlungspersonen, die schon frühzeitig über das Ob und Wie einer konsensualen Erledigung entscheiden. Der Beschuldigte hingegen hat keinen Anspruch auf konsensuale Erledigung – auch wenn die Voraussetzungen einer einschlägigen Vorschrift vorliegen sollten.
Der Bedeutungszuwachs des Vorverfahrens und die damit einhergehende Machtsteigerung der Staatsanwaltschaft sind im Zusammenspiel mit kognitiven Verzerrungen mit spezifischen Risiken verbunden. Fehler im Ermittlungsverfahren können sich in späteren Prozessphasen fortsetzen und sind dann nur noch schwer umzulenken.17 Es besteht die gesteigerte Gefahr, dass ein einmal begonnener Ermittlungsansatz unkritisch weiterverfolgt wird (confirmation bias).18 Frühzeitige Interventionsmöglichkeiten des Beschuldigten mittels engagierter und kompetenter Verteidigung sind entscheidend. Im bisherigen deutschen Strafprozess finden sich hierfür zwar nach aktuellen Gesetzesreformen mehr Möglichkeiten,19 andererseits gibt es kaum Anstrengungen den Strafprozess – nicht nur punktuell, sondern systematisch – an strukturelle Verschiebungen zu Lasten Beschuldigter anzupassen.
Die vorliegende Arbeit argumentiert, dass passive Verteidigung in Deutschland nicht nur als rechtliches, sondern vor allem als rechtskulturelles Phänomen zu verstehen ist, welches Ermittlungsbehörden als neutrale Instanz begreift, die losgelöst von strukturellen Diskriminierungseffekten operieren. Diese rechtskulturelle Tendenz wird vor allem im Vergleich zur Verteidigungskultur in den USA deutlich. Rechtsvergleichende Betrachtungen beschränken sich häufig auf strafprozessuale Gesetze. Dabei geraten teilweise ungeschriebene, rechtskulturelle Unterschiede aus dem Fokus. Gerade aber diese Regeln bestimmen die Rolle der Ermittlungsbehörden und der Verteidigung deutlich mit (Kapitel 3 B. IV. 2. b). Die funktionale Methode der Rechtsvergleichung (Kapitel 1 B.) erlaubt es verschiedene Rechtssysteme in ihrem rechtskulturellen Kontext zu vergleichen. Diese rechtskulturellen Aspekte gehen über die bloße Einordnung eines Systems als „inquisitorisch“ oder „adversatorisch“ hinaus. Im Rahmen konsensualer Erledigungen gehört hierzu das Misstrauen gegenüber eigenständigen Ermittlungen der Verteidigung und ihre Kehrseite: die Annahme, Ermittlungsbehörden handeln rechtmäßig und neutral.
Die vorliegende Arbeit argumentiert, dass der strukturelle Wandel des deutschen Strafprozesses durch konsensuale Erledigungsmethoden ohne eine systematische Stärkung von Beschuldigtenrechten diskriminierendes Potential hat. Für marginalisierte Personen20 – finanziell benachteiligte Beschuldigte, Personen of Color21, Beschuldigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit und Beschuldigte, für die Sprachbarrieren bestehen – existieren mit der Konsensualisierung des Strafprozesses verbundene spezifische Diskriminierungseffekte (Kapitel 5). Besonders deutlich wird dies im Rahmen des § 153a StPO und der §§ 407 ff. StPO (Kapitel 5 C.). Kognitive Dissonanzen und Diskriminierungseffekte stehen in einem Wechselwirkungsverhältnis zu konsensualen Erledigungsmethoden. Gleichzeitig wurde bislang versäumt, den deutschen Strafprozess grundlegend an strukturelle Veränderungen anzupassen und Beschuldigtenrechte sowie Verteidigungsrechte effektiv zu stärken (Kapitel 4). Während die Diskussion um konsensuale Erledigungen in der verfassungsrechtlichen Grundsatzdiskussion verharrt, geraten mögliche Konsequenzen und Herausforderungen einer Systemverschiebung aus dem Fokus. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke, indem sie nicht nur eine strukturelle Analyse der Systemverschiebung vornimmt, sondern auch entsprechende strukturelle Ausgleiche behandelt (Kapitel 6), die sich aus der Betrachtung des US-Strafprozesses ergeben.
Die Untersuchung ist in sechs Kapitel geteilt. Kapitel 1 legt die methodische Grundlage der Dissertation und identifiziert die funktionale Rechtsvergleichung als primären methodischen Ansatz der darauf folgenden Überlegungen. Insbesondere Kapitel 6 vertieft die rechtsvergleichende Betrachtung. Der funktionale Ansatz erlaubt eine Problembetrachtung, die nicht allein von der eigenen Rechtsordnung ausgeht, sondern auch vorgelagerte rechtstatsächliche Phänomene berücksichtigt.
Kapitel 2 bietet einen ersten Überblick über Problemkreise des US-amerikanischen Strafprozesses, die im direkten Zusammenhang mit der dort verbreitetsten Form der konsensualen Erledigung stehen – dem plea bargaining. Kapitel 2 eröffnet die Diskussion über den Zusammenhang zwischen konsensualen Erledigungen und Diskriminierungseffekten. Der US-Strafprozess stützt sich zur Erledigung der vielen Straffälle auf plea bargaining, welches wiederum zu einer Vorverlagerung, Entformalisierung und letztlich zu einer Perpetuierung von Diskriminierungseffekten führt. Im Unterschied zum deutschen Prozess, kennt der US-Strafprozess jedoch strukturelle Ausgleichsmechanismen, die diese Effekte antizipieren.
Kapitel 3 behandelt die strukturelle Systemverschiebung des deutschen Strafprozesses durch konsensuale Erledigungsmethoden. Der Fokus liegt hierbei auf den Phänomenen der Vorverlagerung und Entformalisierung. Betrachtet wird hier nicht nur der seit 2009 prominente § 257c StPO, sondern auch die Einstellung gegen Auflagen oder Weisungen gem. § 153a StPO, der Strafbefehl nach § 407 StPO, die Kronzeugenregelung nach § 46b StGB und sonstige konsensuale Erledigungsmethoden, die elementare Bestandteile des modernen deutschen Strafverfahrens darstellen. Das Kapitel zeigt auf, dass der deutsche Strafprozess immer mehr den Charakter eines „konsensual ausgelegten Verfahrens“22 annimmt – trotz der gesetzgeberischen Behauptung, es existiere kein neues konsensuales Prozessmodell. Die Prozessrealität zeigt eine Veränderung der Gesamtstruktur, die zahlreiche Problemkreise nach sich zieht und strukturelle Lösungen verlangt. Was bedeutet diese Verschiebung für die verschiedenen Akteure des Strafverfahrens in Hinblick auf die prozessuale Waffengleichheit? Ist dem Beschuldigten eine effektive Partizipation garantiert? Welche Risiken sind hiermit verbunden und welche Schutzmechanismen existieren? Im Fokus stehen hier die Partizipation und der Schutz des Beschuldigten.
Kapitel 4 verbindet diese strukturelle Systemverschiebung mit darauf beruhenden bzw. dadurch bedingten strukturellen Diskriminierungseffekten. Die Vorverlagerung und Entformalisierung macht den deutschen Strafprozess besonders anfällig für kognitive Dissonanzen, deren Folgen im späteren Verfahren nur schwer zu korrigieren sind. Bisherige Betrachtungen konzentrieren sich meist auf institutionalisierte kognitive Dissonanzen im Zwischenverfahren. Im Ermittlungsverfahren, dessen Bedeutung stetig wächst, wird dasselbe Phänomen kaum näher betrachtet. Im Rahmen der NSU-Ermittlungen hat sich gezeigt wie kognitive Dissonanzen und Stereotype – mit schwerwiegenden Folgen – zusammenwirken können. Marginalisierte Personen sind hier besonders betroffen. Das Fehlerrisiko durch kognitive Verzerrungen wird durch ein rechtskulturelles23 Phänomen erschwert: Im Vergleich zu vielen anderen Rechtsordnungen sind deutsche Verteidigungsstrategien passiv und vor dem Hintergrund der Erwartung zu verstehen, dass die Staatsanwaltschaft als neutrale Behörde gleichermaßen für und gegen den Beschuldigten ermittelt, Verfahrensvorschriften regelmäßig einhält und ihr Ermessen ausschließliche diskriminierungsfrei einsetzt. Die passive Verteidigungsposition ist vor allem dem rechtskulturellen Verständnis der Rolle des Verteidigers geschuldet und beruht nicht primär auf rechtlichen Erwägungen. Regelmäßig wird der aktive Einsatz eines Verteidigers in Deutschland erst in der Hauptverhandlung erwartet. Ein gewisser „culture shift“ hin zu einer aktiveren, frühzeitigen Verteidigung hat sich bislang nur im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts eingestellt.24 Ein grundlegender Wandel lässt sich jedoch nicht ausmachen. Weder das derzeitige Recht auf Pflichtverteidigung noch andere Interventionsmöglichkeiten – beispielsweise das Beweisantragsrecht – sind ausreichend als Schutz- bzw. Filtermechanismen ausgestaltet.
Kapitel 5 vertieft die in Kapitel 4 begonnene Betrachtung der Diskriminierungseffekte. Der Fokus liegt in diesem Kapitel auf möglichen rassistischen Diskriminierungseffekten. Die Betrachtung legt ein kritisches25 Rassismusverständnis zu Grunde. Es geht dabei nicht primär um direkte, intendierte Ungleichbehandlungen, sondern Strukturen, die für eine Ungleichbehandlung besonders anfällig sind. Das strukturelle Diskriminierungsrisiko konsensualer Erledigungsmethoden für marginalisierte Personen wird anhand des § 153a StPO und der §§ 407 ff. StPO exemplifiziert. Mangels umfassender Datenerhebungen in Deutschland wird hier vor allem auf Einzelfälle Bezug genommen. Insofern reiht sich diese Untersuchung in eine lange Tradition US-amerikanischer Rechtswissenschaftler ein, Diskriminierungseffekte im Rechtssystem durch Einzelfalldarstellungen und marginalisiertes Wissen in den breiteren rechtswissenschaftlichen Diskurs einzubinden.26
Kapitel 6 bietet Lösungsansätze für die zuvor behandelten strukturellen Diskriminierungseffekte. In diesem Teil liegt der Fokus auf drei Mechanismen aus dem US-Strafprozess: Institutionalisierte Pflichtverteidigung, das subpoena Recht der Verteidigung und das Recht auf effektive Verteidigung des Beschuldigten. Anschließend wird die Übertragbarkeit dieser Mechanismen diskutiert. Dabei geht es nicht um eine unmittelbare Übertragung US-amerikanischer Rechtsinstitute, sondern darum, ob einige Aspekte für die Diskussion des Wandels des deutschen Strafprozesses fruchtbar gemacht werden können.
Im letzten Abschnitt werden die Problemkreise und Lösungsansätze zusammenfassend dargestellt und die Notwendigkeit weiterer Forschung aufgezeigt. Der strukturelle Fokus der vorliegenden Untersuchung macht eine übergreifende Betrachtung nationalen Rechts, europarechtlicher Vorgaben und rechtsvergleichender Elemente (USA-Deutschland) notwendig.
1 Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 29. Juli 2009, BGBl. I, 2353.
2 Stuckenberg, LR-StPO, § 257c Rn. 1.
3 Siehe Eschelbach, SSW-StGB, § 46b Rn. 1; Vogel, GA 2011, 520 (520 ff.); Rosenau, FS-Puppe, S. 1597 (1604 ff.) (Rosenau bezeichnet plea bargaining hier als Pate der Absprachen).
4 Weßlau, SK-StPO, § 153a Rn. 1.
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.6, 2019, S. 26.
6 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.6 2019, S. 26.
7 Dies ergibt sich aus den Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2019, vgl. hierfür Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 2.6, 2019, S. 26. Bezieht man alle Einstellungen aus Opportunitätsgründen mit ein (z. B. §§ 154 ff. StPO) ist das Feld noch breiter.
8 Siehe den „Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege“, BT-Drs. 12/1217, S. 42 (Gesetzesentwurf des Bundesrates).
9 Singelnstein, ZfRSoz 2014, 321 (325).
10 Siehe beispielsweise Dervan, J. L. Econ. & Pol’y 2011, 645 (649) (“By the turn of the twentieth century, plea bargaining was on the rise as overcriminalization flourished and courts became weighed down with ever growing dockets”); Yankah, New Crim. L. Rev 2011, 1 (1 ff.).
11 Siehe ausführlich hierzu National Association of Criminal Defense Lawyers, The Trial Penalty: The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save it, 2018, S. 14, https://www.nacdl.org/getattachment/95b7f0f5-90df-4f9f-9115-520b3f58036a/the-trial-penalty-the-sixth-amendment-right-to-trial-on-the-verge-of-extinction-and-how-to-save-it.pdf (zuletzt abgerufen am 3. April 2023).
12 Siehe zur Ungleichbehandlung finanziell benachteiligter Beschuldigter durch Absprachen und den Strafbefehl, Stratenwerth, GA 2013, 111.
13 So beispielsweise bei § 153a und §§ 407 ff. StPO.
14 So geht Sauer davon aus, dass vor allem konsensuale Einstellungsvorschriften unschuldige Beschuldigte unter Kooperationsdruck setzen, vgl. Sauer, Konsensuale Verfahrensweisen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Rn. 8.
15 So Thielmann, ZRP 2010, 89 (89).
16 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.3, 2019, S. 32.
17 Peters, Fehlerquellen im Strafprozeß, Bd. 2, S. 212.
18 Schmitz, Tatgeschehen, Zeugen und Polizei, S. 208 ff.
19 Insbesondere durch die Reform der notwendigen Verteidigung durch das Gesetz zur Stärkung der notwendigen Verteidigung vom 10.12.2019, BGBl. 2019, 2128.
20 Marginalisierung meint hier den sozialen Vorgang, bei dem bestimmte Personen oder Personengruppen an den „Rand der Gesellschaft“ gedrängt werden. Die Marginalisierung einer Person oder Personengruppe beruht auf tiefsitzenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Siehe ausführlich hierzu Wimmer, ZQF 2018, 271 (271 ff.).
21 Aus dem Englischen „People of Color“ (Singular: Person of Color) ist eine Selbstbezeichnung für nicht weiße Menschen, die Rassismus erfahren können. Siehe ausführlicher hierzu Kapitel 5 A. I. 1; zu dem Begriff weiß siehe auch Fn. 1022.
22 Britz, JM 2014, 301.
23 Kulturelles Phänomen meint in diesem Zusammenhang eine allgemein akzeptierte Praxis der Verfahrensbeteiligten, die sich nicht aus einer gesetzlichen Regelung, sondern aus einem kollektiven Verständnis der relevanten Akteure ergibt.
24 Ulsenheimer/Rock, M&A Review 1991, 1 (1 ff.); siehe zur Problematisierung selbstständiger Ermittlungen des Strafverteidigers in Wirtschaftsstrafsachen Spoerr, StV 2019, 697 (700 ff.).
25 Gemeint ist ein Rassismusverständnis, das rassistische Gruppierungen als ein gesellschaftliches Konstrukt und nicht auf biologischen Unterschieden beruhend versteht. Ausführlich zu diesem Begriff vgl. Kapitel 5 A. I. 2.
26 Siehe beispielsweise Bell, Faces at the Bottom of the Well, passim; Williams, The Alchemy of Race and Rights, passim; Ewick/Silbey, Law & Soc’y Rev. 1995, 197; Miller, Mich L. Rev. 1994, 485; Abrams, Cal. L. Rev. 1991, 971.
Details
- Pages
- 390
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631912249
- ISBN (ePUB)
- 9783631912256
- ISBN (Hardcover)
- 9783631901656
- DOI
- 10.3726/b21408
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (September)
- Keywords
- Absprachen Konsensuale Erledigungsmethoden Strafverteidigung Rechtsvergleichung Strafprozessrecht Funktionale Rechtsvergleichung Systemverschiebung Strukturelle Diskriminierung US-amerikanischer Strafprozess Strafverfahrensrecht
- Published
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2024. 390 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG