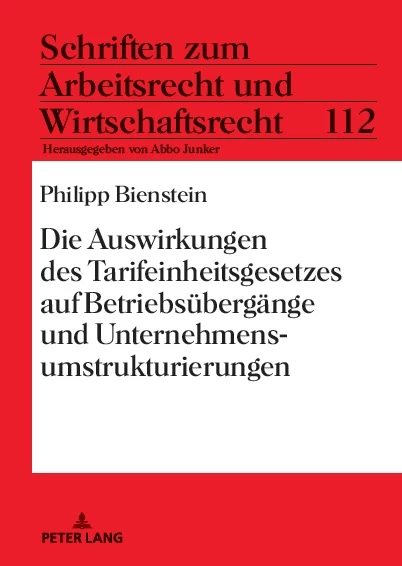Die Auswirkungen des Tarifeinheitsgesetzes auf Betriebsübergänge und Unternehmensumstrukturierungen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorbemerkung zum Gendern
- A. Einleitung und Gang der Untersuchung
- I. Einleitung
- II. Gang der Untersuchung
- B. Grundlagenteil
- I. Das Tarifeinheitsgesetz
- 1. Historische Entwicklung der Tarifeinheit bis hin zum Tarifeinheitsgesetz
- a) Erste Entwicklung im 19. Jahrhundert bis zur Weimarer Republik
- b) Erste Kodifizierung und Weimarer Republik
- c) Tarifeinheit im Nationalsozialismus
- d) Tarifeinheit nach 1945
- aa) Wiederaufleben der Gewerkschaften
- bb) Anfänge in der Bundesrepublik
- e) Entscheidung des BAG vom 29. März 1957
- f) Zeit nach der Entscheidung
- aa) Verteidigung und Verfestigung der Tarifeinheit
- bb) Ausnahmen von dieser Rechtsprechung
- (1) Individualvertragliche Inbezugnahme
- (2) Gemeinsamer Betrieb verschiedener Arbeitgeber
- (3) „Gewillkürte“ Tarifpluralität & Nachwirkung
- (4) Betriebsübergang nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB
- (5) Arbeitnehmerentsendegesetz
- g) Aufgabe der Tarifeinheit durch das Bundesarbeitsgericht
- aa) Kritik der Literatur
- bb) Kritik in der Rechtsprechung
- cc) Veränderung der Verbandslandschaft
- dd) Die Urteile des Bundesarbeitsgerichts vom 7. Juli 2010
- h) Der Weg zum Tarifeinheitsgesetz
- i) Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und Nachbesserung des Gesetzgebers
- aa) Kritik und Verfassungsbeschwerden
- bb) Entscheidung des BVerfG vom 11. Juli 2017
- cc) Nachbesserung zum 1. Januar 2019
- 2. Die gesetzliche (Neu-)Regelung
- a) Bedeutung und Zweck des Tarifeinheitsgesetzes
- aa) Funktionen der Tarifautonomie
- bb) Intention des Gesetzgebers
- b) Inhalt der gesetzlichen Neuregelung im Überblick
- c) Die Kollisionsvorschrift des § 4a Abs. 2 TVG
- aa) Begriffliche Abgrenzung zwischen Tarifkollision, Tarifkonkurrenz und Tarifpluralität
- (1) Tarifkollision
- (2) Tarifkonkurrenz
- (3) Tarifpluralität
- (4) Zwischenergebnis der Abgrenzung
- bb) Tatbestandsvoraussetzungen des § 4a Abs. 2 S. 2 TVG
- (1) Der Tatbestand des Gesetzgebers
- (a) Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften
- (b) Mehrfache Tarifbindung nach § 3 TVG
- (aa) Tarifgebundenheit nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 3 TVG
- (bb) Nicht erfasste Fälle
- (c) Überschneidung der Geltungsbereiche
- (d) Nicht inhaltsgleiche Tarifverträge
- (2) Vorgaben des BVerfG zur verfassungskonformen Auslegung
- (a) Inhaltliche Kongruenz der kollidierenden Tarifverträge
- (b) Langfristig angelegte, die Lebensplanung berührende Ansprüche
- (c) Vorherige Anhörung nach § 4a Abs. 5 TVG
- cc) Bezugspunkte der Feststellung der Mehrheitsverhältnisse
- (1) Personeller Bezugspunkt
- (a) Arbeitnehmer im Sinne des § 4a Abs. 2 S. 2 TVG
- (b) Betriebszugehörigkeit
- (2) Sachlicher Bezugspunkt der Mehrheitsfeststellung
- (a) Betriebsbegriff des Gesetzgebers
- (b) Betriebsbegriff in der Literatur
- (c) Zwischenergebnis Betriebsbegriff
- (3) Zeitlicher Bezugspunkt der Mehrheitsfeststellung
- (a) Grundsatz
- (b) Zeitlicher Bezugspunkt bei rückwirkenden Tarifverträgen
- dd) Rechtsfolge der Tarifkollision
- (1) Grundsatz
- (2) Ausnahme für betriebsverfassungsrechtliche Regelungen
- (3) Ausnahme bei anderweitiger Vereinbarung aller Parteien
- (4) Ausnahmeregelung für Alt-Tarifverträge
- (5) Ernsthafte und wirksame Berücksichtigung der Minderheitsinteressen
- (a) Inhalt der Nachbesserung
- (b) Verfassungsmäßigkeit der nachgebesserten Regelung
- (6) Wiederaufleben des Minderheitstarifvertrags
- (a) Auslaufen des Mehrheitstarifvertrages
- (b) Auslaufen des Minderheitstarifvertrages
- (aa) Planwidrige Regelungslücke
- (bb) Vergleichbare Interessenlage
- (cc) Ergebnis Analogie
- (c) Auslaufen beider Tarifverträge
- (7) Verdrängungswirkung bei rückwirkenden Tarifverträgen ex nunc oder ex tunc?
- II. Übergang von tarifvertraglichen Regelungen bei Betriebsübergängen
- 1. Grundsätzliches zu § 613a BGB
- a) Entstehung der Vorschrift
- b) Zweck und Bedeutung der Vorschrift
- 2. Tatbestandsvoraussetzungen des Betriebsübergangs
- a) Betriebs- oder Betriebsteilübergang
- aa) Betriebsbegriff
- bb) Wirtschaftliche Einheit
- (1) Einheit
- (2) Wirtschaftliche Einheit
- cc) Übergang und Wahrung der Identität
- dd) Auf Dauer
- b) Durch Rechtsgeschäft
- c) Auf einen anderen Inhaber
- aa) Begriff des Betriebsinhabers
- bb) Wechsel der Betriebsinhaber
- cc) Maßgeblicher Zeitpunkt
- 3. Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs
- a) Übergang der Arbeitsverhältnisse
- aa) Arbeitgeberwechsel
- bb) Erfasste Arbeitsverhältnisse
- cc) Zuordnung der Arbeitnehmer
- b) Fortgeltung von Tarifverträgen
- aa) Fortgeltung nach § 613a Abs. 1 S. 2-4 BGB
- (1) Das Transformationsmodell
- (2) Das Sukzessionsmodell
- (3) Die quasi-normative Fortwirkung
- (4) Erörterung der Meinungen
- (a) Auslegung im engeren Sinne
- (aa) Wortlaut
- (bb) Entstehungsgeschichte
- (cc) Systematik
- (dd) Sinn und Zweck
- (ee) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- (b) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- (c) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- (aa) Verfassungskonforme Auslegung
- (bb) Richtlinienkonforme Auslegung
- (cc) Zwischenergebnis
- (d) Fazit zur Auslegung
- bb) Lex specialis oder Auffangregelung?
- cc) Kollektivrechtliche Fortgeltung von Tarifverträgen
- (1) Einzelrechtsnachfolge
- (a) Fortgeltung von Verbandstarifverträgen
- (b) Fortgeltung von Firmentarifverträgen
- (2) Gesamtrechtsnachfolge
- (a) Fortgeltung von Verbandstarifverträgen
- (b) Fortgeltung von Firmentarifverträgen
- (aa) Erbschaft
- (bb) Verschmelzung
- (cc) Spaltung
- (dd) Vermögensübertragung
- (ee) Formwechsel
- C. Tarifkollisionen bei Betriebsübergängen
- I. Die beiden Grundkonstellationen
- II. Neuentstehende Tarifkollision durch Betriebsübergang?
- 1. Nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB fortwirkende Tarifverträge
- a) Diametral entgegenstehende Regelungsziele
- b) Auslegung von § 4a TVG
- aa) Auslegung im engeren Sinne
- (1) Wortlaut
- (2) Entstehungsgeschichte
- (3) Systematik
- (4) Sinn und Zweck
- (5) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- bb) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- cc) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- (1) Verfassungskonforme Auslegung
- (2) Richtlinienkonforme Auslegung
- (a) Verdrängung der übergehenden Tarifregelungen
- (b) Verdrängung der bestehenden Tarifregelungen im Erwerberbetrieb
- (c) Zwischenergebnis richtlinienkonforme Auslegung
- (3) Zwischenergebnis
- dd) Ergebnis bei quasi-normativ fortwirkenden Tarifverträgen
- 2. Originär-kollektivrechtlich fortwirkende Tarifverträge
- a) Auslegung im engeren Sinne
- aa) Wortlaut
- bb) Entstehungsgeschichte
- cc) Systematik
- dd) Sinn und Zweck
- ee) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- b) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- c) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- aa) Verfassungskonforme Auslegung
- bb) Richtlinienkonforme Auslegung
- (1) Verdrängung eines beim Erwerber geltenden Tarifvertrags
- (2) Verdrängung eines übergehenden Tarifvertrags
- (3) Zwischenergebnis richtlinienkonforme Auslegung
- cc) Zwischenergebnis und systemkonforme Auslegung
- d) Ergebnis bei originär-kollektivrechtlich fortwirkenden Tarifverträgen
- 3. Unternehmenstransaktionen außerhalb von Betriebsübergängen
- 4. Zusammenfassung und Gesamtergebnis
- a) Zusammenfassung
- b) Gesamtergebnis kollidierende Tarifverträge
- c) Exkurs: Tarifkollision unter Anwendung des Sukzessions- und Transformationsmodells
- aa) Transformationsmodell
- bb) Sukzessionsmodell
- cc) Fazit zum Exkurs
- III. Wann kommt es zur Auflösung von Tarifkollisionen?
- 1. Grundsatz § 4a Abs. 2 S. 2 TVG
- 2. Erweiterung § 4a Abs. 2 S. 3 TVG
- a) Erstmalige Tarifkollision unmittelbar durch Umstrukturierungsmaßnahmen
- b) Weitere Möglichkeiten im mittelbaren Zusammenhang mit Umstrukturierungsmaßnahmen
- aa) Späterer Beitritt zum tarifschließenden Verband
- bb) Nachträgliches Inkrafttreten des Tarifvertrags
- cc) Neugründung eines Betriebes
- dd) Fazit Beispiele des Gesetzgebers
- c) Sonderproblem: Erhebliche Änderung der Mehrheitsverhältnisse
- aa) Auslegung im engeren Sinne
- (1) Wortlaut
- (2) Entstehungsgeschichte
- (3) Sinn und Zweck
- (4) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- bb) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- cc) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- dd) Ergebnis erheblicher Mehrheitsänderungen
- 3. Zusammenfassung
- IV. Schicksal verdrängter Tarifverträge – Übergang bestehender Tarifkollisionen
- 1. Übergang nach 613a Abs. 1 S. 2 BGB
- a) Übergang eines verdrängten Tarifvertrags
- aa) Auslegung im engeren Sinne
- (1) Wortlaut
- (2) Entstehungsgeschichte
- (3) Systematik
- (4) Sinn und Zweck
- (5) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- bb) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- cc) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- (1) Verfassungskonforme Auslegung
- (2) Richtlinienkonforme Auslegung
- (3) Zwischenergebnis
- dd) Ergebnis
- b) Rechtsfolgen
- aa) Grundsatz
- bb) Wiederaufleben möglich?
- 2. Originär-kollektivrechtliche Fortwirkung
- a) Übergang eines verdrängten Tarifvertrags
- b) Rechtsfolgen und Auswirkungen
- V. Fiktive Fallstudie zu konkreten Auswirkungen in den Betrieben
- 1. Umstrukturierungen mit zugrundeliegendem Betriebsübergang
- a) Veräußererbetrieb
- aa) Übergang des gesamten Betriebes
- bb) Betriebsteilübergang
- (1) „Übergang des Großteils der Mehrheitsgewerkschaftsmitglieder“
- (2) „Übergang aller Gewerkschaftsmitglieder der Mehrheitsgewerkschaft“
- b) Erwerberbetrieb
- aa) Selbstständige Weiterführung des Betriebes
- (1) Gesetzliche Fortwirkung nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB
- (a) Übergang des gesamten Betriebes
- (b) Betriebsteilübergang
- (2) Originäre Fortgeltung nach § 3 TVG
- (a) Übergang des gesamten Betriebs
- (b) Betriebsteilübergang
- (3) Unterschiedlich fortwirkende Tarifverträge
- (a) Übergang des gesamten Betriebes
- (b) Betriebsteilübergang
- (4) Zwischenergebnis selbstständige Fortführung
- bb) Eingliederung in bereits bestehende Betriebe
- (1) Gesetzliche Fortwirkung nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB
- (a) Übergang gesamter Betrieb
- (b) Betriebsteilübergang
- (2) Originäre Fortgeltung nach § 3 TVG
- (a) Geltung des übergehenden Mehrheitstarifvertrags im Erwerberbetrieb
- (b) Geltung des übergehenden Minderheitstarifvertrags im Erwerberbetrieb
- (c) Mitglieder beider Gewerkschaften im Erwerberbetrieb
- (aa) Anwendung des Mehrheitstarifvertrages
- (bb) Anwendung des Minderheitstarifvertrages
- (3) Unterschiedlich fortwirkende Tarifverträge
- (a) Geltung des übergehenden Mehrheitstarifvertrags im Erwerberbetrieb
- (b) Geltung des übergehenden Minderheitstarifvertrags im Erwerberbetrieb
- (4) Erstmalige Tarifkollision durch Eingliederung
- (a) Erfordernis eines Firmentarifvertrags
- (b) Sonderproblem: Reichweite von Firmentarifverträgen
- (aa) Darstellung der Meinungen
- (bb) Entscheidung des Streits und eigene Auffassung
- (cc) Mögliche Konsequenzen durch das Tarifeinheitsgesetz
- (dd) Praxistipp Arbeitgeber
- (5) Zwischenergebnis Eingliederung
- 2. Umstrukturierungen ohne zugrundeliegenden Betriebsübergang
- 3. Zusammenfassung und Fazit
- D. Gestaltungsmöglichkeiten
- I. Gestaltungsmöglichkeiten durch Arbeitgeber
- 1. Einflussnahme durch Umstrukturierungen
- a) Unmittelbare Gestaltungsmöglichkeiten
- aa) Bereits im Betrieb vorhandener Tarifvertrag günstiger
- bb) Nicht im Betrieb vorhandener Tarifvertrag günstiger
- cc) Sonderproblem: Schutz der übergehenden Arbeitnehmer bei unternehmensinternen Umstrukturierungen
- b) Mittelbare Gestaltungsmöglichkeiten
- c) Fazit und Stellungnahme
- 2. Einflussnahme durch Vertragsgestaltung
- II. Gestaltungsmöglichkeiten durch Gewerkschaften/Gewerkschaftsmitglieder
- E. Folgeprobleme
- I. Das Nachzeichnungsrecht und quasi-normativ fortwirkenden Tarifverträge
- 1. Das Nachzeichnungsrecht nach § 4a Abs. 4 TVG
- 2. Anwendung nachgezeichneter Tarifverträge im Erwerberbetrieb
- 3. Bestehen eines Nachzeichnungsrechts bei quasi-normativer Fortwirkung
- a) Unmittelbare Anwendung von § 4a Abs. 4 TVG
- b) Analoge Anwendung von § 4a Abs. 4 TVG
- aa) Tatsächliches Bedürfnis zur Nachzeichnung bei quasi-normativer Fortwirkung
- bb) Analogie Voraussetzungen
- (1) Planwidrige Reglungslücke
- (2) Vergleichbare Interessenlage
- cc) Ergebnis
- II. Unterrichtung und Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer
- 1. Unterrichtungspflicht der Arbeitgeber
- a) Normzweck
- b) Unterrichtungsverpflichtete und -berechtigte
- c) Anforderungen an das Unterrichtungsschreiben
- aa) Formelle und zeitliche Anforderungen
- bb) Allgemeine inhaltliche Anforderungen
- cc) Sachbezogene inhaltliche Anforderung an § 613a Abs. 5 BGB
- d) Auswirkungen durch das Tarifeinheitsgesetz auf den Inhalt
- aa) Unmittelbare Folgen durch Betriebsübergang
- bb) Mittelbare Folgen durch Betriebsübergang
- cc) Schicksal verdrängter Tarifverträge
- dd) Schicksal nachgezeichneter Tarifverträge und Nachzeichnungsrecht
- ee) Ergebnis
- e) Rechtsfolgen fehlerhafter oder fehlender Unterrichtung
- 2. Das Widerspruchsrecht des § 613a Abs. 6 BGB
- a) Regelungszweck und Historie
- b) Rechtsnatur und Inhalt
- c) Form und Adressat des Widerspruchs
- d) Rechtsfolge
- e) Auswirkung der Ausübung des Widerspruchsrechts auf die Tarifgeltung in den Betrieben
- aa) Ausgangslage Mehrheitsänderungen durch Widerspruch
- (1) Veräußererbetrieb
- (2) Erwerberbetrieb
- bb) Gefahr von Rückabwicklungsproblemen
- (1) Auslegung im engeren Sinne
- (a) Wortlaut
- (b) Systematik
- (b) Entstehungsgeschichte
- (c) Sinn und Zweck
- (c) Zwischenergebnis Auslegung im engeren Sinne
- (2) Fortgeltung des Norminhalts im Anwendungszeitpunkt
- (3) Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht
- (a) Verfassungskonforme Auslegung
- (b) Richtlinienkonforme Auslegung
- (4) Ergebnis
- dd) Rechtsfolge
- F. Fazit und Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Abkürzungsverzeichnis
|
a.A. |
anderer Ansicht |
|
Abs. |
Absatz |
|
AEntG |
Arbeitnehmer-Entsendegesetz |
|
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
|
Alt. |
Alternative |
|
AOG |
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit |
|
ArbGG |
Arbeitsgerichtsgesetz |
|
ArbZG |
Arbeitszeitgesetz |
|
Aufl. |
Auflage |
|
AÜG |
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz |
|
Ausschuss-Drs. |
Auschussdrucksache |
|
BAG |
Bundesarbeitsgericht |
|
BBiG |
Berufsbildungsgesetz |
|
Bd. |
Band |
|
BDA |
Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeber |
|
BetrVG |
Betriebsverfassungsgesetz |
|
BGB |
Bürgerliches Gesetzbuch |
|
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
|
BR-Drs. |
Drucksache des Deutschen Bundesrates |
|
BT-Drs. |
Drucksache des Deutschen Bundestages |
|
BVerfG |
Bundesverfassungsgericht |
|
BVerfGG |
Bundesverfassungsgerichtsgesetz |
|
bzw. |
beziehungsweise |
|
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands |
|
CSU |
Christlich-Soziale Union in Bayern |
|
DAF |
Deutsche Arbeitsfront |
|
dbb |
DBB Beamtenbund und Tarifunion |
|
DGB |
Deutscher Gewerkschaftsbund |
|
EG |
Europäische Gemeinschaft |
|
EuGH |
Europäischer Gerichtshof |
|
EUV |
Vertrag über die Europäische Union |
|
EWG |
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
|
f., ff. |
folgend(e) |
|
FAZ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung |
|
Fn. |
Fußnote |
|
GG |
Grundgesetz |
|
HS |
Halbsatz |
|
LG |
Landgericht |
|
lit. |
littera/Buchstabe |
|
MiLoG |
Mindestlohngesetz |
|
m.w.N. |
mit weiteren Nachweisen |
|
Nr. |
Nummer |
|
RAG |
Reichsarbeitsgericht |
|
RGBl. |
Reichsgesetzblatt |
|
Rn. |
Randnummer |
|
S. |
Seite |
|
SPD |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
|
TV |
Tarifvertrag |
|
TVG |
Tarifvertragsgesetz |
|
TVVO |
Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten |
|
UmwG |
Umwandlungsgesetz |
|
v. |
Vom |
|
Vgl. |
Vergleiche |
|
WiGBl. |
Gesetzesblatt der Verwaltung des vereinigten Wirschaftsgebietes |
|
ZPO. |
Zivilprozessordnung |
Vorbemerkung zum Gendern
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. So werden personenbezogene Bezeichnungen, die sich auf alle Geschlechter beziehen, generell nur in der im Deutschen (noch) üblichen männlichen Form angeführt, also zum Beispiel „Arbeitnehmer“ statt „Arbeitnehmer:innen“ oder „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“.
Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
A. Einleitung und Gang der Untersuchung
I. Einleitung
„Ein Betrieb – ein Tarif“1
Kaum ein Grundsatz stand im Lauf der Jahre derart im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen und verbandsrechtlichen Diskussionen wie der der betrieblichen Tarifeinheit. Mit dem am 10. Juli 2015 in Kraft getretenen Tarifeinheitsgesetz ist dieses Prinzip, begleitet von einer Welle an Diskussionsbeiträgen, gesetzlich festgeschrieben worden. Nach der in § 4a Abs. 2 S. 2 TVG verankerten Kollisionsvorschrift sollen im Fall einer Kollision unterschiedlicher Tarifverträge nur die Bestimmungen desjenigen Tarifvertrages im Betrieb Anwendung finden, dessen tarifschließende Gewerkschaft die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder in diesem Betrieb stellt.
Während Fragen rund um die Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes schon vor seinem Inkrafttreten eine Vielzahl von Stimmen in der rechtswissenschaftlichen Literatur auf den Plan rief und entsprechend ausführlich diskutiert worden sind,2 stand die Auseinandersetzung mit der praktischen Handhabung der gesetzlich geschaffenen Tarifeinheit – verglichen dazu – anfänglich nicht im Zentrum der Diskussion. Ebenso fanden kaum Untersuchungen über mögliche Auswirkungen des neuen Gesetzes im Zusammenhang mit anderen Regelungsinstituten statt.3
Ein wesentlicher Grund für die wenigen Abhandlungen zur praktischen Anwendung waren sicherlich die gegen das Tarifeinheitsgesetz erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken, die sich insbesondere in den gegen das neue Gesetz erhobenen Verfassungsbeschwerden äußerten und die vor allem durch die Äußerungen der nicht im DGB organisierten Gewerkschaften medienwirksam an die Öffentlichkeit getragen worden sind.4
Nachdem das BVerfG die Vorschriften im Jahr 2017 als für „weitgehend mit Art. 9 Abs. 3 GG vereinbar“ erklärt hat,5 ist fortan die Auseinandersetzung mit der konkreten Anwendung und Handhabung der Regelungen ins Zentrum der Diskussion zu rücken.6
Mit Blick auf die Realität in den Unternehmen und Betrieben fällt ein gesondertes Augenmerk auf das Zusammenspiel zwischen dem Prinzip der betrieblichen Tarifeinheit und Unternehmensumstrukturierungen, da die objektiven Umstände einer Umstrukturierung hier möglicherweise besonders empfindlich auf die subjektiven Interessen der beteiligten Parteien treffen können und so ein besonderes Spannungsfeld erzeugen. So kommt es im Rahmen von Umstrukturierungen und Betriebsübergängen regelmäßig für eine Vielzahl von Beschäftigten zu einem Arbeitgeberwechsel, was im gleichen Zug dazu führen kann, dass sich sowohl beim Veräußerer als auch beim Erwerber die gewerkschaftlichen Strukturen ändern. In diesen Konstellationen besteht daher, wie in kaum einer anderen praktischen Situation, die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es zu Änderungen der vorherigen Mehrheitsverhältnisse der Gewerkschaftsmitglieder kommt.
Diese – möglicherweise – geänderten Mehrheitsverhältnisse können im Rahmen von Umstrukturierungen auf die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten treffen. So wird den Arbeitgebern in der Regel daran gelegen sein, dass innerhalb ihrer neu zusammengesetzten Betriebe die für sie günstigsten Tarifverträge Anwendung finden, während es im natürlichen Interesse der jeweiligen Gewerkschaft liegt, dass der von ihr abgeschlossene Tarifvertrag nicht verdrängt wird und ihre Mitglieder in den Genuss der von ihr verhandelten Tarifbestimmungen kommen.
Neben den für die Rechtsbeziehung abstrakt-generellen Fragen, ob und wann es im Rahmen eines Betriebsübergangs zu einer Tarifkollision im Sinne des Tarifeinheitsgesetzes kommen kann und wie sich die übergehenden Gewerkschaftsmitglieder auf die jeweilige Tariflage in den Betrieben auswirken können, stellen sich auch Fragen rund um das Schicksal von bereits im Vorfeld von Umstrukturierungsmaßnahmen verdrängten Tarifverträgen, etwaigen Gestaltungsmöglichkeiten der betroffenen Parteien sowie Folgeproblemen, die sich aus dem Normverhältnis zwischen dem Tarifeinheitsgesetz und den Regelungen zum Betriebsübergang ergeben können.
Die Intention dieser Arbeit besteht in einer systematisch tiefgehenden, ausführlichen Untersuchung der Handhabung und der Auswirkungen des Tarifeinheitsgesetzes bei Umstrukturierungsmaßnahmen und Betriebsübergängen. Im Mittelpunkt steht dabei das abstrakte Normverhältnis zwischen den Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes – insbesondere der Kollisionsvorschrift in § 4a Abs. 2 S. 2 TVG – und den Regelungen zum Betriebsübergang – vor allem diejenigen über die Fortwirkung kollektivrechtlicher Vereinbarungen bei Betriebsübergängen in § 613a Abs. 1 S. 2 BGB.
Ziel der Arbeit ist es aber nicht allein, die möglichen Auswirkungen zu erforschen, sondern auch die Gestaltungsmöglichkeiten der an den Umstrukturierungsmaßnahmen beteiligten Parteien herauszuarbeiten sowie Folgeprobleme offenzulegen und Lösungsmöglichkeiten anzubieten.
II. Gang der Untersuchung
Die Grundlagen der Arbeit bilden die beiden in ihrem Zusammenspiel zu untersuchenden Rechtsinstitute: Das Tarifeinheitsgesetz auf der einen und die Regelungen zum Betriebsübergang auf der anderen Seite. Im Mittelpunkt stehen dabei die Kollisionsvorschrift des Tarifeinheitsgesetzes in § 4a Abs. 2 S. 2 TVG sowie die Regelungen zum Übergang kollektivrechtlicher Vereinbarungen in § 613a Abs. 1 S. 2-4 BGB.
In einem ersten Schritt (Teil B) werden die Grundlagen der beiden Regelungsinstitute im Hinblick auf die danach erfolgende Zusammenführung geklärt.
Vor diesem Hintergrund widmet sich die Arbeit zunächst dem 2015 in Kraft getretenen Tarifeinheitsgesetz, wobei insbesondere dessen Herzstück die Kollisionsvorschrift in § 4a Abs. 2 S. 2 TVG zu untersuchen ist. Ausgehend von einem kurzen Überblick über die Geschichte der betrieblichen Tarifeinheit, die mit den tarifrechtlichen Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts begann und sich bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Nachbesserung zum 1. Januar 2019 entwickelt hat, erfolgt eine Darstellung der gesetzlichen Neuregelungen, innerhalb derer sowohl die Erwägungen des Gesetzgebers als auch die Tatbestandsvoraussetzungen der Kollisionsnorm dargelegt und erörtert werden.
Im Anschluss daran setzt sich die Arbeit mit den gesetzlichen Regelungen zum Betriebsübergang auseinander. Nach einem kurzen Überblick über die grundlegende Intention des § 613a BGB sowie die wesentlichen Merkmale eines Betriebsübergangs, behandelt das darauffolgende Kapitel ausführlich die Rechtsfolgen eines solchen. Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Auseinandersetzung mit den Regelungen über das Fortwirken von kollektivrechtlichen Vereinbarungen nach § 613a Abs. 1 S. 2-4 BGB, wobei insbesondere die für die späteren Ausführungen relevante – umstrittene – Frage nach dem Rechtscharakter der nach § 613a Abs. 1 S. 2 BGB fortwirkenden tarifvertraglichen Bestimmungen zu klären ist. Dabei ist die konkrete Fortwirkungsweise von Tarifverträgen im Wege der Auslegung der Vorschriften zu ermitteln.
Auf dieses Fundament aufbauend werden die beiden Regelungsinstitute in dem sich daran anschließenden Teil C zusammengeführt. Ausgangspunkt dieses Teils ist die Untersuchung der Frage, ob es im Zusammenhang mit Betriebsübergängen überhaupt unmittelbar zu Tarifkollisionen im Sinne des § 4a Abs. 2 S. 2 TVG kommen kann oder nicht. Inwieweit die sich diametral entgegenstehenden Regelungsziele miteinander zu vereinbaren sind, ist dabei ebenfalls durch Auslegung zu ermitteln. Die Untersuchung macht deutlich, dass sowohl eine genaue Einordnung und Unterscheidung zwischen den konkreten Arten des Normfortwirkungscharakters als auch der Umstand, ob der Umstrukturierungsmaßnahme tatbestandlich überhaupt ein Betriebsübergang zu Grunde liegt, bei der Beantwortung der Frage von entscheidender Bedeutung sein kann.
Ein weiteres Problemfeld stellt das Schicksal von Tarifverträgen dar, die bereits vor einer Umstrukturierungsmaßnahme im Betrieb des Veräußerers verdrängt waren. Hier stellen sich gleich mehrere Fragen, auf die ausführlich einzugehen sein wird: Kann ein nach § 4a Abs. 2 S. 2 TVG verdrängter Tarifvertrag auf einen anderen Betriebsinhaber übergehen? Oder können solche Tarifverträge durch einen Betriebsübergang gar wieder zur Anwendung gelangen?
An diese abstrakten Grundlagen anschließend widmet sich die Arbeit anhand einer fiktiven Fallstudie den – möglicherweise auftretenden – konkreten Auswirkungen in den von einer Umstrukturierung betroffenen Betrieben. Diese geht von einem immer wieder abzuwandelnden Ausgangsfall aus und verfolgt das Ziel, zu prüfen, ob die zuvor herausgearbeiteten abstrakten Grundsätze in ihrer praktischen Anwendung zu logischen und widerspruchsfreien Ergebnissen führen und ob die gesetzlichen Wertungen im jeweiligen Anwendungsfall eingehalten werden können.
Details
- Seiten
- 316
- Jahr
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9783631906576
- ISBN (ePUB)
- 9783631906583
- ISBN (Hardcover)
- 9783631905685
- DOI
- 10.3726/b21078
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2023 (August)
- Schlagworte
- Tarifkollision Kollidierende Tarifverträge Übergang Tarifvertrag Tarifgeltung Betriebsübergang Tarifgeltung Umstrukturierung Tarifeinheit Betriebsübergag Tarifeinheit Umstrukturierung Kollektivrechtlicher Charakter Umstrukturierung Betriebsübergang Tarifeinheitsrecht
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 316 S.