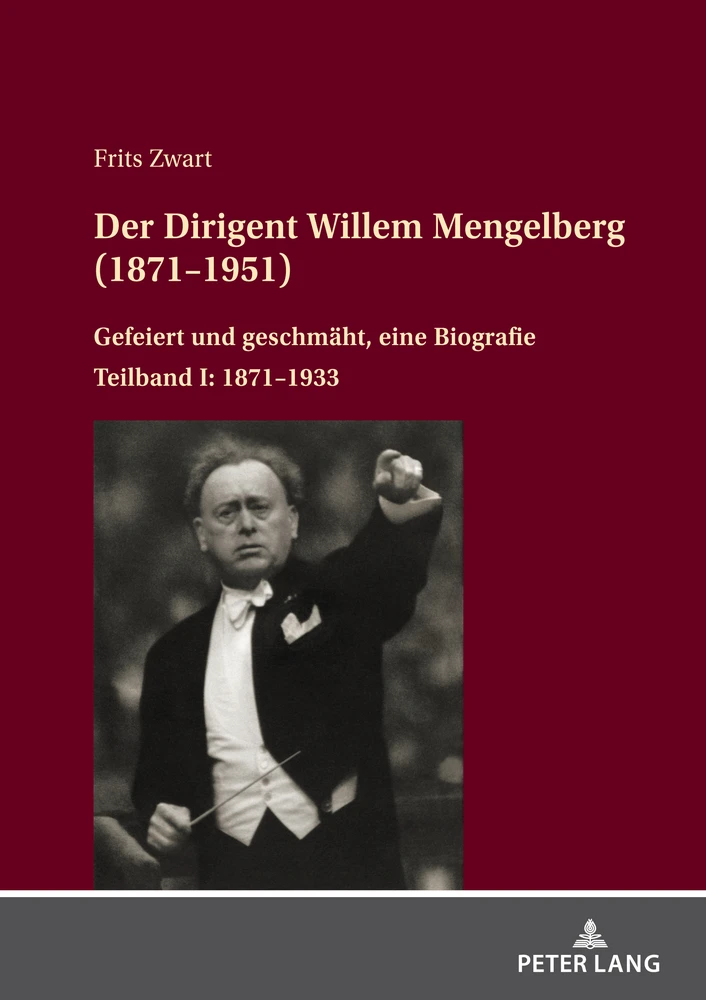Der Dirigent Willem Mengelberg (1871–1951)
Gefeiert und geschmäht, eine Biografie – Teilband I: 1871–1933
Summary
Darüber hinaus war Mengelberg ein wichtiger Förderer zahlreicher Komponisten wie Gustav Mahler und Richard Strauss sowie Begründer der jährlichen Aufführungen von Bachs Matthäuspassion in den Niederlanden. Als Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters entwickelte Mengelberg das Ensemble zu einem der renommiertesten der Welt und verschaffte seiner Residenzstadt ein Musikleben von internationalem Rang. Seine musikalische Karriere wurde allerdings durch seine umstrittene Rolle während des Zweiten Weltkriegs überschattet.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Erste Periode 1871–1895
- Zweite Periode 1895–1904
- Dritte Periode 1904–1911
- Entr’acte: Mahler und Strauss
- Vierte Periode 1911–1920
- Entr’acte: Persönliches Leben
- Fünfte Periode 1920–1930
- Sechste Periode 1930–1933
- Entr’acte: Intermezzi
Erste Periode 1871–1895
Die Familie Mengelberg: „Alle mehr oder weniger genial“12
Willem Mengelberg war mit Sicherheit der größte Dirigent in der niederländischen Musikgeschichte. Bislang scheint niemand auch nur annähernd eine derartig glanzvolle Karriere vorweisen zu können.
Um einen guten Einblick in die Persönlichkeit von Willem Mengelbergs zu gewinnen, ist es notwendig, Kenntnis über seinen Hintergrund zu erkunden: Zu erforschen, aus welchem Milieu er kam und unter welchen Umständen er aufwuchs. Unübersehbar ist, dass künstlerisches Talent sowohl in der Familie Mengelberg, als auch auf der mütterlichen Seite, der Familie Schrattenholz vorhanden war. Bei Willem Mengelbergs Vorfahren väterlicher Seite ist das künstlerische Talent in der Bildenden Kunst zum Ausdruck gekommen. Das gilt für seinen Urgroßvater Egidius Mengelberg (1770–1849), für seinen Großvater Johann Egidius Mengelberg (1814–1884) und für seinen Vater, Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837–1919). Auf der mütterlichen Seite war es bei verschiedenen Vorfahren musikalisches Talent zu erkennen: bei dem ziemlich weit entfernten Verwandten Johannes Christian Joseph Wachendorff (1754–1817), bei Wilhelm Schrattenholz (1815–1898) und bei dessen Tochter Helena, Willem Mengelbergs Mutter (1845–1930).13
Friedrich Wilhelm Mengelberg, der Vater von Willem Mengelberg, wurde am 18. Oktober 1837 in Köln geboren. Er wuchs in unmittelbarer Nähe des Kölner Doms auf und sah diese monumentale Schöpfung als wichtigste Inspirationsquelle, als er sich für eine Laufbahn als Künstler entschied. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der Dom, der im 19. Jahrhundert offiziell vollented war und gleichzeitig schon restauriert wurde, Künstlern wie Wilhelm Mengelberg Arbeit verschaffte.
Die ersten Erinnerungen an meine Jugend knüpften sich an den Kölner Dom, in dessen Nähe ich das Licht der Welt erblickte, und da ich durch Geburt mit Liebe zur Kunst erblich belastet bin, so wurde der Kölner Dom, wenn ich etwas denken wollte, der Mittelpunkt. Auch in trüben Jugendstunden erhob mich das Bild der nach oben strebenden Architektur, die bunten alten Fenster, und vor allem das Gebet der Gläubigen, die weihevolle Gesänge, die Orgelklänge, die Ceremonien des Gottesdienstes, über das Alltägliche empor. Später als ich Kunst lernte, kam die Liebe zu den Einzelheiten und so viel Kunst bietet das Innere des Kölner Domes mit Einschluß der übrigen Kölner Gotteshäuser, daß, wer seine Augen und seinen Verstand gebraucht, Eindrücke fürs ganze Leben bekommt.14
Wilhelm Mengelberg genoss seine künstlerische Ausbildung an der Mengelbergschen Sonntagsschule für Bauleute, wo er bei seinem Großvater Johann Edmund Egidius Mengelberg und dem Dombauwerkmeister Friedrich Freiherr von Schmidt in die Lehre ging. Ferner hatte er beim Kölner Bildhauer Christoph Stephann (1797–1864) seine Fähigkeiten ausbauen können.
Auch infolge seiner großen Bewunderung für die mittelalterliche Kunst konvertierte Wilhelm, als Sohn protestantischer Eltern, im Alter von 18 Jahren zum Katholizismus. Es steht wohl fest, dass seine sehr starke, unzerstörbare mit der römisch-katholischen (r.k.) Kirche verbundene Glaubensüberzeugung für seine Arbeit eine hohe Bedeutung hatte. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, nahm er 1857 in Köln seine Laufbahn als selbstständiger Künstler auf. Er war Bildhauer von vor allem kirchlicher Kunst, Architekt und Kunstmaler. Seine 1861 gemeinsam mit seinem Bruder Otto (1841–1891) eingerichteten Werkstätten für kirchliche Kunst florierten, und 1865 wurde auch in Aachen eine Zweigstelle eröffnet. Nachdem Mengelberg 1868 den Bischofsstuhl für die Kathedrale in Utrecht angefertigt hatte, wurde er ein Jahr später auch mit der Gestaltung des übrigen Kirchenmobiliars der Kathedrale beauftragt. Dies zählte unter anderem zu den Gründen, sich 1869 in den Niederlanden zu etablieren. Sein Bruder Wilhelm Edmund Mengelberg (1850–1922, Architekt, Bildhauer und Zeichner) ließ sich 1877 ebenfalls in Utrecht nieder. Otto führte weiterhin das Atelier in Köln. Nach dem Tod Ottos im Jahr 1891 kehrte Edmund nach Köln zurück, um dort die Stelle seines verstorbenen Bruders zu übernehmen. Der Erfolg des Betriebs lässt sich auch an den zahlreichen Angestellten in Utrecht ablesen: 1876 waren es vier, 1885 einundzwanzig und 1890 zweiunddreißig Angestellte.
Wilhelm Mengelberg hatte sich 1880 aus Utrecht an einer Ausschreibung für einen Entwurf der Bronzetüren im Westportal des Kölner Doms beteiligt. Aus dreißig Einsendungen wurde keine ausgewählt, aber Mengelbergs Entwurf gewann einen Preis im Wert von siebentausend Mark. Die Einladung, 1888 an der Ausschreibung zu einem Entwurf für die Türen des Nordportals des Doms teilzunehmen, war von noch größerer Bedeutung. Mit diesem Entwurf gewann Mengelberg diesmal doch den ersten Preis. In späteren Jahren gestaltete er auch noch Kreuzwegstationen für den Kölner Dom, einen Beichtstuhl, den Altartisch für die aus 1261 stammende Achsenkapelle und andere Kunstwerke.
In den Niederlanden hat Mengelberg zahllose Kirchen mit Mobiliar bestückt. Die Sankt Nicolauskirche te Jutphaas, entworfen durch den Architekten Alfred Tepe (1840–1920), mit dem Mengelberg viel zusammenarbeitete, wurde gänzlich vom Atelier Mengelberg ausgestattet.

Friedrich Wilhelm Mengelberg in seinem Atelier, Foto G. Jochmann, Utrecht.
Er fertigte das Interieur der Liebfrauenkirche in Zwolle (1875), der Sankt Willibrordkirche in Utrecht (1876) und der Sankt Franziskus-Xaveriuskirche (genannt de Krijtberg) in Amsterdam. Außerhalb des Erzbistums zu Utrecht fertigte er zudem Kunstwerke für Kirchen in Raalte, Arnheim und Workum. Zwischen 1891 und 1894 gestaltete er die Inneneinrichtung der r.k. Sankt Michaelskirche in Zwolle und ein Jahr später für dieselbe Kirche das Denkmal für Thomas a Kempis. Für die Kathedrale zu Utrecht fertigte er neben dem Mobiliar auch den Orgelkasten der Maarschalkerweerd-Orgel. Außerhalb der Niederlande fanden Kunstwerke aus den Mengelberg-Werkstätten ihren Weg unter anderem nach Bonn, Frankfurt am Main, Köln, Mönchen-Gladbach und Paderborn.
Dass es in den Niederlanden so viel Arbeit für Wilhelm Mengelberg gab, hat seine Wurzeln im aufblühenden Katholizismus in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit der niederländischen Verfassungsänderung von 1848 gab es Raum zur Herstellung der römisch-katholischen Hierarchie, worauf auch von katholischer Seite stark gedrungen wurde. Diese Änderungen hatten unter anderem zur Folge, dass der König beim Erlassen kirchlicher Vorschriften keine Rolle mehr spielte.
Papst Pius IX. erstellte 1853 Maßregeln, um die bischöfliche Hierarchie in den Niederlanden wiederherzustellen. So entstanden vier Bistümer und Utrecht wurde zum Erzbistum. Diese Wiederherstellung führte in nahezu allen Bereichen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens zu einer großen Wiederbelebung der römisch-katholischen Kultur mit vielen Kirchenbauten zur Folge. Zudem kam dann auch bald eine Rückbesinnung auf zahlreiche Traditionen und Werte aus der Vergangenheit.
Einer der tonangebenden Persönlichkeiten, die sich unter anderem mit der Rückbesinnung auf dem Gebiet der Baukunst beschäftigten, war J.A.A. Alberdingk Thijm (1820–1889).15 In seinem auf das Jahr 1858 datierten Buch De heilige linie entwickelte er Entwürfe, die auf dem gotischen Baustil basierten. Seine Ideen wurden vor allem durch den Architekten P.J.H. Cuypers (1827–1921) realisiert.
Innerhalb des Erzbistums Utrecht spielte Mgr. Gerard van Heukelum (1834–1920), der von 1859 an Kaplan der Utrechter Kathedrale war, eine maßgebliche Rolle für die Förderung der kirchlichen Baukunst. Van Heukelum war der Meinung, dass sich die kirchliche Kunst am neogotischen Stil orientieren sollte, an den landestypischen Eigenheiten, was für die Niederlande bedeutete: In der niederländischen Backsteingotik des 15. und 16. Jahrhunderts Anregung zu suchen. Hiermit präsentierte er sich anders als Cuypers, der an die Gotik des frühen 13. Jahrhunderts anzuschließen versuchte. Mit Hugo Schneider (1841–1925) aus Aachen und später mit Wilhelm Mengelberg fand van Heukelum Künstler, die seinen Idealen entgegenkamen. Er wusste, den 1868 zum Utrechter Erzbischof berufenen Mgr. A.I. Schaepman (1815–1882) ganz für seine Ideen in Sachen kirchlicher Baukunst zu gewinnen. Damit bekam er alle diesbezüglichen Pläne vorgelegt und konnte den Erzbischof auf das Werk von Mengelberg aufmerksam machen, der sich überreden ließ, sich in den Niederlanden zu etablieren. Mit dieser Unterstützung erhielt Mengelberg zunehmend mehr Aufträge.
Im Jahr 1869 gründete Van Heukelum die Sint Bernulphusgilde mit der Aufgabenstellung, die kirchliche Kunst, nach mittelalterlichen Vorbildern inspiriert, zu neuem Leben nach seinen eigenen Ideen zu erwecken. Im Grunde war die Sint Bernulphusgilde eine Gesellschaft für Geistliche, aber im Laufe der Zeit wurde die Künstlergruppe, die als die Utrechtse kunstenaarskring bekannt wurde – und aus der die neogotische Utrechtse School entstand – bestimmend. Wilhelm Mengelberg bildete gemeinsam mit dem Architekten Alfred Tepe, dem Glaskünstler Heinrich Geuer (1841–1904) und dem Goldschmied Gerald Brom (1831–1882) – zusammen wurden sie auch als das Utrechts Kwartet bezeichnet – den Kern des Utrechter Künstlerkreises. Zwischen 1875 und 1883 war der Einfluss durch van Heukelum im Erzbistum Utrecht so groß, dass das Utrechts Kwartet fast an allen Kirchenbauten beteiligt war. Nach Aussagen des Kunsthistorikers Gerard Brom (1882–1959) – ein Sohn des Goldschmieds – wurde der Ton innerhalb des Quartetts durch Wilhelm Mengelberg angegeben, den er als den „meist bevorzugten Anhänger“ von van Heukelum bezeichnete:
Mengelberg war ein außerordentlich produktives Talent und streute Werke weit um sich herum: Flügelaltare mit Tafeln und geschnitzten Gruppen, gemalten oder modellierten Kreuzwegen, reihenweise Heiligenbilder, alles eben schnell geliefert durch den wortgewandten Künstler, der mit dem großen Hut auf seinem feinen Kopf das schönste Modell für van Dijck liefern könnte, immer lebendig und beweglich, immer fruchtbar.16
Brom übte allerdings auch große Kritik an Mengelberg. Er fand, dass die Schlichtheit und Reinheit des Baumeisters durch die Überschwänglichkeit des dekorativen Künstlers überlagert wurden. Charakteristisch fand er Mengelbergs Erläuterung zu einem Kanzelentwurf: „Das Ganze soll selbstverständlich vergoldet und polychromiert werden.“17 Die Qualifizierung „Altmeister“, so wie sie allmählich gegenüber Mengelberg gebraucht wurde, fand er übertrieben, weil, seiner Meinung nach, dessen Arbeiten auch durch „leeren Überfluss“ gekennzeichnet waren.18 Eigentlich fällte Brom dann auch ein ziemlich negatives Urteil über das Schaffen von Wilhelm Mengelberg.
Anlässlich des 80. Geburtstages von Mengelberg machte P.J.H. Cuypers 1918 einige charakterisierenden Anmerkungen zu dessen Schaffen.19 Was er in seinem Schaffen vor allem bemerkenswert fand, war „sein enormer Erfindungsreichtum an humoristischen Vorstellungen von Menschen und Tieren in Kombination mit einem, von der Natur inspirierten Blattwerk; ganz in der Gestik eines so manch eines mittelalterlichen Künstlers, aber mit großer Ursprünglichkeit und mit nicht wenig Eleganz.“ Seine Bewunderung galt „Mengelbergs großer Liebe für edle, hohe und erhabene Kunst, sein unermüdliches Streben, um diese Kunst voranzutreiben in Aufschwung und Ansehen beim Volk, um also die heilsame Wirkung zu sichern für innere Wertschätzung gegenüber Kultur und Bildung.“
An Auszeichnungen und Wertschätzung hat es Mengelberg nicht gefehlt. Papst Leo XIII. verlieh ihm den Sankt-Gregorius-Orden, er wurde zum Ridder in de orde van Oranje Nassau ernannt (1896) und die preußische Regierung verlieh ihm für seine Arbeiten am Kölner Dom den Roten Adler.
Vater Mengelberg wurde beschrieben als „ein magerer, kleiner, außergewöhnlich lebenslustiger und lebendiger alter Herr.“20 Er hegte ein großes Interesse für Musik, besuchte oft Konzerte und verfügte über eine breit gefächerte Musikkenntnis. Darüber hinaus war er mit einem hervorragenden musikalischen Gedächtnis gesegnet, sodass er Vergleiche ziehen konnte mit Solisten, die er vor langer Zeit gehört hatte. Sein Interesse an Musik kam auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Im Jahr 1889 schlug er vor, zusammen mit seinem Sohn Willem, der damals in Köln studierte, ein Musikfest in Brühl zu besuchen. Über eine Aufführung einer Oper von Richard Hol, die er im November 1894 in Utrecht besuchte, lieferte er gegenüber Willem einen ausführlichen und kritischen Bericht.21 Mit Kontakten, die sein Sohn später zu bekannten Musikern wie Richard Strauss und Gustav Mahler pflegte, sparte er nicht. Seine Gesprächspartner kamen oftmals kaum zu Wort, „so eifrig führte er selbst das Wort.“22
Wilhelm Mengelberg verteilte seine Talente über verschiedene Gebiete der Bildenden Kunst. „Niemand, selbst sein Sohn und Namensgenosse weis, ob er aus Überzeugung oder doch aus Notwendigkeit so gehandelt hat.“23 Er fand, dass Kunst nützlich sein und dass seine Kunst als Gemeinschaftskunst verstanden werden sollte.24 Er stellte sich damit in den Dienst des „Gesamtkunstwerks.“
Sein Sohn entschied sich mit einer Dirigentenlaufbahn für eine hochindividuelle Kunstrichtung – und stellte damit sein pianistisches Talent gänzlich in den Hintergrund. Die Übereinstimmungen zwischen Vater und Sohn sind allerdings erkennbar: die Liebe zur Kunst sowie der Drang und die Notwendigkeit, diese für die Menschen gemäß den eigenen Überzeugungen greifbar zu machen, damit die heilsame Wirkung der Kunst zum Tragen käme.
Die Frau von Wilhelm Mengelberg, Wilhelmine Anna Helena Schrattenholz wurde auf Schloß Allner bei Hennef (Siegkreis) geboren. Ihr Vater, Wilhelm Schrattenholz, war in Köln als Arzt tätig, aber profilierte sich auch als gebildeter Dichter und Komponist. Dieser bemerkenswert vielseitige Mann hatte Erfindungen auf medizinischem Gebiet gemacht, aber auch ein patriotisches Beckersch Rheinlied (1841) komponiert und sich hinter die anti-autoritären Ideale der Revolution von 1848 – die in Köln unmittelbar Pressefreiheit nach sich zogen – gestellt. Helena Mengelberg hatte Klavier studiert, aber über ihre Begabung ist wenig bekannt. Es liegt auf der Hand, dass sie für die frühe musikalische Entwicklung ihres Sohnes Willem ein entscheidender Faktor gewesen ist.
Friedrich Wilhelm Mengelberg und Helena Schrattenholz heirateten am 14. Februar 1866. Sie waren aus Überzeugung römisch-katholischen Glaubens und bemühten sich, ihre Kinder übereinstimmend nach der Lehre der Ecclesia Mater zu erziehen. Oft wiesen sie ihre Kinder auf die Notwendigkeit eines frommen und gottesfürchtigen Lebens hin. Aus ihrer Ehe gingen zwischen 1867 und 1890 sechzehn Kinder hervor: acht Söhne und acht Töchter. Willem (eigentlich Joseph Wilhelm) Mengelberg wurde am 28. März 1871 in Utrecht geboren. Als er auf die Welt kam, hatte er bereits zwei ältere Brüder und eine Schwester: Otto Maria Maximilian (1867–1924), Catharina Hubertina (1868–1934) und ein Brüderchen, das 1872 starb. Nach Willem wurden noch zwölf weitere Kinder geboren. Maria Helena (1872–1903), Joseph (1874–1940), Maximilian Egidius (1875–1927), Anna Maria Katharina (1877–1949), Edmund Georg (1878–1950), Anna Katharina (1879–1961), Maria Johanna (1883–1953), Johannes Josephus (Hans, 1885–1945), Wilhelmina Josephine (1886–1948), Elisabeth Maria Cecilia (1890–1909) und noch zwei kleinere Geschwister, die aber noch als Jugendliche starben.
Aufgrund der Tatsache, dass sie in einem künstlerisch ambitionierten Milieu aufwuchsen, überrascht es nicht, dass einige Brüder und Schwestern von Willem auf die eine oder andere Art der Kunst zugewandt waren. Otto war Glasmaler und Bildhauer. Er leitete von 1896 bis 1908 die Abteilungen Glasmalerei, figürlich dekorative Zeichenkunst und Bildhauerei der Mengelberg Ateliers in Rijsenburg bei Driebergen. So fertigte er unter anderem das Gedächtnisfenster, das zur Amtseinführung von Königin Wilhelmina 1898 in der Nieuwe Kerk installiert wurde.25 Später gründete er ein eigenes Atelier für Glasmalerei. Maria Helena, die Sängerin war, heiratete 1895 Willems Studienkollegen in Köln, den Komponisten Ewald Strässer (1869–1933). Joseph arbeitete als Bildhauer und Kunstmaler in den Werkstätten seines Vaters.26 Max studierte Cello. Hans, der Bildhauer, Kunstmaler und Innenausstatter war, wurde Leiter der Abteilung für Kirchenmobiliar in den Mengelberg-Werkstätten. Als der Betrieb 1918 umorganisiert wurde in die Utrechtse Maatschappij tot het vervaardingen van Kerk- en Huissieraden en Versieringen voorheen F.W. Mengelberg, übernahm Hans zusammen mit seinem Bruder Otto die Leitung des Betriebs. Hans entwarf auch selbst Kirchenmobiliar (unter anderem für die Kapelle der Ignatiuscollege zu Amsterdam und die Heilig-Herzkirche zu Utrecht). Edmund trat dem Jesuitenorden bei. Er wurde 1913 zum Priester geweiht und war unter anderem im Exerzizienhaus Loyola in Vught tätig.
Jugend in Utrecht 1871–1888
Als Willem Mengelberg 1871 in Utrecht geboren wurde, wohnte die Familie Mengelberg bereits an ’t Hoogt 10. Gemäß Artikel 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches wurde er als Sohn deutscher Eltern, die erst seit kurzer Zeit in den Niederlanden wohnten, qua Geburt automatisch Niederländer.27 Als er ein Jahr alt war, bezogen die Mengelbergs ein von Tepe entworfenes Haus am Maliebaan 80, an das die Werkstätten mit angeschlossen waren. Der Giebel des Hauses war mit den gotischen Buchstaben dekoriert: „Verleen, Heer, dezen huyze vrede, / Dat nimmer ’t kwade er binnen trede“ [Verleih, Herr, diesem Haus Frieden, / Dass niemals das Böse eintreten möge].
Im Kindergartenalter dürfte der kleine Willem wegen seiner schwachen Gesundheit einige Zeit lang auf dem Lande gelebt haben, um zu Kräften zu kommen.28 Die Grundschulzeit verbrachte er in Utrecht. Die Mittelschulzeit verbrachte er wohl im Internat Katwijk, welche die Kinder Mengelberg, zumindest die Jungen, nach der Grundschule besuchten.29 Wie er seine musikalische Erziehung, die später noch weiter detailliert wird, mit dem strengen Internatsleben in Einklang bringen konnte, ist allerdings unklar. Vielleicht ist er auch nur kurze Zeit im Katwijk gewesen und hat den Rest seiner Mittelschulzeit doch in Utrecht verbracht, obwohl es dort seinerzeit kein römisch-katholisches Gymnasium gab.30 Einer im Jahr 1931 erschienenen Mengelberg-Chronik31 ist zu entnehmen, dass er zwischen 1877 und 1888 die Grundschule, das Gymnasium und die Musikschule in Utrecht besuchte.
Die musikalischen Begabungen des kleinen Mengelberg wurden schon früh erkannt. Von seinem dritten Lebensjahr an versuchte er, angeregt durch seine Mutter, das Klavierspiel. Abgesehen davon, dass sie gut Klavier spielte, sang sie auch gerne, was auf den kleinen Willem einen bleibenden Eindruck machte. Im Kinderzimmer stand ein Klavier: „Wenn wir ungezogen waren, wurden wir zur Beruhigung auf einen Stühlchen ans Klavier gesetzt. Und als kleiner Junge spielte ich da schon bald meine eigenen Lieder zu einem eigenen Text.“32 Die singende Mutter und das Klavier im Kinderzimmer waren entscheidend für die Richtung, die sein Leben nahm, wie später Mengelberg meinte. Er dachte, die Liebe für die Musik vor allem von seiner Mutter zu haben, obwohl auch sein Vater ein enthusiastischer Musikliebhaber war.
Von seinem vierten oder fünften Lebensjahr an bekam er Klavierunterricht von dem alten Utrechter Klavierlehrer Umland und ab dem achten Lebensjahr improvisierte er bereits auf dem Klavier. Seine ersten Kompositionen stammen auch aus diesen Jugendjahren; es handelt sich um ein-, zwei- und dreistimmige Lieder für den Chor der Arbeiter in den Mengelberg-Werkstätten.
Später erzählte Mengelberg selbst über den Chor:
Vater hatte in den verschiedenen Werkstätten Maler, Modellierer, und so weiter, die während der Arbeit sangen. Ein oder zweimal pro Jahr wurde für diese Menschen mit ihren Frauen und Kindern ein gemütlicher Abend organisiert, mit Darbietungen und ich spielte dabei Klavier. – Aus dieser Gesellschaft hat sich einmal eine feierliche Delegation formiert, welche zum Vater kam und sagte, dass sie mit dem Personal einen Männerchor gründen wollten – deren Dirigent ich sein sollte. Ich war damals etwa acht oder neun Jahre alt. – Vater ließ mich unmittelbar von der Straße holen, wo ich mit den Jungen spielte. Ohne weitere Worte stellte er mich vor die Tatsache: ‚Und heute Abend beginnen‘. – ‚Gut‘ – sagte ich – ‚dann werde ich zuerst die Stimmen sortieren‘ – Soviel Kenntnis hatte ich offenbar schon. – Und an diesem Abend stieg ich auf einen Tisch, ließ all die Männer, – um die vierzig, fünfzig, – singen und teilte sie ein nach der Höhe und Tiefe ihrer Stimmen ein. – Vater überlegte, dass ich nun erst Akkorde, Crescendi und Diminuendi mit ihnen studieren sollte. Ich selbst komponierte die Lieder … Und dennoch war es ganz nett: Als ich etwa vor fünfzehn Jahren dort nach Utrecht wiedermal in die Werkstätten kam, stellte sich heraus, dass sie noch immer die Lieder sangen, die ich als Junge geschrieben hatte. Aber ich war ein wilder Bengel und so tobte und balgte ich viel lieber draußen mit den Kameraden. Aber Vater ließ mich das eine oder andere Mal holen und er schloss mich in das Musikzimmer ein, genau so lange, bis ich wieder ein Lied komponiert hatte. – Kein Wunder, dass ich das schnell erledigte, während die Spielkameraden auf mich warteten.33
Als er vierzehn war, dirigierte Willem den Chor in einem mehr oder weniger offiziellen Konzert, worüber sogar eine der Utrechter Tageszeitungen schrieb. Vielleicht hat Mengelbergs Gedächtnis ihn über die Anzahl der Chormitglieder im Stich gelassen: Die Werkstatt hatte nie so viele Arbeiter, dass daraus ein Chor von vierzig oder fünfzig Mitgliedern gebildet werden konnte.34
Zur Zeit des Wiederauflebens der römisch-katholischen Kultur spielte die Niederländische Sint-Gregoriusvereniging in der Rückbesinnung auf die Liturgie eine große Rolle. Damit wuchs die erneute Wertschätzung für den Stil von Komponisten der Renaissance, wie Palestrina, und für den gregorianischen Choral. Diese liturgisch-musikalische Strömung wurde Cäcilianismus genannt und von Deutschland übernommen, wo diese Auffassungen in Regensburg an der durch den deutschen Cäcilienverein gegründete Kirchenmusikschule verbreitet wurde. Dadurch, dass er im St. Gregorius Magnus Chor der Kathedrale zu Utrecht sang, kam Willem mit diesem kirchlich musikalischen Klima von seinem zehnten Lebensjahr an in Berührung. Unter der Leitung von Kaplan C.F. Le Blanc übte der Chor morgens um halb acht. Le Blanc hatte in Regensburg studiert und war mit Herz und Nieren Cäcilianer. Das bedeutete also, dass er in den Gottesdiensten ausschließlich Werke der klassischen Polyphonie aufführte. Werke im konzertanten Stil, wie Messen von Haydn und Mozart, waren sehr verpönt. Der Chor durfte ausschließlich aus Männern und Jungen bestehen. Auch unter Le Blanc’s Nachfolger, Kaplan F. Eppink, der 1883 antrat und ebenfalls in Regensburg studiert hatte, folgte man den „neuen“ Richtlinien. Das führte dazu, dass das Repertoire, womit Willem Mengelberg vertraut wurde, vor allem aus der Zeit der klassischen Polyphonie stammte. Ein bedeutendes Werk, das in der Utrechter Kathedrale aufgeführt wurde und bei dem er mitsang, war die Missa Papae Marcelli von Palestrina. Später erzählte Mengelberg, dass er schon von seinem siebten oder achten Lebensjahr an in dem Chor mitgesungen hatte und dass er gelegentlich ein Sopransolo singen durfte.35 Zweifellos hat er durch sein Singen in St. Gregorius Magnus in der weihevollen Atmosphäre der Utrechter Kathedrale seine Liebe für den Chorgesang entdeckt, die später in der Entwicklung seiner Karriere eine bedeutende Rolle spielen sollte. Als er etwas älter war, leitete er den Chor manchmal während der Proben. Nachdem er vom Organisten der Kathedrale Unterricht bekommen hatte, begleitete er den Chor oft auf der Orgel.36
Auf eigene Initiative begann ich die Orgel zu spielen, auch wenn ich noch nicht an die Pedale der riesigen Kirchenorgel reichen konnte. Aber in den kleinen Pausen ließ mich der Organist schon mal etwas fantasieren, wobei ich dann über die Pedale laufen konnte. – Ich glaube, dass ich wohl ein geschickter Junge war. Und die Musik lernte man so auf spielerische Art.37
Im Jahr 1892, im Rahmen seiner Bewerbung für eine Stelle in Luzern, schrieb Mengelberg, dass er zwischen seinem zehnten und siebzehnten Lebensjahr bei fast allen Sonn- und Feiertagen die Orgel der Kathedrale gespielt hatte und dass er das Instrument ganz und gar beherrschen lernte.38
Die Hinweise, die er über die Orgel in der Kathedrale gibt, liefern möglicherweise Klarheit über die Geschichte des Instruments.39 Das heutige Instrument, vom Orgelbauer Maarschalkerweerd aus Utrecht erbaut, ist nämlich auf 1902/1903 datiert. Dieses Instrument, das doch als „riesige Kirchenorgel“ bezeichnet werden konnte, hat Mengelberg in seiner Jugend also nicht gekannt. Über die Orgel, die früher in der Kirche war, besteht allerdings Unsicherheit. Es gibt Hinweise, dass es sich um ein sehr bescheidenes Instrument handelte, etwa mit fünf bis acht Registern mit einem angehängten Pedal mit geringem Umfang. Möglicherweise handelt es sich um das Instrument mit sieben Registern, das in Broekhuyzens Orgelbeschreibungen vorkommt als Instrument der „r. kath. Gemeinde in der Nieuwstraat, St-Catharina geweiht.“40 Vielleicht handelt es sich auch um die kleine Orgel mit vier Registern, das Michael Maarschalkerweerd 1874 baute. Nach Mengelbergs Erinnerung zu urteilen, ist es allerdings viel wahrscheinlicher, zu unterstellen, dass es in seiner Jugend um das Instrument ging, das derzeit in der Sankt Josephkirche zu Utrecht steht. Das war ein Instrument, das ungefähr 1860 durch die deutsche Firma Meyer erbaut wurde.41 Mit seinen damaligen 24 Stimmen, verteilt auf zwei Manuale und Pedal, kommt das am ehesten in die Nähe von dem, woran sich Mengelberg im Sinne dieser „riesigen Kirchenorgel“ erinnerte und das kann von dem kleinen Instrument schwer behauptet werden. Auf der Meyer-Orgel konnte man sich als Organist sehr gut ausbilden.

Mengelberg bekam nicht nur eine musikalische Bildung, sondern wurde, ebenso wie seine Brüder, vertraut mit dem Handwerk, das in den Werkstätten seines Vaters betrieben wurde. Ursprünglich wollte sein Vater überhaupt nicht, dass er Musiker werden würde, „weil ich nach seinem väterlichen Verständnis zu viel Talent hatte für Malerei, Zeichnen, Modellieren.“42 Hinsichtlich des weiteren Musikunterrichts fragten seine Eltern. Baron J.C.M. van Riemsdijk (1842–1895), einen Nachbarn an der Maliebaan, um Rat. Diese wichtige und einflussreiche Person innerhalb des Utrechter Musiklebens arbeitete als Beamter bei der Staatsspoorwegen [Staatlichen Bahn].43 Er fand, dass Willem Mengelberg einer professionellen Musikausbildung nachgehen müsse, und wirkte dabei einige Zeit als sein Mentor. Später erzählte Mengelberg, wie es bei van Riemsdijk ablief:
Herr van Riemsdijk […] hatte in diesen Tagen sehr kuriose Bücher entdeckt, in denen auf Pergament in gregorianischer Notation Psalmen von Sweelinck geschrieben waren. Die mussten als Partitur gesetzt werden. Und er beauftragte mich damit. Eine Arbeit für die Zeit nach der Schule, immer schnell, schnell, um dann wieder auf die Straße zu kommen. – Manchmal entdeckte ich hierin Schreibfehler, die ich dann auf eigene Faust verbesserte. – Ich höre van Riemsdijk noch sagen: ‚Ja aber Junge, so geht das aber nicht‘. Er gab mir auch Kompositionsunterricht, – das Komponieren von Chören und Doppelchören. Und eben dieser freundliche Mann … hat er mich später, als Kes weggehen sollte, als seine Nachfolger empfohlen, in Amsterdam, wo mich damals niemand kannte.44
Über den Kontakt, den seine Eltern mit dem Physiologie-Professor Prof. Th.W. Engelmann hatten, der sehr ordentlich Cello spielte, und seiner Frau Emma Brandes, einer sehr begabten und geschätzten Pianistin, die mit Clara Schumann befreundet war, begegnete der junge Mengelberg Johannes Brahms, der wiederum mit Engelmanns befreundet war und dort während seiner Besuche in den Niederlanden oft logierte. Über das Treffen mit Brahms erzählte Mengelberg sehr viel später:
Schon als junger Bursche hatte ich Gelegenheit, Johannes Brahms kennenzulernen. Das war bei einer Bekannten meiner Eltern, die mit dem Meister befreundet waren. Immer, wenn Brahms kam, logierte er dort, und so begegnete ich ihm einmal. Ich spielte seine Händel-Variationen vor, und da klopfte mir am Schluß der Meister auf die Schulter und meinte: ‚Du verstehst die Sache; spiele nur weiter so meine Werke!‘ Ich erglühte vor Stolz über dieses Lob.45
Die Begegnung dürfte 1884 oder 1885 stattgefunden haben. Danach ist Brahms nicht mehr in den Niederlanden gewesen.
Die Wahl für ein professionelles Musikstudium war im Hause Mengelberg keine selbstverständliche Angelegenheit. Vater Mengelberg scheint eine Zeit lang gemeint zu haben, dass Musik für seinen Sohn auf Liebhaberei beschränkt bleiben konnte.46 Auf Anraten von van Riemsdijk besuchte Mengelberg die Muziekschool van Toonkunst zu Utrecht, an der Richard Hol Direktor war. Bis Mitte 1888 bekam er Solfège und Klavierstunden von Martinus W. Petri und Musiktheorie von Richard Hol und Anton Averkamp. Petri, der ihm die Solokonzerte von Mozart beibrachte, war zufrieden mit seinem Zögling, der mit „viel Talent und Leichtigkeit für Studium“ seinen Stunden folgte.47 Daneben hatte er noch einige Zeit Klavierunterricht bei Th.L. van der Wurff, der auch in Verbindung zur Musikschule stand. Einer amerikanischen Zeitung zufolge soll Mengelberg nach Abschluss seines Studiums in Utrecht, bevor er nach Köln umzog, um sein Studium fortzusetzen, auch noch ein halbes Jahr in Berlin studiert haben.48 Diese Mitteilung muss jedoch auf einem Irrtum beruhen angesichts der Tatsache, da es keine Dokumente gibt, die das bestätigen und Mengelberg selbst auch nie darauf verwies.

Richard Hol, Foto J.J.A. van Winsen, Utrecht.
Studium in Köln 1888–1892
Im September 1888 setzte Willem Mengelberg sein Studium am Konservatorium in Köln fort. Später erklärte er in einem Interview anlässlich seines ersten Auftritts 1905 in Amerika, dass in Köln das eigentliche Fundament für seine spätere Karriere gelegt wurde:
Meinem Lehrer des Kölner Konservatoriums verdanke ich viel, und falls ich jemals ein guter Musiker werde, habe ich meinen Mentoren Franz und Isidor Seiß zu danken, leider beide gestorben; sie waren Lehrer mit einer derart besonderen Fähigkeit, wie sie selten anzutreffen ist.49
Dass Mengelberg zum Studium nach Deutschland ging, war nicht ungewöhnlich. Besonders hoch war nämlich das Niveau der niederländischen Musikausbildung nicht. Zahlreiche niederländische Musiker studierten im 19. Jahrhundert an den Konservatorien in Leipzig und Berlin. Zur Wahl für das Konservatorium in Köln soll auch van Riemsdijk beigetragen haben.50 Köln war gewissermaßen naheliegend: Das Konservatorium hatte durch den einstigen Musikdirektor, den im deutschen Musikleben sehr einflussreichen Ferdinand Hiller (1811–1885), gewisses Ansehen erlangt. Sein Nachfolger Franz Wüllner (1832–1902) war Direktor, als Mengelberg dort zu studieren begann. Auch sentimentale Überlegungen spielten eine Rolle. Köln war die Geburtsstadt von Vater Wilhelm Mengelberg; dort wohnten Freunde und Familienmitglieder, unter anderem Großvater Schrattenholz – sodass dort also von der Familie ein Auge auf ihn geworfen werden konnte – und Vater Mengelberg musste regelmäßig für Angelegenheiten in Köln sein, beispielsweise, als 1888 sein Entwurf für die Türen des Nordportals des Kölner Doms gekrönt wurde.
Allmählich war das Kölner Konservatorium unter Hillers Direktion zu einer starren und konservativen Institution geworden, welcher der 1884 ernannte Direktor Franz Wüllner einen neuen Schwung zu geben verstand. Als Hiller wegging, hatte man zunächst gehofft, Brahms als seinen Nachfolger ernennen zu können, aber dieser empfahl den in Dresden und Berlin tätigen Franz Wüllner. Wüllner war Schüler von Anton Schindler (1795–1864), der lange Beethovens Freund und Sekretär war. Wüllner erhielt von Schindler in den Wintern 1846/1847 sowie 1847/1848 Unterricht. Von November 1847 an studierte er unter Schindlers Anleitung die Klaviersonaten und Klavierkonzerte von Beethoven. Schindler gab ihm auch Kompositionsunterricht. In den fünfziger Jahren wurde der Kontakt zwischen Wüllner und Schindler infolge zahlreicher Meinungsverschiedenheiten weniger intensiv.51

Wüllner erneuerte den Lehrplan, gründete ein Konservatoriums-Orchester, eine Opernklasse und richtete viel Aufmerksamkeit auf den Aufbau von Chorklassen. Er führte seine Methode Chorübungen der Münchener Musikschule (1875/1876) ein, die er in München entwickelt und in Dresden mit Erfolg angewandt hatte. Die Anzahl der Studenten betrug bei seinem Antritt 152. Im Jubiläumsjahr 1900 waren es 480. Auffallend ist, dass die weiblichen Studenten, während Mengelberg in Köln studierte, in der Mehrheit waren.
Das Niveau der Institution wurde gut mit einem Programm zu einer Soirée für Chorgesang am 13. März 1890 gespiegelt, wozu der Direktor des Konservatoriums Johannes Brahms eingeladen hatte. Das Programm bestand unter anderem aus einer Aufführung von dessen Deutsche Fest- u. Gedenksprüche op. 109 und einer Erstaufführung der Motetten op. 110 durch die höchsten Chorklassen. Der Meister trat an diesem Abend auch selbst im Rahmen seines gerade überarbeiteten Klaviertrios op. 8 auf. Vielleicht ist Mengelberg bei dieser Gelegenheit Brahms wieder begegnet, ein Treffen, worüber er 1936 erzählte, und er musste „aus der Handschrift [..] mit zwei Studiengenossen dem Meister ein eben fertiggewordenens Trio vorspielen“52.
Mit seiner Ernennung am Konservatorium wurde Wüllner gleichzeitig auch Dirigent des Orchesters der Kölner Konzertgesellschaft. Bei der Ernennung forderte er auch, dass er weiterhin eine Serie von fünf Konzerten bei den Berliner Philharmonikern leiten könne. Seine Verbindung nach Berlin kam ein Jahr später zum Ende. Als ihm die Leitung des Kölner Orchesters übertragen wurde, hatte er erklärt, dass ein gutes Orchester gut diszipliniert sei und dass alle Streicher dieselben Striche anwenden müssten. Für die Konzerte hatte er anstelle der üblichen zwei Proben drei gefordert und manchmal wurden ihm sogar vier zugestanden. Darüber hinaus gelang ihm gelegentlich auch eine Verstärkung des Orchesters. Das war im Rahmen der Herausforderung, durch die neue Orchesterliteratur notwendig geworden. Im Jahr 1888 konnte er erreichen, dass das Orchester eine städtische Einrichtung wurde.
Es ist nicht nur von Interesse, sich mit der Person Wüllner als Dirigent zu beschäftigen, da ihn Mengelberg besonders schätzte, sondern vor allem weil Wüllner so wichtig für seine künstlerische Entfaltung als Orchester- und Chordirigent gewesen ist. Seinen Zeitgenossen zufolge war Wüllner am Besten im Umgang mit Musik von Beethoven. „[Er] beobachtet im einzelnen eine Abwandlung des Zeitmaßes, die fast romantisch eigenwillig anmutet, und hält dennoch mit zäher Stetigkeit und Zartheit das Grundzeitmaß fest“, so beschrieb ihn die Köllner Zeitung 1902.53 Sein Zeitgenosse und Dirigentenkollege Hermann Levi (1839–1900) schrieb allerdings einmal an Brahms, dass er dessen Triumphlied in einem beängstigend straffen Allegro-Tempo gehört hatte.54 Der Dirigent Hans von Bülow (1830–1894) empfand wenig Sympathie für Wüllner. Er bezeichnete ihn 1886 als „Centrumsmusiker“ und ließ ihn 1870 wissen, dass er nicht an Wüllners Sachverstand und Begeisterung zweifelte, aber dass sie über das Wesen von Musik sehr starke unterschiedliche Auffassungen hatten.55 Im Jahr 1884 schrieb er „über schlechte Dirigenten Jud Joachim und Nichtjud Wüllner.“ 1885 warf er Wüllner vor, dass dieser sich viel zu spät für die „Zukunftsmusiker“ Berlioz, Liszt und Wagner interessiert hatte.56 Es ist schwierig, diesen Vorwurf zu deuten, angesichts der Tatsache, dass Wüllner 1869 in München die Premiere von Wagners Das Rheingold dirigierte und ein paar Jahre später auch in München die Premiere von Die Walküre. Man gewinnt stark den Eindruck, dass die Kritik durch von Bülow persönlich motiviert ist.
Von Bedeutung waren auch die Kölner Niederrheinhessischen Musikfeste, die Wüllner 1886 und 1901 organisierte.57 Mengelberg könnte während seines Studiums einigen beigewohnt haben. Als er schon Jahre Köln verlassen hatte, ließ er Wüllner beispielsweise wissen, dass er beabsichtige, bei dem Musikfest 1898 anwesend zu sein.58
In Wüllners Repertoire kam die Musik von Bruckner kaum vor. Nur die 4. und 7. Symphonie wurde von ihm aufgeführt. Mit Brahms fühlte er sich unter den zeitgenössischen Komponisten am meisten verwandt. Von den zeitgenössischen „modernen“ Komponisten führte er die Musik von Richard Strauss am häufigsten auf. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter von dessen Musik und spielte fast alle seine neuen Werke.
Während Mengelbergs Studienzeit in Köln fanden die folgenden Erstaufführungen von Strauss-Werken dort statt: Am 8. Januar 1889 Aus Italien op. 16, am 4. März 1890 das Violinkonzert op. 8, am 3. Februar 1891 Don Juan op. 20, am 23. Februar 1891 Tod und Verklärung op. 24.
Über die Aufführung des Don Juan am 3. Februar 1891 unter der Leitung des Komponisten selbst, bewahrte Mengelberg eine schöne Erinnerung:59
Ich traf Richard Strauss, während ich noch Student am Kölner Konservatorium war. Er hielt im Gürzenich-Saal eine Probe ab für die erste Aufführung seines Don Juan (in Köln). Der Glockenspiel-Spieler hatte Probleme, seine Partie zu meistern und schließlich richtete er sich aus Verzweiflung an Wüllner, ‚Lieber Doktor, das wird nie laufen.‘ Dr. Wüllner wandte sich mir zu, um den Part zu nehmen. Ich war längst bereit, sprang auf die Bühne und spielte sofort das Instrument. Strauss, jetzt ziemlich fröhlich, rief lächelnd zu mir, ‚Jetzt geht es großartig‘. Ja, es ging gut, während der Probe. Ich zählte meine Pausen sehr sorgfältig, beginnend mit Buchstabe so und so, einhundert und so viele Takte, – und ich lag richtig. Aber am Abend im Konzert war ich natürlich ziemlich aufgeregt, unter Strauss zu spielen, den ich schon außerordentlich bewunderte, und wenn die teuflische Stelle kam, verpasste ich sie, weil ich einen Fehler beim Zählen machte. Ich war schrecklich beschämt, und jetzt, jedes Mal wenn ich Don Juan dirigiere, denke ich an mein Solo auf dem Glockenspiel. Ich schwor dann, niemals auf einem Instrument ohne vorherige Erfahrung zu spielen, und dieses Versprechen habe ich bis jetzt gehalten.
Als Chordirigent führte Wüllner bereits am 3. April 1860 in Aachen die Matthäus-Passion von Bach auf. Des Weiteren führte er die bekannten Oratorien auf, u. a. von Mendelssohn (Paulus, Elias), Haydn (Die Jahreszeiten, Die Schöpfung) und Brahms (Ein Deutsches Requiem).
Isidor Seiß (1840–1905), Mengelbergs Klavierlehrer, hatte in Leipzig bei Friedrich Wieck, dem Vater von Clara Schumann, studiert. Seit 1861 war er mit dem Konservatorium in Köln verbunden. Unter der Direktion von Wüllner war er stellvertretender Direktor. Als Klavierpädagoge genoss Seiß einen großen Namen. Sein Klavierspiel soll sich vor allem durch Deutlichkeit und Liebe zum Detail ausgezeichnet haben. Es ist unter anderem sein Verdienst gewesen, dass er Mengelberg beim Klavierspiel den guten Umgang mit seinen Muskeln lehrte.60 Bereits in Utrecht, also bevor er in Köln studierte, soll Mengelberg Probleme mit den Muskeln in seinen Händen gehabt haben. Sein behandelnder Arzt in Utrecht, Dr. Metzger, soll ihm selbst geraten haben, mit dem Klavierspiel aufzuhören.61 Mengelberg hielt das Andenken an Seiß nicht nur wegen dessen pädagogischer Fähigkeiten in Ehren. Viel später sagte er, dass er Seiß auch den besten Pianisten fand, den er je gehört hatte.62

Am Konservatorium in Köln entpuppte sich Willem Mengelberg als ein eifriger und talentierter Student. Er war für die Hauptfächer in Klavier und Komposition eingeschrieben. Neben Seiß für Klavier, war Wüllner sein Hauptdozent für Dirigieren und Komposition und Gustav Jensen war sein Theorielehrer. Musikgeschichte erhielt er durch Otto Klauwell und Gesang von Wüllner. An Anton Averkamp schrieb er Ende September oder Anfang Oktober 1888: „Bald bekomme ich Kompositionsunterricht von Prof. Wüllner.“63 Im Jahre 1889 kam er in dessen Kompositionsklasse.
Anton J. Bouman (1855–1906, Cellolehrer an der Koninklijke Muziekschool in Den Haag), der mit Mengelbergs Eltern gesprochen hatte und für seine Brüder Joseph und Max eine geeignete Musiklehrerin empfahl, schlug vor, dass er Violine als Zweitinstrument wählen sollte, weil ihm das später als Dirigent, als Mitglied eines Quartetts oder als Orchestermusiker am meisten gelegen kommen würde.64 Die Tatsache, dass Mengelberg in seiner Jugend viel Geige spielte, wie er später erzählte, muss in Zusammenhang mit diesem Vorschlag gestanden haben.65 Mengelberg nahm auch noch Gesangsstunden bei Benno Stolzenberg (1827–1906) und Orgelstunden bei Friedrich Wilhelm Franke (1862–1932) und vielleicht auch bei Arnold Mendelssohn.66 Franke gab erst ab September 1891 Unterricht am Konservatorium in Köln. Er folgte Arnold Mendelssohn.67

Über Mengelbergs Studiendauer in Köln sind die Berichte in mancher Hinsicht etwas undeutlich. Verschiedenen Lebenserinnerungen ist zu entnehmen, dass er das Konservatorium in Köln bereits 1891 im Besitz von drei Preisen verließ: für Klavier, Dirigieren und Komposition. Danach soll er noch ein Jahr als Lehrer am Konservatorium gearbeitet haben.68 Aber auch während des Studienjahres 1891/1892 war er noch als Student am Konservatorium eingeschrieben und im Jahresbericht kommt sein Name in der Dozentenübersicht nie vor. Tatsächlich wurde „Willem Mengelberg aus Utrecht“ am 29. Juli 1891 ein „Preis-Zeugnis“ verliehen „wegen seiner / trotz mancher Hemmnisse im Studium / vorzüglichen Leistungen im Klavierspiel / seines vielversprechenden Beginnes in Composition und Direction/ seiner Tüchtigkeit als Begleiter und Lehrer/ sowie wegen seiner trefflichen Gesamthaltung.“69 Diese Auszeichnungen wurden immer am Ende eines Schuljahres durch den Lehrerrat an Schüler verliehen, die besondere Leistungen erbracht hatten.70 Sein Freund und Studienkollege in Köln, Peter Fassbaender wurde 1889 und 1890 damit ausgezeichnet. Seiß schrieb in einer Empfehlung, dass Mengelberg vier Jahre das Konservatorium besuchte. Verwirrend daran ist, dass Wüllner erklärte, dass Mengelberg drei Jahre lang Schüler war. Wahrscheinlich kommt das dadurch zustande, dass Mengelberg erst ein Jahr später in die Klassen von Wüllner kam.71 Mengelberg selbst schrieb 1892, dass er vier Jahre in Köln am Konservatorium studierte „& im vorigen Jahre daselbst ein Preiszeugnis erhalten [hat].“72 Nach eigenen Aussagen ersetzte Mengelberg Wüllner wohl, als dieser verhindert war, die Chorklassen zu leiten.73 Die Lehrerschaft, die auch in verschiedenen Auszeichnungen erwähnt wird, bestand möglicherweise aus einem Assistenzposten. Mengelbergs Studienkollege Ewald Strässer, der im Jahr 1895 sein Schwager wurde, war vor seiner Anstellung als Theorielehrer 1892 ein Jahr lang „Hülfslehrer.“74 In jedem Fall gab er auch privat Musikstunden. Auch van Riemsdijk schrieb später in einem Brief, dass Mengelberg als Lehrer „aufgetreten war.“75

An den Vorspielabenden, die am Konservatorium organisiert wurden, trat Mengelberg regelmäßig auf. Während des ersten Studienjahres, 1888/1889, führte er mit einem Mitstudenten, die für zwei Klaviere geschriebenen Variationen über eine Thema von Ludwig van Beethoven von Saint-Saëns auf, die Fantasie in f-Moll von Chopin und die Fantasie in fis-Moll von Mendelssohn. Das Jahr darauf spielte er unter anderem Drei Charakteristische Studien op. 25 von Moscheles. Bachs Chromatische Phantasie und Fuge in d-Moll, BWV 903, erneut die Fantasie in f-Moll von Chopin, die Variationen in d-Moll op. 48 von F. X. Scharwenka und den Klavierpart in Schuberts Klaviertrio in B-Dur. Bei den Examensaufführungen 1890 trat er als Dirigent und als Pianist auf. Das Orchester des Konservatoriums leitete er im ersten Teil von Beethovens Erstem Klavierkonzert (8. Juli 1890), spielte die Variationen über ein Thema von G. F. Händel op. 24 von Brahms (22. Juli 1890), und das 1. Klavierkonzert von Liszt (28. Juli 1890). Am Ende seines zweiten Kursjahres wurde ihm eine Auszeichnung verliehen (nicht zu verwechseln mit dem Preiszeugnis von 1891) wegen seiner herausragenden Darbietung als Pianist, seinen geschickten Leistungen in Kontrapunkt und wegen seines Fleißes.76 Auch im Kursjahr 1891/1892 spielte er eine aktive Rolle am Konservatorium: Bei dem Fest anlässlich des Geburtstages von Direktor Wüllner, leitete er die höchste Chorklasse mit Chorstücken von Wüllner und wirkte bei einer Aufführung für zwei Klaviere und acht Hände von einem Schubert-Marsch mit. Ferner leitete er verschiedene Abschlussaufführungen des Kursjahres. Unklar ist, ob die Begleitungen durch das Konservatoriums-Orchester, die er dirigierte (da wurden keine Orchesterwerke aufgeführt) auch für seine eigenes Examen bestimmt waren, oder ob nur der Solist seine oder ihre Fertigkeit demonstrieren musste. Mit diesem Orchester begleitete er Arien aus, Der Freischütz von Weber, Die Schöpfung von Haydn und Cosi fan tutte von Mozart, das Rondo brilliant für Klavier und Orchester von Mendelssohn, das Vierte Klavierkonzert von Beethoven, das Klavierkonzert in f-Moll von von Henselt (Solist Dietrich [Dirk] Schäfer), die Romanze in f-Moll für Violine und Orchester von Svendsen und den ersten Teil aus Chopins 1. Klavierkonzert. Auch als Solist taucht sein Name in den Programmen der Abschlusskonzerte auf mit Liszts Klavierbearbeitung von Bachs Fantasie und Fuge in g-Moll für Orgel, mit der Fantasie in C-Dur von Schumann und bei einer Aufführung von Brahms’ Klavierquartett in A-Dur.
Nach der Schlussaufführung am 30. Juni 1892 wurden die Auszeichnungen für das Jahr bekannt gemacht. Willem Mengelberg bekam erneut eine: Wegen seiner außergewöhnlichen Leistung im Klavierspiel, seiner Qualität als Lehrer und als Dirigent und wegen seiner vortrefflichen Haltung.77 Im Juli 1892 wurden im Rahmen einer der Konservatoriumsaufführungen einige seiner Kompositionen gespielt: 3 Lieder für Chorgesang: Waldnebel, Liebeslied und Das kleine Fräulein. Während desselben Konzertes spielte er die Fantasie in C-Dur von Schumann. Am 12. Juli dirigierte er eine Aufführung des Klavierkonzertes in As von Joseph Rheinberger und am 31. Juli 1892 trat er mit dem 1. Klavierkonzert von Liszt im Gürzenich Volks-Symphonie-Conzerte unter der Leitung von Gustav Hollaender auf. Diese und andere Aufführungen sorgten dafür, dass Mengelbergs Talent auch außerhalb des Konservatoriums nicht unbemerkt geblieben war: „Keine Schüler- sondern eine Meister-Leistung“, schrieb eine der Kölner Tageszeitungen anlässlich seiner Aufführung der Fantasie von Schumann am 24. Juli.78 Sogar Jahre später wurde in den Kölner Tageszeitungen noch über seine künstlerischen Darbietungen geschrieben. Seine Interpretation der Fantasie von Schumann im Juli 1892 soll ziemlich von der seines Lehrmeisters Seiß abgewichen haben, der das nur schwer akzeptieren konnte, und das auch deutlich äußerte. Nach eigenen Aussagen soll Mengelberg darauf reagiert haben, mit den Worten: „Geschätzter Meister, lass mich in meiner Auffassung frei.“79
Detaillierte Daten zu Mengelbergs stimmlicher Ausbildung in Köln fehlen. Obwohl er sich später als fähiger Chorpädagoge entfaltete und sich verschiedene Sänger über seine Sachkenntnis geäußert haben, ist dessen professionelle Ausbildung auf dem Gebiet wahrscheinlich bescheiden geblieben. Seine Fähigkeit wird vor allem durch die Praxis entstanden sein. Seiner Frau Tilly schrieb Mengelberg 1907, dass er sich auf dem Gebiet von Gesang für kompetent hielt, weil er sein Leben lang (!) die Gesangskunst studiert und gelehrt hatte.80 Aus methodischer Perspektive schätzte er das Werk von Lili Lehmann, vermutlich meinte er Meine Gesangskunst von 1902. Evert Cornelis (1884–1931) schrieb 1902 Mengelberg einen Brief im Zusammenhang mit dessen Gesangsstudium, weil das, was Mengelberg in der Praxis ausübte, nicht mit dem übereinstimmte, was Cornelis gelernt hatte. (Cornelis leitete während Mengelbergs Abwesenheit in Amsterdam die Proben des Toonkunstkoor.) Er schrieb Mengelberg: „Ich […] hörte, dass Sie selbst keine eigentliche Gesangsstunden gemacht haben, aber Ihre Kenntnis darüber hauptsächlich gesammelt haben während Ihres Begleitens der Gesangsklassen in Köln.“ Cornelis hatte das von Frau Jo Beukers van Ogtrop (Vorstandsmitglied der Toonkunst und mit Mengelbergs befreundet) gehört und verfolgt:
Kein Wunder also, dass ich nach nur einer Saison die Proben offensichtlich noch nicht zu Eurer Zufriedenheit leite. Vor allem wenn es um von Ihnen empfohlene Chor-Tricks geht, die in direktem Gegensatz zu dem stehen, was ich Frau v. Zanten unterrichten hörte. Z. B. das Platzieren von ‚h‘ und ‚s‘, was ein Übel ist, das gerade Dilettanten beseitigen müssen + welche Gesangsart von Frau v. Z. mit dem Begriff ‚trocken wie Stroh‘ versehen wird. 81
Offensichtlich war Mengelberg ein außergewöhnlich guter Student mit einem enormen Eifer. Seine Leistungen sprechen für sich und zweifellos gehörte er in den Jahren zum Stolz des Konservatoriums. Was er an Repertoire zu Gehör brachte, ist beeindruckend. Es liegt nahe, dass er neben seinem großen Eifer eine natürliche Begabung zum Musizieren besessen haben muss.
Vor allem mit Wüllner blieb Mengelberg, nachdem er von Köln weggezogen ist, in Kontakt. Seine Verehrung für seinen alten Lehrmeister war groß. Ständig unterzeichnete Mengelberg seine Briefe an ihn mit den Worten „Ihr stets dankbarer Lehrling.“ Im Dezember 1892 schrieb er Wüllner, wie es ihm bei seinem ersten offiziellen Posten erging, und dankte ihm noch einmal ausführlich:
[…] für alles, was ich bei Ihnen in Köln gelernt & für alle Mühe, welche Sie mit mir gehabt
haben, wobei ich natürlich nicht nachlassen kann Sie herzlichst zu bitten, diejenigen
Stunden, in denen ich Ihnen keine Freude bereitet, vergessen zu wollen, es wird dies
Ihnen vielleicht nicht leicht sein, da es solche recht viele gegeben hat.82
Von dem Moment an würde er sein Bestes geben, um Wüllner und seine anderen Lehrer aus Köln zu feiern. War das eine Form der Bescheidenheit? Sollte er sich als Student nicht anständig verhalten haben? Gehörte er zu den Stimmungskanonen oder entschuldigte er sich für ein Fehlen an Eifer? Letzteres scheint jedoch am wenigsten naheliegend zu sein. In den biografischen Skizzen von H. Noltenius wird auf das fröhliche Studentenleben in Köln angespielt, an dem Mengelberg teilnahm. Zur Zeit seines Studiums an der Utrechter Musikschule hatte er mit seinen Streichen einen Ruf zu wahren.83
Alles in allem ist Mengelbergs musikalische Bildung in Köln von fundamentaler Bedeutung gewesen. Er bekam hier nicht nur eine vortreffliche Ausbildung durch ausgezeichnete Dozenten, sondern darüber hinaus durch Wüllner eine Aufführungstradition mit an die Hand, worüber er sich sein ganzes weiteres Leben bewusst sein konnte. Dieser konnte ihn ferner auf das Werk einiger sehr bedeutender Komponisten neugierig machen.
Der junge Musikstudent hatte 1888 in der Huhnsgasse in Köln ein Zimmer gefunden. Als er zunächst nach Köln reiste, um es zu beziehen, begleitete ihn sein Vater. Beim Betreten seines neuen Zimmers fiel ihm unmittelbar ein prächtiger neuer Flügel ins Auge, den sein Vater für ihn als Überraschung gekauft hatte, nach dem Motto: „Wenn man ein gutes Handwerk erlernen will, muss man auch ein gutes Handwerkszeug besitzen.“84
Willem Mengelberg genoss das Studentenleben und muss sich in Köln vollkommen wohlgefühlt haben. Der Überlieferung zufolge soll er selbst perfekt den Kölner Dialekt gesprochen haben (können).85 Seine Eltern versuchten, ihn so viel wie möglich vor allem denkbaren Unheil zu schützen. Ihre Besorgnis war groß. Hier muss angemerkt werden, dass die Hauptsprache im Hause Mengelberg Deutsch war. Aus diesem Grund war die elterliche Korrespondenz immer in dieser Sprache gehalten. Das liegt auf der Hand, denn sie waren Deutsche. In seinen Briefen drückte sich Willem abwechselnd niederländisch und deutsch aus. In späteren Jahren tat er das noch immer und auch für die Anmerkungen in seinen Partituren gebrauchte er oft, vielleicht ohne darüber nachzudenken, deutsche Ausdrücke. Einige Briefpartner, auch Niederländer, schrieben ihre Briefe an Mengelberg auf Deutsch. Offensichtlich bekamen die Eltern in ihrer Besorgtheit wenig Aufmerksamkeit von dem jungen, zu einem selbstständigen Menschen heranwachsenden Sohn geschenkt. Sie fanden, dass er ihre Briefe viel zu unregelmäßig beantwortete. Ein einziges Mal schrieben sie sogar an seine Vermieterin, weil sie auf verschiedene Briefe überhaupt keine Reaktion bekommen hatten.86 Vater Mengelberg fand, dass sein Sohn eine genaue Buchhaltung führen musste. Dabei ging es weniger um das Geld, als um den Überblick über die Ausgaben zu behalten; später würde er davon sicherlich profitieren. Mit strenger Genauigkeit wurden die Ausgaben seiner Zustimmung unterworfen. Diese Haltung wird wohl dazu beigetragen haben, dass Willem im Folgejahr 1889 begann, selbst zu unterrichten und so mehr Geld für seine Lebenshaltungskosten übernehmen konnte. „Möge der liebe Gott Deinen Fleiß segnen, darum bitte ich Ihn alle Tage lieber Wilm“, pries ihn seine Mutter, als er darüber nach Hause geschrieben hatte.87 Sein Studium am Konservatorium verlangte allerdings viel Zeit und deshalb musste er manchmal auch als Folge seiner Erkrankungen, notgedrungen die Stundenanzahl, die er nebenbei gab, reduzieren.88
Für seine Mutter war Wohlstand verbunden mit Gottes Segen: „Du weißt wohl ‚fleißig sein bringt vieles ein‘ u. so sei dem lieben Gott u. der lieben Muttergottes befohlen u. gegrüßt von Deiner treuen Mutter.“89 Sie ermahnte ihn manchmal mit tugendhaften, moralisierenden Sprüchen. Auf einen Ansporn vor allem doch mal wieder Großvater Schrattenholz zu besuchen, folgte: „Versäume nicht, lieber Wilm, – das Alter muss man ehren, das weißt du doch.“90
Wie seine Frau, aber etwas weniger oft, ermutigte Wilhelm Mengelberg seinen Sohn, regelmäßig zu beten. Auf Anstiftung des Architekten Tepe – der die Hoffnung gegenüber seinem Freund Wilhelm Mengelberg ausgesprochen hatte, dass dessen Sohn in Köln von schlechten Freunden verschont bleiben sollte – warnte er ihn da noch einmal ausdrücklich davor. Ein gezieltes Gebet bot hier die beste Lösung:
Bitte mal recht den h. Joseph er ist ja auch Dein Patron es ist ihm ein leichtes Dir einen braven Freund zu senden Du mußt nur recht herzlich darum bitten, wenn Du Dich auch einstweilen für Dich hältst auf die Dauer wirst Du doch das Bedürfnis nach einem treuen Freund haben. Dann bitte sei vorsichtig, hat derselbe eine böse spöttische Zunge über Religion nur lüsterne Blicke und Worte für Frauenspersonen dann halte ihn Dir vom Leibe er würde doch Dein Verräther werden. Also nur den h Joseph bitten er wird Dir alles besorgen.91
Als sich Vater Mengelberg über das geistliche Leben seines Sohnes Sorgen machte und er beunruhigt war, dass er seine religiösen Pflichten vernachlässige, schrieb er das auf direkte Weise. Einigermaßen empört antwortete Willem:
Du schreibst du hättest eine Ahnung als wenn ich auf dem besten Wege wäre meine Religion & den lieben Gott zu vergessen! […] ich [gebe] dir die beste Versicherung daß ich mein ganzes Leben lang treu meine Religion & meinen Gott lieben werde so vieles wenigstens in meinen Kräften steht.92
Im elterlichen Haus muss viel Aufmerksamkeit für alles geherrscht haben, was mit Krankheit, Gesundheit und Hygiene zu tun hatte. Die Gesundheit ihres Sohnes spielte in jedem Fall eine große Rolle in der Fürsorge der Eltern, und das nicht zu Unrecht, denn er war oft krank. Erkältungen und Ansteckungen kamen regelmäßig vor. Vermutlich spielte man mit den eigens erwähnten Behinderungen im Kontext seines Preiszeugnisses 1891, auf seine regelmäßig wiederkehrende, durch Krankheit verursachte Abwesenheit an.
Offenherzig schrieb Willem seinen Eltern über die körperlichen Beschwerden, wodurch er oft geplagt wurde. Die Herzensergüsse wurden ihrerseits von zahlreichen Ratschlägen, seine Gesundheit betreffend, beantwortet. So riet ihm sein Vater, um sich an das Klima in Köln zu gewöhnen viel spazieren zu gehen. Er rief „unser Bischof“ in Erinnerung, der nachdem er nach Utrecht übersiedelt war, auch jeden Tag mindestens zwei Stunden spazierte, wodurch er schnellstens an die verschiedenen klimatischen Umstände gewöhnt war.93 Er ermahnte ihn, dafür Sorge zu tragen, dass er besonders nachts zwischen Zwölf und drei Uhr mit Decken zugedeckt im Bett lag, denn das Wegrutschen von Decken hatte oft „schon schwere Unterleibskrankheiten gebracht“ und er schlug vor, dass Willem einen Stuhl an sein Bett stellen sollte, um die Bettwäsche griffbereit zu halten. Nachdem sein Sohn eine Erkältung hatte, war Vater Mengelberg der Ermahnungen und des Rates überdrüssig: Er musste aufpassen, nicht erneut eine Magenunstimmigkeit zu bekommen, denn die Schwäche und der Schmerz in die Arme, an dem er schon litt, wurden hervorgerufen von vernachlässigtem Durchfall, der ihn besonders empfänglich gemacht hatte. Er sollte jeden Tag ein ordentliches Stück Rauchfleisch für sich selbst kaufen, jeden Morgen ein großes Glas Milch trinken und seine Arme massieren. Anschließend sollte er unter kalt fließendem Wasser – aber bestimmt nicht zu lange! – seine Arme abspülen, sie leicht abtrocknen, einbalsamieren et cetera.94
Auch Mutter Mengelberg fragte sich oft, ob ihr Sohn wohl gut sorge für sich trage. So lesen wir im Dezember 1889:
Bist Du jetzt im Besitze eines neuen Winterrockes, lieber Wil? Es ist wohl an der Zeit warme Kleidung zu tragen, auch warme Strümpfe sind jetzt recht nöthig. Schreibe mir doch, wie es damit aussieht.95
Im Dezember 1891 war Willem durchgehend drei Wochen krank. Er hatte seine Eltern lange Zeit nicht schreiben können, weil „das ewige kranksein mich davon abgehalten hat.“96 Sein Großvater hatte allerdings einen Ausweg geboten, ihn kräftig gepackt und „abductirt“, eine schmerzhafte Massage gegeben, wodurch der eitrige Ausschlag auf seinem Körper zu heilen begann, und langsam verschwand. In einem weitläufigen und detaillierten Bericht erläuterte er den zweifellos interessierten Eltern seine Beschwerden mit den entsprechenden Symptomen und Behandlungen.
Es sieht so aus, dass die gut gemeinten Bemühungen und ständigen Ratschläge der Eltern für den jungen Musikstudenten auch mal etwas zu viel wurden. Im März 1890 wollte er sein Zimmer wechseln und musste eine heftige Auseinandersetzung führen, um von seinen Eltern Zustimmung dafür zu bekommen. Ein wichtiges Argument für Mengelberg war, dass er in der Nähe seines Freundes und Studienkollegen Peter Fassbaender wohnen wollte. „Seine Nähe ist mir mehr Werth als 3 Jahre Studium, und einen besseren und braveren Freund kann ich nicht finden.“ Mutter Mengelberg hielt davon aber nichts, denn bei Fräulein Decker, wo er wohnte, war er zumindest in einer vertrauten Umgebung.97 Um seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen, schrieb er seinem Vater:
Wenn ich mal etwas gethan hätte was nicht gut oder edel wäre würde ich mich eher vor dem Fassbaender als wirklicher künstler, als vor 100 Frl Deckers und Zalkmeisters schämen. 98
Auf einen Vorschlag seines Vaters, bei einem seiner Onkel einzuziehen, reagierte er sehr heftig: „Um Gotteswillen nicht zu Onkel oder so was ähnlichem“, aber auf diese Reaktion, dadurch verursacht dass er „sehr aufgeregt“99 war, folgte eine Reaktion des Bedauerns: „Ihr müsst wohl böse sein, dass ich so über den Onkel gewettert habe.100 Es tut mir echt leid.“101 Die übertrieben wirkende Aufregung um seinen Zimmerumzug scheint ein sicheres Indiz zu sein für Aufbrausen und Wut, die oft einer Stimmung folgt, die wieder für Vernunft sorgt.
Auch später, als Mengelberg in Luzern arbeitete, zeigten die Eltern noch Sorge um das Wohlergehen ihres Sohnes. So schickte Vater Wilhelm ihm 1894 einen Brief, diesmal auf Niederländisch, mit einem Zeitungsartikel: „Hier schicke ich dir den neuen Papstbrief aus dem Grund, dass du vielleicht nicht oft eine romsche[sic] Zeitung siehst.“102
Musikdirektor in Luzern 1892–1895: „Das ist unser Mann“103
Ende September 1892 wohnte Wilhelm Mengelberg bei „Großvater“ Schrattenholz in Köln. Er hatte sein Studentenzimmer schon gekündigt und erwartete ein „Todesurtheil“ aus Luzern. Auf Anraten von Franz Wüllner hatte er sich dort für die vakante Stelle des „städtischen Musiklehrer[s] u. Musikdirektor[s]“ beworben. An die Stadtverwaltung hatte er Folgendes geschrieben:
Hierdurch erlaube ich mir, mich um die Stelle musikdirektor bei Ihnen zu bewerben. Ich bin geborener Hollaender, habe 4 Jahre am Conservatorium in Cöln studirt & im vorigen Jahre daselbst ein Preiszeugnis erhalten. Im dirigiren von Chor & Orchester habe ich durch Jahrelange U[e]bung mir nicht nur Kenntniss sondern auch vol[l]kommene beherrschung dieses Tonkörpers angeeignet. Auch habe ich mir sowohl als Componist wie namentlich auch als Klavierspieler hier & auswärtig große anerkennung erworben & ausserdem ein Reifezeug noch als concertspieler & dirigent erhalten.104
Auf Anraten von Wüllner schickte er noch einen weiteren Brief mit Informationen über seine Qualitäten und Erfahrung als Organist.105 Seinen Eltern schrieb er, dass da mehr als 200 Bewerber waren (in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich 87 gewesen106) und er schloss nicht aus, dass er nicht in Betracht kam für die Stelle, „da es ja eine wahre Wundergeschichte wäre, wenn ich mit meinen 21 Jahren die Stelle bekäme!“107 Darüber hinaus war die Chance groß, dass kein Ausländer berufen werden sollte, aber ein Musiker aus der Schweiz. Selbstverständlich war Mengelberg stolz auf die schönen Zeugnisse, die seine beiden Hauptfachlehrer Wüllner und Seiß ausgestellt hatten. Seiß hatte geschrieben:
Herr Wilhelm Mengelberg, welcher unser Conservatorium vier Jahre lang besuchte, hat dasselbe nunmehr als ein ganz ausgezeichneter, vorzüglicher Künstler verlassen: ausgestattet mit seltner musikalischer Begabung, hat er hier, stets durch reger Fleiß unterstütztes Studium jetzt als eminenter Clavierspieler, dessen Spiel ebenso durch genialen Schwung wie classische Gediegenheit gekennzeichnet ist, als tüchtiger Componist und als ausgezeichneter Dirigent, beendet – dem es nicht fehlen kann, sich überall eine gleich große Anzahl wärmer Verehrer und Freunde zu erwerben, wie hier bei uns in Köln; – ich schreibe dies Alles mit bestem Gewissen und aus vollster festester Ueberzeugung.108
Im August 1892 war Mengelberg mit der Familie Heyer aus Köln ein paar Wochen in Ferien. Zunächst waren sie nach Bayreuth gereist, um im Festspielhaus Musik von Wagner zu hören und danach in die Schweiz. Während dieser Ferien hatte er die Schönheit der Schweizer Berglandschaft entdeckt. „Ich träume und schwärme noch immer von der Schweiz!“, schrieb er seinen Eltern.109 Die Liebe für diese Landschaft wird er sein ganzes Leben behalten.
Details
- Pages
- 800
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631905425
- ISBN (ePUB)
- 9783631905432
- ISBN (Hardcover)
- 9783631898925
- DOI
- 10.3726/b21024
- Language
- German
- Publication date
- 2025 (April)
- Keywords
- Musikleben 2. Weltkrieg Gustav Mahler Richard Strauss Musikgeschichte der Niederlande Geschichte Konzertgebouworchester Amsterdam Musikleben 1. Weltkrieg Musikleben New York Biografie
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 800 S., 8 farb. Abb., 83 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG