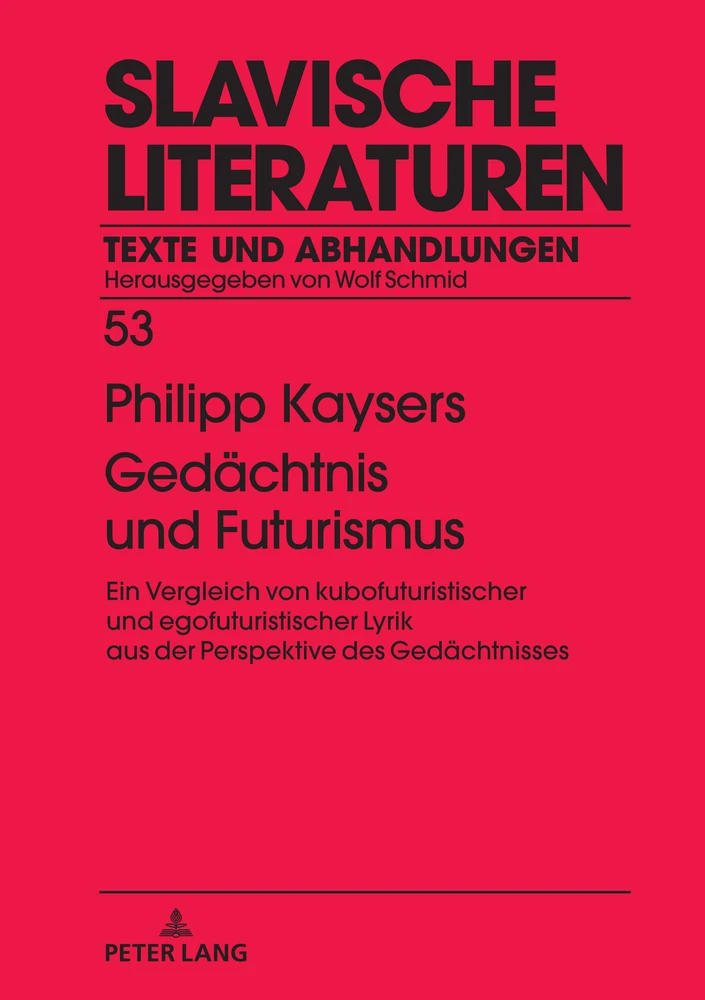Gedächtnis und Futurismus
Ein Vergleich von kubofuturistischer und egofuturistischer Lyrik aus der Perspektive des Gedächtnisses
Summary
Die heute unbekannten Texte werden mit den mittlerweile kanonisierten Wortkunstwerken des russischen Futurismus über eine aus Henri Bergsons Gedächtnistheorie abgeleitete Methodik verglichen.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anmerkungen
- Einleitung
- 1. Gedächtnis und Erinnern im russischen Futurismus – eine Bestandsaufnahme
- 1.1. Gedächtnispolemik im russischen Futurismus
- 1.2. Symbolismus und Futurismus – ein scheinbarer Gegensatz?
- 1.3. Der symbolistische Gedächtniskomplex und seine Nachwirkungen
- 1.3.1. Diabolischer Symbolismus und Futurismus
- 1.3.2. Vjačeslav Ivanovs Terror antiquus
- 1.4. (Neo)primitivismus im Futurismus
- 1.5. Etymologisches Denken als ein Teil einer Gedächtnisbewegung
- 1.6. Systematisierung des vorgelegten Überblicks
- 2. Überlegungen zur gedächtnistheoretischen Perspektive
- 2.1. Der Gedächtnisdiskurs in der russischen Moderne und die Philosophie Henri Bergsons
- 2.2. Henri Bergsons Philosophie im Diskurs zeitgenössischer Gedächtnistheorien
- 2.2.1. Sprachliches Erinnern
- 2.2.2. Identität und Erinnerung
- 2.3. Bestimmung des theoretischen Fokus
- 3. Gedächtnis nach Bergson
- 3.1. Wahrnehmung, Gedächtnis und Dauer
- 3.2. Bergsons Gedächtnisbegriff
- 3.2.1. Gedächtnis bei Halbwachs und Bergson
- 3.2.2. Individuelles Gedächtnis
- 3.2.3. Habituelles Gedächtnis
- 3.2.4. Das habituelle und das kulturelle Gedächtnis
- 3.3. Automatisierung und Gedächtnis – die Grundlage für Verfremdung
- 4. Zwischen Wiederholung und Assoziation – Ästhetik, Gedächtnis und Literatur
- 4.1. Wiederholungs(un)lust – Gedächtnis und Literatur
- 4.2. Jurij Lotman – Gedächtnis der Information und Gedächtnis der Kreativität
- 4.3. Lotmans kreatives Gedächtnis und das individuelle Gedächtnis Bergsons
- 4.4. Zusammenführung der theoretischen Diskussion
- 4.5. Systematisierung einer ästhetischen Position anhand von Bergsons Gedächtnistheorie
- 4.5.1. Erwartungserfüllungen und Verfremdungseffekte
- 4.5.2. Suggestion
- 4.5.3. Individuelle Assoziation
- 4.6. Methodik der literaturwissenschaftlichen Analysen
- 5. Gedächtnis und Kubofuturismus
- 5.1. Formalistische Terminologie und Gedächtnis
- 5.2. Über das Gedächtnis gelesen – Texte russischer Kubofuturisten
- 5.3. Zwischen Finnland und Istanbul – Fremdsprache und Gedächtnis
- 5.4. Jenseits des habituellen Gedächtnisses – kubofuturistische Poetik
- 6. Futurismus und Kanonisierung – vergessene Futuristen
- 6.1. Kanonisierungsprozesse und der russische Futurismus
- 6.2. Heraus aus dem Archiv – Textkorpus und Erinnerung
- 6.3. Die (fast) vergessenen Ego-Futuristen – eine Bestandsaufnahme
- 7. Ego-Futurismus – Beginn und Entwicklung der Strömung
- 7.1. Historischer Überblick
- 7.2. Prolog des Ego-Futurismus
- 7.3. Die Gesetzestafeln der Akademija ėgopoėzii
- 7.4. Erster egofuturistischer Almanach und die Ėgopoėzija v poėzii
- 7.5. Das Gründungsjahr der Gruppe der Ego-Futuristen
- 7.5.1. Ignat’evs Rückblick auf die Entwicklung des Ego-Futurismus
- 7.5.2. Severjanins Epilog – eine Zäsur für den Ego-Futurismus
- 7.6. Die erste Phase des Ego-Futurismus
- 8. Konstantin Olimpov
- 8.1. Leben und Werk
- 8.2. Olimpovs Aėroplannye poėzy und der Almanach Žonglery-Nervy
- 8.3. Das Genie und die Masse
- 8.4. Antikes Erbe und okkulte Prophezeiungen
- 8.5. Die Drei im Dreigespann
- 8.6. Olimpovs egofuturistische Poetik
- 9. Ivan Ignat’ev
- 9.1. Nach Severjanin – Ivan Ignat’ev als Autor und Verleger
- 9.2. Die intuitive Assoziation – Konkretisierung des egofuturistischen Programms
- 9.3. Der Band Ešafot im Kontext der egofuturistischen Programmatik
- 9.3.1. Intermediale Entgrenzungen und die Frage nach dem Kunstwerk
- 9.4. Ignat’evs Dichtung – eine Bilanz
- 10. Vasilisk Gnedov
- 10.1. Leben und Werk
- 10.2. Gnedovs egofuturistische Naturimpressionen
- 10.3. Typographische Experimente
- 10.4. Gnedovs ukrainischer Futurismus
- 10.5. Der Tod der Kunst
- 10.6. Vasilisk Gnedovs Ego-Futurismus
- Futurismus und Gedächtnis – ein Resümee
- Rückblick
- Fazit
- Limitationen und Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Die Transliteration der vorliegenden Dissertationsschrift folgt der üblichen wissenschaftlichen Form, wie sie auch in der Handreichung zum wissenschaftlichen Arbeiten des Fachbereichs Slawistik der Universität Salzburg zu finden ist. Anhand dieser Handreichung wurde auch der in der vorliegenden Dissertation verwendete Zitierstil erstellt.
Die Titel von literarischen und künstlerischen Werken erscheinen in transliterierter Form und in kursiven Lettern. Bei erstmaliger und wo angebracht auch bei weiterer Erwähnung folgt in Klammern eine Übersetzung ins Deutsche. Fremdsprachliche Fachtermini erscheinen hingegen nicht im Fließtext, sondern werden in Klammern nach der im Text angeführten deutschen Übersetzung bzw. Umschreibung genannt. Diese Fachwörter erscheinen ebenfalls kursiv und transliteriert. Nach der ersten Nennung wird im Weiteren die deutsche Übersetzung allein verwendet. Um jedoch Mehrdeutigkeiten zu reduzieren oder Eindeutigkeit herzustellen, folgt im gegebenen Fall an späterer Stelle der russische Begriff erneut in Klammern. Dies geschieht auch, um die Bedeutung des Begriffs an den entscheidenden Stellen zu unterstreichen.
Kürzere Zitate werden im vorliegenden Text ebenfalls transliteriert wiedergegeben. Solche Phrasen, kurze Sätze sowie Teilsätze werden im Fließtext umschreibend teilübersetzt, damit sie den Lesefluss nicht stören. Das fremdsprachliche Originalzitat findet sich dabei in Klammern am Ende des jeweiligen Satzes. Langzitate erscheinen eingerückt und vom Fließtext abgehoben. Sie verbleiben unverändert und werden nicht transliteriert. Die Übersetzungen der Langzitate finden sich in den entsprechenden Fußnoten.
Das Anführen von Textstellen aus Gedichten und anderer Primärliteratur, die in der vorliegenden Arbeit bereits im Fließtext oder im Anhang abgedruckt sind, erfolgt ebenfalls kursiv und in Klammern nach einem deutschen Äquivalent. Diese Textstellen werden jedoch nach einem ersten eindeutigen Quellennachweis ohne weitere Anführungszeichen und Belege angeführt, um redundante – und letztlich raumnehmende – Verweise im Rahmen der Dissertation zu reduzieren.
Die im Russischen sowie in der Sekundärliteratur variierende Schreibweise des Namens der Gruppe der Ego-Futuristen (Ėgo-Futuristy) – ob mit oder ohne Bindestrich – richtet sich hier in seiner deutschen Übertragung anhand der Dissertation von Henrike Schmidt aus. In dieser werden die Substantive wie „Ego-Futurismus“ und „Ego-Futurist“ mit Bindestrich, das Adjektiv „egofuturistisch“ aber ohne Bindestrich geschrieben, was der Einheitlichkeit halber hier übernommen ist.
Einleitung
Der russische Futurismus sowie die Literatur und die Kunst der Avantgarde gehören zu einer der am umfangreichsten untersuchten Zeitspannen innerhalb der Russistik.1 Zahlreiche Dissertationen und Untersuchungen wurden und werden diesem Abschnitt der russischen Kulturgeschichte gewidmet. Die Breite und Tiefe der bereits existierenden Arbeiten macht es folglich schwer, noch einen originellen und originären Beitrag zu verfassen. Die vorliegende Qualifikationsschrift unternimmt trotz der mittlerweile unübersichtlichen gewordenen Forschung zum Futurismus eben diesen Versuch. Dabei soll sich die Arbeit über zwei Besonderheiten auszeichnen. Zum einen wird sich dem russischen Futurismus über das Gedächtnis angenähert und zum anderen widmet sich die Dissertation den bisher kaum bekannten Autoren und Werken des Ego-Futurismus. Was diese beiden Aspekte auszeichnet, wird im Weiteren noch genauer zu klären sein. Vorab scheint es jedoch angebracht, einige wenige Worte über die Aktualität des russischen Futurismus im Allgemeinen zu verlieren. Dass die Auswahl gerade auf diese literarische Epoche als Gegenstand der Untersuchung fiel, begründet sich nicht allein aus einem literaturhistorischen Interesse. So zeichnen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts Problematiken ab, die – wenn sie nicht sogar bis heute bestehen – starke Parallelen zu heutigen Entwicklungen aufweisen.
Zur Aktualität des Futurismus
Aus seiner leiblichen Verfasstheit heraus und auf die Fähigkeiten des eigenen Körpers beschränkt, erlauben Werkzeuge dem handelnden Subjekt eine Auslagerung von Tätigkeiten auf Gegenstände. Diese Form der Veräußerung reicht in der Moderne bis zur vollständigen Übertragung von Prozessen auf mechanische und informationstechnische Objekte. Die technischen Erfindungen der vorletzten Jahrhundertwende eröffneten dem Menschen über kurz oder lang bisher verstellte Handlungs-, Kommunikations- und Bewegungsmuster und erschließen diese bis in die Gegenwart hinein. Über den maschinellen und digitalen Fortschritt des letzten Jahrhunderts sind somit zuvor nicht erwart- oder vorhersehbare Erfahrungsräume gangbar geworden. Die damit einhergehenden Veränderungen führten zweifelsohne zu unterschiedlich starken Verlagerungen in der Wahrnehmung des Subjekts, seiner Vorstellung von sich selbst sowie seiner Umwelt. Gleichzeitig fordert dieser Wandel von der Gesellschaft die Herausbildung von neuen gemeinschaftlichen Verhaltensweisen. Das persönliche Sein, aber auch das Selbstverständnis ganzer Kultur fing an zu schwanken, kippte zuweilen oder fiel auseinander. Die in einer fortschreitenden Digitalisierung befindliche Welt des beginnenden 21. Jahrhunderts ist für solche Entwicklungen ebenso anfällig und beispielhaft wie der Übergang zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert.
Die künstlerische und internationale Breite, die das Phänomens des Futurismus in Malerei, Literatur, Theater und Musik in den 1910er-Jahren erlangte, verweist retrospektiv schon fast seismographisch auf die tiefgreifenden Umbildungen des künstlerischen, aber auch des menschlichen Selbstverständnisses dieser Zeit. Zu Beginn der vorletzten Jahrhundertwende beschleunigte sich der Alltag der Menschen in einem vorher unbekannten Ausmaß. Nach der Entwicklung von Eisenbahn und Telegraf führten wenig später Automobil, Flugzeug und Telefon noch vor dem Ersten Weltkrieg zu einer Reduzierung des Raums auf ein nie zuvor bekanntes Minimum. Der Takt der Uhr gab die Bewegung und Strukturierung der Gesellschaft stärker vor denn je und alltägliche Kommunikationsstrukturen wurden seitdem einem schnellen Wandel unterzogen. Im Bereich der Kunst eröffneten verbesserte lithographische Drucktechniken, elektrische Scheinwerfer im Theater, aber vor allem Film und Kino neue Produktions- und Rezeptionsmöglichkeiten. In der Folge lösten sich in der im Umbruch begriffenen Welt traditionelle Gesellschafts- und Handlungsmuster ebenso auf wie konventionalisierte Ausdrucksformen in Literatur und Malerei.
Die Manifeste und Kunstwerke des italienischen Futurismus sind in ihrer Verbindung von Technik und Kunst gerade zu paradigmatisch. Zeugnis des Gefühls der Dynamisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und einer Suche nach angemessenen Formen für das künstlerische Schaffen sowie nach einer neuen Ausgestaltung des Miteinanders sind auch die Werke der russischen Futuristen.2 Die Spannungen zwischen rationalen und irrationalen Diskursen in den Gesellschaften verknüpft die derzeitige Gegenwart ebenfalls mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. So findet sich neben einem tiefen – und zum Teil übersteigerten – Vertrauen in einen technischen Positivismus auf der einen, ein tiefes Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Weltbildern auf der anderen Seite. Ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg besitzt antipositivistisches und sogar wissenschaftsfeindliches Denken derzeit eine gewisse Konjunktur, das dem fortschrittsgläubigen Teil der Menschen einen heterodoxen Irrationalismus gegenüberstellt.
Futurismus im Kontext von Erinnern und Gedächtnis – ein Widerspruch?
Für gewöhnlich wird das Prädikat Futurismus in der Literatur- und Kunstgeschichte nicht mit Schlagwörtern wie Vergangenheit, Kontinuität oder Gedächtnis in Verbindung gebracht. Üblicherweise ist diese Kunstrichtung mit einer Begeisterung für die Maschine konnotiert, steht für das zukünftig Befreiende, den Traditionsbruch sowie eine damit einhergehende Gedächtnislosigkeit und letztlich den Angriff auf das Bürgerliche.3 Auch werden ein übertriebener Männlichkeitskult, Nationalismus und Militarismus häufig mit dieser Strömung assoziiert. Sind gerade die letzten Schlagwörter für den italienischen Futurismus und insbesondere Filippo Tommaso Marinetti zutreffend, entzieht sich der russische Futurismus diesen Attributen teilweise, was den Militarismus betrifft sogar ganz.4 Anstatt einer Verabsolutierung der modernen Technik zeigt sich im russischen Futurismus eine deutliche Skepsis gegenüber der mechanisierten Lebenswelt der Moderne, eine Tendenz, die nach Groys den Avantgarden allgemein eigen ist.5
Die bereits bestehende breite Forschungsliteratur zu dieser Strömung hat in diesem Zusammenhang nicht zuletzt immer wieder den (Neo)Primitivismus als bedeutendes Merkmal des Futurismus in Russland hervorgehoben. Dass eine Unterscheidung anhand der Vergangenheitsbezüge zwischen italienischem und russischem Futurismus nur eine pauschale Trennung sein kann, dürfte auf der Hand liegen. An Marinettis Roman Mafarka il futurista (Mafarka der Futurist) verdeutlicht sich über den vormodernen Krieger Mafarka auf seinem Pferd und dem Maschinenmenschen am Ende des Romans ebenfalls das Konvergieren von „wilder“ urzeitlicher Stärke und der mechanisierten Zukunft des neuen Menschen.6 Ein anderes Beispiel für den historischen Rückbezug bilden die deutlich erkennbaren Formelemente gotischer Kathedralen, die Antonio Sant’Elias in seinen utopischen Entwürfen mit modernen Elektrizitätswerken und Flughäfen verwebt. Beide Pole, die nicht unmittelbare Vorvergangenheit sowie die Zukunft, verkörpern zeitliche und gesellschaftliche Extreme, die sich der Mitte – der Gegenwart – entziehen. Die Polarisierung in der Kunst der Futuristen stellt dem bürgerlichen Geschmack und dessen gewöhnlichen Handlungsweisen des stets präsenten Alltags ein Fremdes gegenüber.
Wesentlich deutlicher als bei den italienischen Futuristen zeigt sich die Dimension der Vergangenheit jedoch bei den russischen Vertretern dieser Strömung. So ist in den Texten Velimir Chlebnikovs, Aleksej Kručënychs und Vasilij Kamenskijs der Einfluss von skythischen Motiven oder Elementen der Ikonenmalerei unverkennbar. Aber auch andere Artefakte der russischen Volkskunst dienten den Futuristen als Objekt der Inspiration. In ihren – zumeist von einer archaischen Vergangenheit durchdrungenen – Kunstwerken mischen sich auf Teils eklektische Weise Epochen und Zeitschichten. Die Widersprüchlichkeit von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, von Vergangenem und Zukünftigem in den Bildern und Texten der Futuristen soll den Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation bilden. In diesem Rahmen scheint eine Analyse unterschiedlicher literarischer Werke des russischen Futurismus hinsichtlich des Erinnerns und des kulturellen Gedächtnisses angebracht. Auf diesem Weg sollen bestehende Tendenzen in der Forschung der letzten Jahre fortgesetzt werden, nach denen nicht nur der berühmte Bruch mit der Tradition zu betonen ist, sondern auch die Kontinuität der Werke der russischen Futuristen herauszustellen sei.7 So hat etwa Oleg Kling die Bedeutung des Gedächtnisses für ein futuristisches Schreiben in Bezug zum vorhergehenden Symbolismus hervorgehoben.
В самом же футуризме, как и в формальной школе, далеко не все было нацелено на разрыв с традицией. Кубофутуристы и формалисты во многом способствовали сохранению культурной памяти.8
Kručënychs Almanach Starinnaja ljubov’ (Alte Liebe) ist ein Beispiel für eine bewusste Rückwärtsgewandtheit sowie die Thematik des kulturellen Erinnerns in einem frühen Stadium des Futurismus. Das futuristische Büchlein (knižka) Kručënychs bedient sich der aufwendig ausgestalteten Kunstbücher der symbolistischen Vorgänger und anderer Zeitgenossen wie der Mir Iskusstva (Welt der Kunst), um über das Moment der gewollten Deformation eine Provokation hervorzurufen.9 Damit der Leser die ästhetische Differenzwirkung des Almanachs gegenüber etablierten Produktionsweisen jedoch erst bemerkt, muss dieser die allgemeinen Regeln, gegen die verstoßen wird, über sein Gedächtnis verinnerlicht haben. Auffällig – und für die Zeit entsprechend revolutionär – erscheinen bei Kručënych auch die handschriftliche Ausgestaltung sowie die weitere Herstellungsart des Almanachs. Modernste Techniken werden so mit einer regressiven Formensprache verbunden. Neben diesem rezeptionsästhetischen Blick auf das Gedächtnis im Zusammenhang von sozialen Schablonen und deren Verfremdung stellt die vom Autor bevorzugte Verwendung der Handschrift als Ausdrucksmittel selbst einen Rückgriff auf das kulturelle Gedächtnis dar. So wird die historische Buchproduktion über eine – wenn auch durch die moderne Technik gebrochene – Erinnerungsbewegung im Almanach Kručënychs aktualisiert.
Erst die drucktechnischen Neuerungen – vornehmlich in der Lithographie – ermöglichten es, anstatt fester Lettern die Flüchtigkeit von Kručënychs Handschrift wiederzugeben. Das Reproduzieren der Handschrift bietet dabei zusätzliche Ebenen des künstlerischen Ausdrucks, über die das ephemere Gefühlsmoment des Schreibenden fixiert und einem Publikum mitgeteilt werden kann. Programmatisch festgehalten wurde die Tatsache, dass die Handschrift die Stimmung des Autors an den Leser übermittelt, bereits im Manifest Bukva kak takovaja (Der Buchstabe als solcher) („Čto počerk, svoeobrazno izmenennyj nastroeniem, peredaet ėto nastroenie čitatelju, nezavisimo ot slov.“10). Die russischen Futuristen zielen damit deutlich auf eine Übersetzungsproblematik ab, die in der Übertragung von inneren heterogenen Empfindungen in diskrete Worteinheiten eines dichterischen Ausdrucks besteht. Über die Handschrift wird im Sinne eines automatischen Schreibens (écriture automatique) mit den vorhandenen Konventionen des Buchdrucks gebrochen und über das Moment der Verfremdung die „flüchtigen, zufälligen und handwerklichen Aspekte des Buches“11 hervorgekehrt, aber eben auch die inneren Empfindungen des Schreibenden betont.
Der Band Starinnaja ljubov’ zeigt aber nicht nur über den materiellen Gegenstand des Kunstbuchs einen deutlichen Rückgriff auf Vergangenes. So bildet das traditionelle Sujet der unglücklichen sowie unerwiderten Liebe das Leitmotiv der Texte, was dem Leser letztlich eine romantische Reminiszenz bietet. Darüber hinaus wird der Prozess des Erinnerns in dem Gedicht On i staryj i ustalyj (Er ist alt und müde) direkt von Kručënych thematisiert. Die vergangene erste Liebe erscheint einem alten Mann – durch die Umrisse des Feuers im Kamin angeregt („eja čerty iz ogon’kov“12) – in seinem Kopf über das Gedächtnis. Daneben sind in Ja v nebo mračnoe gljažu (Ich schaue in den finsteren Himmel) eindeutige historische Bezüge und Szenen zu finden. Es wird in diesen Versen der Moment nach einer Schlacht beschrieben, der sich unmissverständlich in einer entfernteren Vergangenheit verortet. Sowohl der Speer (kop’ë) sowie die Grabhügel (kurgany) verdeutlichen diesen Umstand.13 Der Band Starinnaja ljubov’ ist aber auch deshalb vom Gesichtspunkt des Gedächtnis- und des Erinnerungsdiskurses interessant, weil über das Gedicht Iz pisem Nataši k Gercenu (Aus den Briefen Nataschas an Herzen) eine – wie Markov bereits bemerkte – intertextuelle Imitation der romantischen Dichtung der Vergangenheit ohne irgendeine Form der Persiflage geboten würde.14
Ein weiteres Beispiel bildet die 1911 unter dem Titel Zemljanka (Die Erdhütte) erschienene Erzählung (povest’) Vasilij Kamenskijs. Die Zemljanka ist vor allem deshalb interessant, da es sich um den ersten umfangreichen literarischen Text eines später führenden Futuristen handelt.15 Zwar ist das Werk nicht archetypisch für die Strömung, jedoch werden die wichtigsten Elemente einer kubofuturistischen Poetik vorweggenommen. Dazu zählen insbesondere die Konfrontation von Natur und Stadt, die Betonung der Wortfaktur sowie ein unübersehbarer Primitivismus, der slawische Mytheme mit orthodoxen Versatzstücken mischt. So arbeitet der Autor auffällig stark mit der russischen Mythologie, wobei er umfangreich auf den Mythos einer Mutter-Feuchte-Erde (Mat’-syra-zemlja) zurückgreift.16 Diese Urmutter wird dabei von Marienmotiven überlagert. Nicht zuletzt zeigt sich der regressive Rückgriff in der immer wiederkehrenden Figur der Wassernixe (Rusalka) sowie in der Montage von Prosatexten, Märchen und selbstgedichteten Volksliedern. Unabhängig von diesen fernen Zeitschichten finden sich eindeutige und explizite intertextuelle Anlehnungen an die Literatur des 19. Jahrhunderts.
Das in Kamenskijs Zemljanka thematisierte Leiden Filipps an der technischen Moderne und dem urbanen Leben wird durch einen romantisch- eskapistischen Lebensentwurf auf dem Dorf und in der Natur gelindert. Inspiration und Vorbild fand der Autor in den Texten von Knut Hamsun.17 Zu einer Zeit, in der grundlegende Änderungen des Lebensvollzugs aufgrund maschineller Erfindungen stattfanden, wendet sich der Erzähler von der modernen Gesellschaft bewusst ab und zieht sich zurück. Der Traum der pastoralen Idylle wird dennoch stellenweise durch die von Leo Marx stilisierte Machine in the Garden gestört, wenn die ehemalige Geliebte Filipps aus der Stadt mit dem Dampfer zu ihm aufs Land reist.18 Die Empfindungen, Gedanken und Erinnerungen des Hauptcharakters stehen stets im Mittelpunkt der rousseauschen Weltflucht Kamenskijs, die zudem eindeutig slawophile Züge trägt. So wird der Rückzug auf das Land etwa als Gang ins Volk (choždenie v narod) stilisiert und bewegt sich erkennbar in der Tradition der Volkstümler (narodniki). Diese Interpretation legt zumindest Filipps zeitweilige Tätigkeit als Dorfschullehrer nahe. So überrascht es auch nicht, dass sich in der von Kamenskij gebotenen Dorfidylle direkte Zitate aus den Werken Nikolaj Nekrasovs und Lev Tolstojs finden.
Im Text werden Erinnern und Gedächtnis auch direkt thematisiert. Bereits zu Anfang der Erzählung wird das Erinnern an die Historie des eigenen Lebens als zentraler Wendepunkt für die weitere Entwicklung des Sujets markiert. Kurz vor dem Selbstmord stehend, erinnert sich die Hauptfigur Filipp plötzlich an seine Kindheit auf dem Land. Hervorgerufen wird diese Reminiszenz durch die Strahlen der Sonne und das Gezwitscher der Vögel am Morgen:
Вот тогда всем моим маленьким существом я понял что-то хорошее, радостное, дорогое, огромное. Но что? Я не мог объяснить. Я только чувствовал, что жизнь – это нескончаемый праздник радостей, всяких радостей. Да! Мне так ясно вспомнилосъ это утро на озере […].19
Das Gedächtnis und die darin enthaltenen Erinnerungen werden, wie die Textstelle verdeutlicht, zur entscheidenden Instanz der Selbstbestimmung und führen im Weiteren zu einem bewussten Lebenswandel Filipps. Über den Rückbezug und den Abgleich von Vergangenem mit der Gegenwart entscheidet sich der Erzähler letztlich dazu, die von ihm als verdorben und todbringend wahrgenommene Stadt zu verlassen und seine Zukunft aktiv zu gestalten. Nur über das Gedächtnis kann sich Filipp von den Zwängen des urbanen Lebens befreien und dank des Rückblicks ein neues Leben im Ural am Ufer der Kama beginnen. Wie in Kručënychs Starinnaja ljubov’ wird an dieser Stelle auch ein Auseinanderfallen von Empfindungen sowie deren mögliche Veräußerung über die Sprache thematisiert, wenn Filipp seine Empfindungen nicht erklären kann. Dem Erzähler fehlen die Worte, sodass er nur mittelbar auf veräußerbare Gefühle verweisen kann. Betrachtet man das Problem aus der Perspektive von Henri Bergsons Philosophie, so ist eben dieses Auseinanderfallen von innerem Seelenleben und veräußerter Sprache das Resultat einer Überlagerung der individuellen Gedächtnisseite durch die habituelle Seite des Gedächtnisses.
Die beiden hier skizzierten Beispiele verdeutlichen die Mannigfaltigkeit der Verbindung von Gedächtnis, Erinnerung und Futurismus. Mit dem Primitivismus oder dem Kunstbuch sind hier beispielhaft Themen und Formen genannt, die auch das Schaffen von Velimir Chlebnikov, Vladimir Majakovskij oder Elena Guro prägten. Zusammenfassend scheint folglich die Annäherung an den Futurismus über die Brille von Gedächtnis und Erinnerung lohnenswert. Im Folgenden bietet es sich jedoch an, zunächst den Zugang genauer zu umreißen.
Gedächtnis und Wahrnehmung
Anhand von Kamenskijs Zemljanka zeigte sich eine enge Verzahnung von Dynamik, Erinnerung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Freiheit sowie letztlich dem Auseinanderfallen von Empfindungen und Sprache. Filipps stetes Bewerten der eigenen Lebenssituation über den Rückbezug auf die eigene Lebenshistorie, der zum Teil durch ein plötzliches Erinnern ausgelöst wird, verdeutlichte literarisch, wie das Subjekt in seinem Handeln einen steten Abgleich zwischen Gegenwärtigem und Vergangenem vollzieht. Das Zukünftige entspringt in diesem Prozess aus der Gegenwart und der in jener aktualisierten Vergangenheit.
Eine enge Verzahnung von Wahrnehmung und Gedächtnis findet sich auch in Étienne Bonnot de Condillac Traité des sensations (Abhandlung über die Empfindung) von 1754. Condillac argumentiert, dass die Fähigkeit zu empfinden allein nicht ausreicht, um zwei unterschiedliche Zustände zu bewerten. Es braucht aus seiner Sicht stets das Gedächtnis, welches über den Rückbezug eine Veränderung feststellen kann.20 Dieser allgemeine ästhetische Punkt des Gedächtnisses ist für die Literatur und Kunst des Futurismus mit ihren impressionistischen Wurzeln nicht zu unterschätzen.21 Die Bedeutung der Bewegungsaufzeichnung stellte ein zentrales Problem für die Malerei der Avantgarde dar und findet sich auch in der Poetik der futuristischen Wortkunstwerke wieder.22 Das verdeutlicht sich bereits in der Kritik des jungen Roman Jakobsons, der in seinem Aufsatz Futurizm (Über den Futurismus) die Tendenz der bildenden Kunst und des Realismus des 19. Jahrhunderts beschreibt, die Bewegung in eine Reihe einzelner statischer Elemente zu zergliedern.23 Eben aus dieser vermittelten – dem dynamischen Lebensvollzug aber nicht gerecht werdenden – Festigkeit bilde sich laut Jakobson der Eindruck heraus, das Subjekt besäße nur eine momenthafte Wahrnehmung.
Das Gegenteil, so Jakobsons weitere Analyse, würden hingegen die Vertreter der Futuristen versuchen, wenn sie in ihren Werken der Bewegung und der Simultanität künstlerischen Ausdruck verleihen. Gleichzeitig wird somit auf die dynamische Wahrnehmung des Subjekts und indirekt auch auf das Gedächtnis des Betrachters verwiesen, die sich über die Zeit (sub specie durationis) kontinuierlich entfalten.24 Der von Jakobson in den Werken der Futuristen ausgemachte Anspruch konvergiert auffällig stark mit der von Henri Bergson kurz zuvor vorgelegten Gedächtnistheorie und der damit geäußerten Kritik an der positivistischen Psychologie des 19. Jahrhunderts. Bergson begreift Erinnerung und Gedächtnis, ähnlich wie Condillac, verzahnt mit der Gegenwart, wobei das Individuum über seine individuelle Gedächtnisseite (mémoire-pure) eine sich kontinuierlich entfaltende Dauer (durée) entwickle.
In seiner Auseinandersetzung mit der Dynamik des modernen Lebens verweist der Futurismus auch auf die sich ändernden Bewegungsmuster einer sich stetig mechanisierenden Gesellschaft der Jahrhundertwende. Das futuristische Sprachverständnis ist dabei stark geprägt von einem Protest gegen den wiederkehrenden Alltag (byt). Sprache wird für die Dichter so zu einem Aufstand gegen die „Repetitivität der Praxis“25 und richtet sich gegen eine fortschreitende Abnutzung des literarischen Wortes. Es zählt für die Autoren nur das fühlbare bzw. poetische Wort, welches „sprachkritisch die konventionalisierte Literatursprache sowie die mechanisierte Alltagssprache entblößt und zum Material einer radikalen Neuschöpfung [ge]macht“26 wird. Im Kontext von Henri Bergsons Schrift Matière et mémoire (Materie und Gedächtnis) kann sich ein solch entautomatisierendes Wahrnehmen durch Kunst als ein Bewusstwerden des habituellen Gedächtnisses oder auch Gewohnheitsgedächtnisses (mémoire-habitude) interpretiert werden. Diese Seite des Gedächtnisses steht dabei der oben erwähnten individuellen Gedächtnisseite gegenüber. Verfremdung führt zu einer Verlagerung der Aufmerksamkeit auf eben jene Prozesse, die ansonsten unbewusst durch das automatisierte Gedächtnis abgerufen werden. Das schematische Gedächtnis der Wiederholung wird erst offensichtlich, wenn die Repetitivität des alltäglichen Lebens und der etablierten bürgerlichen Kunst in den Werken der Futuristen verfremdet wird. Zusammenfassend scheinen also zwei Punkte der futuristischen Ästhetik eine Affinität zu Bergsons Theorie des Gedächtnisses aufzuweisen. Zum einen die kontinuierliche Wahrnehmung sowie das Erfassen von Bewegtem und zum anderen die (ent)automatisierenden Funktionen des Gedächtnisses.27
Zielsetzung und Forschungsfrage
Um Redundanzen in der Wissenschaft zu vermeiden, ist die vorliegende Untersuchung genötigt, signifikante Ergänzungen zu der bereits etablierten Forschung hinzuzufügen. Nicht zuletzt handelt es sich bei dem zu untersuchenden Abschnitt der Literaturgeschichte um einen sehr gut erforschten Bereich. Das grundlegende Problem, das einige Gedichte des russischen Futurismus – und hier ist es im quantitativen Sinne gemeint – überinterpretiert worden sind, bleibt dennoch bestehen. Das gilt, wie die Bestandsaufnahme der Forschungsliteratur zeigen wird, insbesondere für die Wortkunstwerke der Vertreter der Gruppe Gileja und der Kubofuturisten. Im Rahmen der Dissertation wird daher der fast vergessenen Gruppierung der Ego-Futuristen verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. Die Ego-Futuristen waren in den 1910er-Jahren für kurze Zeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, gerieten jedoch recht schnell in Vergessenheit. Die Analyse der egofuturistischen Gedichte bietet sich an, weil zum einen die Sekundärliteratur zu dieser Unterströmung bisher sehr kurz ausfällt und zum anderen, weil auf diese Weise neue Texte und unbekanntere Autoren erschlossen werden können. Die vorliegende Untersuchung vollzieht somit in der Wahl des Untersuchungsgegenstandes selbst eine Erinnerungsbewegung, indem sie das Archiv der Literatur des russischen Futurismus öffnet und die darin enthaltenen Zeugnisse mit heute bekannten und kanonischen Wortkunstwerken der Strömung konfrontiert.
In einer Untersuchung über den russischen Futurismus, die am Anfang des Jahres 1914 unter dem Titel Futurizm i bezumie (Futurismus und Wahnsinn) erschien, betrachtet der St. Petersburger Psychiater Evgenij Petrovič Radin neben den Kubofuturisten insbesondere auch den Ego-Futurismus. Die literarischen Erzeugnisse beider Strömungen prüfend, sollte in Futurizm i bezumie die Frage beantwortet werden, ob es sich bei den Texten um die Produkte von Wahnsinnigen handle. Vor dem Hintergrund des von Max Nordau in den 1880er-Jahren angestoßenen Diskurses über Entartung in der Kunst beleuchtet Radins Auseinandersetzung die Nähe zwischen geistiger Erkrankung und moderner Literatur. Radins Fazit richtete sich entschieden gegen eine Verbindung von Krankheit und künstlerischer Produktion, da sich der zwanghafte Selbstbezug seiner Patienten grundlegend von dem schöpferisch produktiven Egozentrismus der Futuristen unterscheide.28 Radin beschreibt so die Abwendung von der gesellschaftlichen Norm und die Hinwendung zu dem Ich des künstlerischen Subjekts als kreatives Moment. Überraschend stellte er dabei fest, dass das Ich für die Kubofuturisten wesentlich bedeutender sei als für den Ego-Futurismus („Oni ne tol’ko kubo, no i bol’še ėgo, čem ėgo-futuristy.“29).
Neue Aspekte über den russischen Futurismus herauszustellen meint jedoch auch, dass die Anschlussfähigkeit zum bestehenden Wissenstand gewährleistet sein muss. Aus diesem Rechtfertigungszwang entwickelt sich der hier gewählte Zugang. Es sollen literarische Werke des russischen Futurismus – vornehmlich Gedichte – aus der Perspektive des Gedächtnisses und des Erinnerns neu interpretiert werden. Die Beispiele Kamenskijs und Kručënychs verdeutlichten, wie breit eben diese Thematik bei der Analyse von Gedichten und anderen Texten gefasst werden kann. Für ein Beschreiben der futuristischen Dichtung im Zusammenhang mit dem Gedächtnis bietet es sich folglich an, die theoretische Folie aus einer Spannung zwischen Gegenwartsbezug – dem Wunsch, den eigenen Zeitgenossen vorauszugehen – sowie dem gleichzeitigen Rückgriff auf Vergangenes heraus zu entwickeln. Die Zielsetzung ist daher eine an Bergson ausgerichtete Beschreibung des hier problematisierten Phänomens. Die Forschungsfrage der Dissertation lautet daher wie folgt: Wie erinnert der russische Futurismus und welche Rolle spielen die Formen des Gedächtnisses nach Bergson in Hinblick auf ein literarisches bzw. futuristisches Schreiben?
Angeregt durch den obigen Kommentar Radins lässt sich die Aufgabenstellung der vorliegenden Dissertation weiter spezifizieren. Es bietet sich an, über die Ausprägungsformen des Gedächtnisses nach Bergson (mémoire-pure und mémoire-habitude) die Poetik von Kubofuturisten und Ego-Futuristen zu beschrieben und ggf. zu unterscheiden. Das gesetzte Ziel ist es demnach, verschiedene Gedichte des russischen Futurismus über die Größe des Ichs – also über das Gedächtnis des Einzelnen – zu analysieren und zu interpretieren. Die Gedächtnistheorie Henri Bergsons weist in diesem Sinne gewisse Affinitäten zum russischen Futurismus auf und ist stellt – wie im Weiteren begründet wird – einen geeigneten Ansatzpunkt für die Analysen dar. Neben den bereits genannten Konvergenzen zwischen Bergson und den Futuristen ist noch ein allgemeiner Vitalismus und die damit einhergehende Vorstellung der Belebtheit der Materie nennen. Eine weitere Korrespondenz zeigt sich in einem Freiheitsdrang, der versucht, sich mechanistischen und finalistischen Weltbildern zu widersetzen, was Raum für unabhängige sowie kreative Entfaltung lässt. Entwirft Bergson ein Modell, welches durch ein initiales (Neu)Beginnen in jedem Augenblick gekennzeichnet ist und sich über das Gedächtnis des Subjekts erklärt, findet sich in der futuristischen Dichtung ebenfalls schöpferisches Schaffen sowie das Zelebrieren der Freiheit im gegenwärtigen Moment. Bergsons Überlegungen lassen sich folglich – zumindest in Grundzügen – mit der antiapokalyptischen Utopik und dem archaischen Mythologem des Wachstums vereinen, die den russischen Futurismus auszeichnen.
Unabhängig dieser Konvergenzen ist aus wissenschaftlicher Sicht ein frischer Blick auf die Philosophie und Gedächtnistheorie Henri Bergsons im Rahmen der Kulturwissenschaften geboten. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg fanden die Arbeiten des Philosophen breite Aufmerksamkeit, was nicht zuletzt die zeitnahen Übersetzungen seiner Werke ins Russische verdeutlichen. Bergsons Schriften hatten dabei auch einen Einfluss auf die Konzeption eines kulturellen Gedächtnisses. Maurice Halbwachs Theorie der sozialen Rahmen (cadres sociaux) – ein für den gegenwärtigen Diskurs zentraler Text – entstand beispielsweise in enger Auseinandersetzung mit Thesen Bergsons. In den Zwischenkriegsjahren verlor Bergsons Denken jedoch mehr und mehr an Popularität. Nicht zuletzt hängt Bergsons Philosophie bis heute ein eher ungerechtfertigter Ruf – zumindest was seine frühen Werke betrifft – der Unwissenschaftlichkeit nach. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine „Wiederentdeckung“ Bergsons ab. So fanden seine Überlegungen zum Gedächtnis verstärkte Aufmerksamkeit vonseiten der Soziologie.30 Aber auch die Neurowissenschaft hat Bergson in den letzten Jahren wiederentdeckt. Insbesondere die Forschungsergebnisse Georg Northoffs zeigten eine empirische Grundlage für das Gedächtnismodell Bergsons.31 Aus diesen Gründen bietet es sich an, die Arbeiten des französischen Philosophen vorbehaltlos, aber kritisch, im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Diskussionen und Konzepten der Literatur- und Kulturwissenschaften zu prüfen.
Details
- Pages
- 412
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631903865
- ISBN (ePUB)
- 9783631903872
- ISBN (Hardcover)
- 9783631903841
- DOI
- 10.3726/b20931
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (June)
- Keywords
- St. Petersburger Ego-Futuristen Gedächtnistheorie Herny Bergsons Russischer Futurismus Lyrik des Futurismus
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 412 S., 8 s/w Abb. .