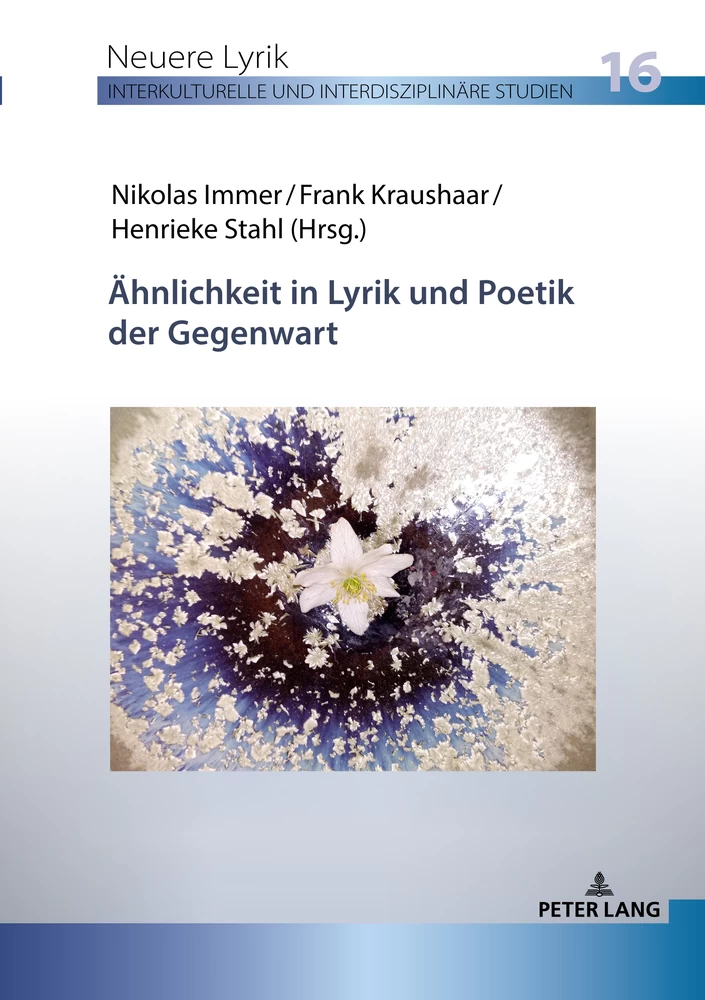Ähnlichkeit in Lyrik und Poetik der Gegenwart
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Nikolas Immer: Einleitung: Ähnlichkeiten erkunden. Perspektiven auf ein aktuelles Paradigma
- Christian Lehnert: Baumgespräche. Die natürliche Welt im Gedicht Poetikvorlesung
- Grazia Pulvirenti / Renata Gambino: Das „dichterische Gleichnis” als poetologische Denkfigur. Gedanken zu Goethes Analogiekonzept als biologisches und poetisches Prinzip
- Walter Erhart: „Schön und lieblich ist es zu vergleichen” – Ähnlichkeit und Vergleich in der Lyrik (Hölderlin, Jan Wagner)
- Ralph Müller: Ähnlichkeit in Lyrik und Literaturwissenschaft. Metapher, Vergleich und Parallelismus in Marcel Beyers „Falsches Futter”
- Franziska Bergmann: Vom poetischen Potenzial falscher Freunde. Zweisprachige Ähnlichkeitsrelationen in der Lyrik Uljana Wolfs
- Christian Quintes: Drama, Satire, Haiku, Notat: Ähnlichkeit als Strukturprinzip in Durs Grünbeins Poetik – nebst einem Ausblick auf die Ergiebigkeit der Ähnlichkeitsforschung für die Literaturund Kulturgeschichte des Traumes
- Mikhail Pavlovets: Die Dichtung der „Lianozovo-Schule” als Erfahrung der russischsprachigen konkreten Dichtung: das Problem der (Un)-Ähnlichkeit
- Josephine von Zitzewitz: Translating Russian Poetry into English in the Age of Social Media
- Joanna Krenz: Souls Like Cuckoo Clocks: On Com-pair-ison, Directing as Method, and the Poetry of Wisława Szymborska and Wang Xiaoni
- Marion Eggert: Programmatik der Ähnlichkeit in der Lyrik und Poetik der koreanischen Dichterin Kim Hye-soon
- Wiebke Denecke: The Politics of (Dis)similarity: New Tools to Understand the Emergence of Modern Literary Historiography in East Asia
- Hans Peter Hoffmann: Ähnlichkeitsforschung und das Übersetzen von Gedichten (am Paradigma des Sprachenpaars Deutsch-Chinesisch)
- Eduard Klopfenstein: „Ähnlichkeit” – als Prämisse für ein Übersetzungsexperiment Ein Praxisbericht
Einleitung: Ähnlichkeiten erkunden. Perspektiven auf ein aktuelles Paradigma
Nikolas Immer
Als Gottfried Benn am 21. August 1951 seine berühmte Rede „Probleme der Lyrik” hält, die Hugo Friedrich bald darauf als „ars poetica der heutigen Generation” bezeichnen wird,1 kommt er auch auf das Verfahren des lyrischen Vergleichens zu sprechen, von dessen Verwendung er allerdings abrät: „Wie, oder wie wenn, oder es ist, als ob, das sind Hilfskonstruktionen, meistens Leerlauf. […] Dies Wie ist immer ein Bruch in der Vision, es holt heran, es vergleicht, es ist keine primäre Setzung.”2 Benn wendet sich gegen solche Formeln des Vergleichs, weil sie seiner Auffassung nach von der „Präsenz und Unmittelbarkeit der im Wort gebannten Vorstellungen” wegführen.3 Gleichwohl ist seine Vorgabe keineswegs derart rigide, dass es keine Ausnahmen geben dürfte. Rainer Maria Rilke beispielsweise, auf den Benn anschließend verweist, „war ein großer WIE-Dichter”.4 Als einen Beleg nennt Benn das Sonett „Archaïscher Torso Apollos”, mit dem Rilke den zweiten Teil seiner „Neuen Gedichte” (1908) eröffnet hatte. Obwohl es sich bei den Vergleichen, die das Sonett enthält, sogar um drei „recht banale ‚Wies‘” handele,5 erläutert Benn nicht, warum das Gedicht als Ausnahme von seinem Diktum zu werten sei. Unausgesprochen bleibt, dass die Vergleiche „wie ein Kandelaber”, „wie Raubtierfelle” und „wie ein Stern” unterschiedliche materiale und mediale Dimensionen des titelgebenden Torsos hervortreten lassen.6 Auf diese Weise veranschaulicht Rilkes Sonett, wie Einsichten in die Beschaffenheit eines Kunstobjekts mithilfe von Relationen der Ähnlichkeit vermittelt werden können.
‚Ähnlichkeit‘ ist ein Begriff mit einer langen Theorieund Traditions-geschichte: „Prominente Autoren von der Antike bis zur klassischen Moderne haben […] die Bedeutung von Ähnlichkeit als erkenntnisleitender Idee […] hervorgehoben.”7 Im Zuge der kritischen Revision einer These Michel Foucaults, derzufolge das abendländische Ähnlichkeitsdenken im 17. Jahrhundert von einer „Vernunft der Identitäten und Differenzen” verdrängt worden sei,8 ist wiederholt auf die Reflexionen über Ähnlichkeit in der Moderne hingewiesen worden. Während Gerald Funk, Gert Mattenklott und Michael Pauen bereits 2001 darauf aufmerksam gemacht haben, dass „der Sinn für das Ähnliche im neunzehnten Jahrhundert in den Künsten an Bedeutung gewinnt”,9 hat Dorothee Kimmich den Blick auf das 18. Jahrhundert gerichtet und das in dieser Zeit konstatierbare Ähnlichkeitsdenken als eine „gewichtige Opposition gegen das Modell einer Dialektik der Aufklärung” bezeichnet.10 Trotz Jürgen Osterhammels keineswegs unberechtigter „Sorge vor [einer] Theorieüberstürzung” hat sich Ähnlichkeit als einschlägiges kulturtheoretisches Paradigma etabliert,11 dem auch das Potential zugesprochen worden ist, „lange arretierte Theoriedilemmata […] dynamisieren” zu können.12
Welche Probleme in den aktuellen Debatten über Ähnlichkeit zutage treten, hat Jørgen Sneis in seinem forschungsgeschichtlichen Überblick skizziert.13 Auf der einen Seite herrsche aufgrund der grundsätzlichen Möglichkeit, Ähnlichkeiten zwischen allen Dingen erkennen zu können, ein Ähnlichkeitsüberschuss. Weil es aber eine Herausforderung sein könne, konkrete Ähnlichkeiten zu erfassen, herrsche auf der anderen Seite eine Ähnlichkeitsknappheit. Die Konsequenz, die aus dieser „paradoxen Ähnlichkeitsökonomie” zu ziehen sei, liege in der Frage nach der Konzentration auf die „erkenntnisgenerierenden Ähnlichkeiten”.14 Dabei sei das heuristische Potential der Ähnlichkeit als einer Figur des „Kontinuierlichen, Übergänglichen” gerade darin zu entdecken, Erkenntnisbereiche jenseits „klare[r] Grenzziehungen und Klassifikationen” ausloten zu können.15 Um diesen Ansatz methodisch fruchtbar zu machen, hat sich die Verlagerung des Blickwinkels auf die eingangs erwähnte Praxis des Vergleichens als produktiv erwiesen. Demzufolge können die zu untersuchenden Ähnlichkeiten „teils als das Resultat von (einmaligen, in bestimmten Kontexten situierten) Vergleichsoperationen […], teils aber auch als das Korrelat von (intersubjektiven, mehr oder weniger stabilen) sozialen Praktiken” betrachtet werden.16
Die in dem vorliegenden Band untersuchten Formen der Ähnlichkeit in der gegenwärtigen Lyrik und Poetik sind daher immer auch mit Praktiken des Vergleichens verbunden. Eröffnet wird der Band mit CHRISTIAN LEHNERTS Poetikvorlesung über „Baumgespräche”, die er am 23. Juni 2022 an der Universität Trier gehalten hat. Mit seiner Naturlyrik zielt er darauf, dem Erstaunen sowie der Befremdung über die „Unmenschlichkeit natürlicher Phänomene” Ausdruck zu verleihen. Als Medium des Entdeckens und Erkennens behauptet sich das Gedicht insbesondere gegenüber idealisierenden Zugriffen, in denen die Natur auf eine „schöne Idylle” reduziert wird. Zugleich haben die Gedichte Anteil an der Ausprägung eines Konzepts von Natur, das als gesellschaftliche und künstlerische Konstruktion seinerseits das Resultat historischen Wandlungen ist. Wie Lehnert betont, geht es dabei nicht um beobachtende Festschreibungen, sondern um fragende Wahrnehmungen, die eine behutsame Annäherung an die Fremdheit der Natur ermöglichen. Am Beispiel des Johanniskrauts wird vorgeführt, wie über die Offenlegung zeichenhafter Ähnlichkeiten die Eigenheit dieser Heilpflanze erkennbar wird.
Im Anschluss konzentrieren sich GRAZIA PULVIRENTI und RENATA GAMBINO auf die poetischen und poetologischen Dimensionen der rhetorischen Figur des Gleichnisses. Auf der Grundlage moderner neurowissenschaftlicher Forschungen weisen sie das analogische Denken als zentrales kognitives Verfahren aus und erläutern die mentale Operation der konzeptuellen Integration. Im Anschluss an die Rekonstruktion historischer Bestimmungen des Gleichnisses von Aristoteles bis Paul Ricœur widmen sich Pulvirenti und Gambino eingehend Goethes Gebrauch dieser für ihn „zentralen Denkfigur”. Sie legen dar, wie über das Gleichnis analogische Relationen zwischen naturwissenschaftlichen Prinzipien und dichterischer Sprache hergestellt werden. Weil es diese Denkform zudem erlaubt, fernliegendste Elemente miteinander zu verbinden, repräsentiert sie für Goethe den „zentrale[n] Modus der sinngebenden Produktivität der Sprache”. Diese Wirkungskraft arbeiten Pulvirenti und Gambino an der „Zueignung” im „Faust I” und den Schlussversen des „Chorus Mysticus” im „Faust II” exemplarisch heraus.
Auch WALTER ERHART untersucht in seinem Beitrag Ähnlichkeiten, die durch das lyrische Sprechen hervorgebracht werden. Um solche Ähnlichkeiten zu erkennen und sichtbar zu machen, bedarf es einer Praxis des Vergleichens, die ihrerseits in der Lyrik selbst thematisiert wird. Am Beispiel von Hölderlins Hymne „Der Einzige” untersucht Erhart die gegenläufige Struktur des Gedichts, die darin besteht, „zu vergleichen und sich gegen den Vergleich zu wehren”. Während Hölderlin in geschichtsphilosophischer Perspektive auf der Vermittlung von Antike, Christentum und Moderne zielt, betont er zugleich die Unterschiede zwischen den Repräsentanten dieser Zeitalter. Dass auch Jan Wagner Ähnlichkeiten in seiner Lyrik produktiv einsetzt, zeigt Erhart anhand von Wagners Titelgedicht „Regentonnenvariationen”. In einem umfassenden Vergleichsgeschehen werden nicht nur dynamische Beziehungen zwischen Natur und menschlicher Kultur entfaltet, sondern auch bestehende Ordnungsmuster aufgebrochen und verschoben.
Dass der Vergleich als eine wissenschaftliche Methode bzw. als „heuristische Verfahrensweise” zu werten ist, bei der zwischen quantitativen und qualitativen Vergleichen unterschieden werden muss, erläutert RALPH MÜLLER. Anhand theoretischer und poetologischer Schriften Christian Wolffs und Jacob Masens rekonstruiert er, dass bereits in der Rhetorik und Philosophie der Frühen Neuzeit ergiebig über Strukturformen der Ähnlichkeit reflektiert wurde. Nach einem Exkurs zur Vergleichstheorie der Metapher widmet sich Müller dem Gedichtband „Falsches Futter” von Marcel Beyer, in dem die Präsentation unverbundener Sachverhalte wiederholt dazu herausfordert, über Vergleiche semantische Beziehungen herzustellen. Mit Rekurs auf das Gedicht „Kirchstettner Klima” kennzeichnet Müller nicht nur Beyers poetisches Verfahren des mash-up, sondern verdeutlicht auch, dass über die ausgestellte „Vielstimmigkeit” des Gedichts gezielt gegensätzliche Bezugsfelder vergleichend aufgerufen werden.
Nach solchen ‚Vielstimmigkeiten‘ fragt auch FRANZISKA BERGMANN, die mit Bezug auf Uljana Wolfs Gedichtband „falsche freunde” untersucht, wie linguistische Interferenzen zwischen dem Deutschen und dem Englischen produktiv gemacht werden. Weil die Lyrik dazu tendiere, assoziative, alogische und äquivalente Beziehungen auszubilden, könne Ähnlichkeit als „elementare Strukturkategorie” dieser literarischen Gattung bestimmt werden. Bergmann legt dar, dass der Fokus in Wolfs Gedichtband auf translatorischen Interferenzfehlern liegt, die zur Entstehung sogenannter „falscher freunde” führen. Am Beispiel eines Gedichts, in dem der Begriff „understand” im Zentrum steht, behandelt Bergmann die interlingualen Ähnlichkeitsrelationen, die sich als Freiräume für die Hervorbringung innovativer Sprachbeziehungen erweisen.
Auch bei CHRISTIAN QUINTES spielen assoziative Beziehungen ein elementare Rolle, beschäftigt er sich doch mit literarischen Gestaltungen des Themenfelds Traum, das Durs Grünbein in seinem Werk wiederholt variiert hat. Mit Rekurs auf den autobiographischen Bericht „Die Jahre im Zoo” kennzeichnet Quintes das Kaleidoskop als poetologische Denkfigur, die verschiedene Ähnlichkeitsbeziehungen generiert. Solche Verbindungen stiftet Grünbein insbesondere zwischen unterschiedlichen Zeiten und Kulturen, wie etwa sein Gedichtband „Nach den Satiren” belegt. Quintes erläutert, dass Grünbein mit dem Gedicht „Kein gutes Omen” sowohl auf das antike Wissen der Traumdeutung als auch auf das Analogiedenken der Traumtheorien rekurriert. Mit dem Langgedicht „Das Reservoir der Träume” präsentiere Grünbein nicht nur die Geschichte des Traumes in nuce, sondern auch eine eigene Traumtheorie, die sich bewusst von der psychologischen Vereinnahmung emanzipiere.
Im Folgebeitrag von MIKHAIL PAVLOVETS wird der Blick über die deutsche Lyrik hinaus auf die Dichtung der „Lianozovo-Schule” gerichtet, mit deren Konzept der „Annäherung durch Ablehnung” er sich auseinandersetzt. Pavlovets rekonstruiert, wie Eduard Limonov in den 1970er Jahren programmatisch den Standpunkt vertritt, die Lyrik auf einen „konkreten Realismus” zu verpflichten. Während er mit der „Gruppe Konkret” an der „Herstellung eines Markennamens” arbeitet, wendet sich Vsevolod Nekrasov gegen die Etablierung einer normierenden Gruppenästhetik. Pavlovets betont, dass Nekrasov zwar die künstlerische Selbständigkeit akzentuiert, zugleich aber auch die „typologischen Ähnlichkeiten” in den poetischen Verfahren hervorhebt, die von ihm und den europäischen Vertreter*innen der Konkreten Poesie angewendet werden. Dieser ertragreiche Dialog lässt sich überdies als Instrument zur Erweiterung und Bereicherung der nationalen Dichtung werten.
JOSEPHINE VON ZITZEWITZ befasst sich ebenfalls mit russischer Lyrik, behandelt aber den Einfluss und die Bedeutung sozialer Medien bei der Übersetzung russischer Lyrik in die englische Sprache. Sie stellt fest, dass die unterschiedlichen digitalen Plattformen nicht nur den interaktiven Austausch der Nutzer*innen, sondern auch die Entstehung von ‚Partizipationsgemeinschaften‘ (Henry Jenkins) fördern. Zitzewitz erläutert, dass mit der Verlagerung in den Raum des Digitalen die Anforderungen an die Übersetzer*innen wachsen, da sie neben der Translation zunehmend für die Publikation und Distribution der übersetzen Texte verantwortlich sind. Zugleich ermöglichen die digitalen Plattformen engere Kooperationen zwischen den Lyriker*innen und Übersetzer*innen sowie die Etablierung von Gemeinschaften wie der „Russian Literary Translators Group”, in der auch Übersetzer*innen ohne professionelle Ausbildung mitwirken. Auch wenn die Übersetzungen zunehmend in ähnlicher Form als Performances inszeniert und multimedial aufbereitet werden, ist ihre Publikation noch vielfach, wie Zitzewitz unterstreicht, von den Herausgeber*innen einschlägiger Zeitschriften abhängig.
JOANNA KRENZ, die anschlie end Ähnlichkeiten zwischen polnischer und chinesischer Lyrik auslotet, setzt sich zunächst kritisch mit dem Verfahren des traditionellen Vergleichens (‘compare’) auseinander. Demgegenüber konturiert sie das Konzept des ‘compairing’, das es erlaubt, die zu vergleichenden Elemente als Teile eines zusammengehörigen Paars wahrzunehmen, das seinerseits neue Qualitäten hervorzubringen vermag. In ihrer Untersuchung konzentriert sich Krenz auf die Lyrikerinnen Wisława Szymborska und Wang Xiaoni, deren Texte auf ähnliche Weise einer „Poetik der Unsichtbarkeit” verpflichtet sind. So habe insbesondere Wangs “poetry of intimacy, modesty, understatement, and tactful whimsicality” die internationale Verbreitung ihrer Lyrik befördert. In der analytischen Zusammenschau greift Krenz mit den Aspekten der androgynen Subjektentwürfe, der physikalischen Gesetzmä igkeiten und der metaphysischen Dimensionen zentrale Vergleichsmomente auf, über die sich substantielle Beziehungen zwischen den Texten beider Lyrikerinnen ergeben.
In Erweiterung dieser Perspektive beschäftigt sich MARION EGGERT mit der Lyrik und Poetik der koreanischen Dichterin Kim Hye-soon, die aufgrund zahlreicher Übersetzungen längst internationale Bekanntheit erlangt hat. Mit ihrer Lyrik zielt sie darauf, sich von traditionell männlich geprägten Mustern abzusetzen und das weibliche Schreiben neu zu positionieren. Am Beispiel des Gedichts „Was tun mit ihm, dem überschweren Vater” legt Eggert dar, wie Kim Hye-soon eine solche Distanznahme mithilfe eines virtuosen Ähnlichkeitsverfahrens gelingt. Im Zentrum der Analyse steht der Band „FrauTierAsienVerkörpern”, in dem insbesondere das Motiv der Reise dazu dient, Ähnlichkeiten erfahrbar zu machen. Wie Eggert in diesem Zusammenhang ausführt, zeigt sich in Hye-soons Umgang mit Asien nicht nur die Abgrenzung von westlichen Vorstellungen, sondern auch die Abwehr nationalstaatlicher Tendenzen.
Im Folgebeitrag untersucht WIEBKE DENNECKE das Aufkommen der modernen Literaturgeschichtsschreibung in Ostasien, die sie im Horizont der „politics of (dis)similarity” behandelt. Während sie sich im Anschluss an Jürgen Osterhammel zunächst gegen die Überhöhung des Konzept der Ähnlichkeit zum neuen theoretischen Paradigma wendet, geht es Dennecke anschließend darum, die politischen und ideologischen Funktionen des Vergleichens im Hinblick auf die Entwicklung der Literaturgeschichtsschreibung in Ostasien herauszuarbeiten. Ihre Differenzierung zwischen ideographischen, heterographischen und xenographischen Darstellungsformen erlaubt es im Hinblick auf die behandelten Verfasser, den Einfluss ihrer kulturellen Hintergründe und spezifischen Motivationen sichtbar zu machen. Über die Kennzeichnung der Literaturgeschichtsschreibung als soziale Praxis gelingt es Denecke, an-hand exemplarischer Fallbeispiele offenzulegen, welche Funktionen dieser historiographischen Tätigkeit beispielweise im Rahmen der Literaturvermittlung oder auch im Zuge der Etablierung von akademischen Disziplinen – wie etwa der Philosophie – zukommt.
Welche Korrespondenzen zwischen der Ähnlichkeitsforschung und der Translations- und Übersetzungswissenschaft bestehen, erörtert HANS PETER HOFFMANN im Anschluss. Im Hinblick auf das Verhältnis von Ausgangs- und Zieltext im Rahmen einer literarischen Übersetzung hebt er hervor, dass nicht nach der Erfüllung des Identitätspostulats, sondern vielmehr nach der Gestaltung der Ähnlichkeits-Distanz gefragt werden müsse. Anhand von zwei Gedichten demonstriert Hoffmann die Potentiale des literarischen Übersetzens und leitet aus diesen Überlegungen Maßstäbe für die Gestaltung der Ähnlichkeits-Distanz ab. Im Horizont von Übersetzungen aus dem Chinesischen widmet er sich dem „verfremdenden Übersetzen” und konturiert das „anfremdende Übersetzen” als heuristisches Gegenkonzept.
Im Schlussbeitrag, der als ein Praxisbericht angelegt ist, geht EDUARD KLOPFENSTEIN auf die grundsätzliche Frage nach der Ähnlichkeit von Dichtung aus dem indogermanischen und aus dem außereuropäischen Sprachraum ein. Im Unterschied zu Theodor W. Adorno und Octavio Paz votiert Klopfenstein mit Rekurs auf Norbert Mecklenburg dafür, Dichtung im Sinne einer „sprachund kulturübergreifenden poetischen Gestaltungs- und Ausdruckssphäre” anzuerkennen. Vertiefend widmet sich Klopfenstein einem Übersetzungsexperiment, das im Herbst 1993 in der Zeitschrift „Passagen / Passages” veröffentlicht wurde und an dem er selbst beteiligt war. Das präsentierte Beispiel belegt, dass sich trotz der Mehrfachübersetzung eines Gedichts dessen Charakter und Aussage in den unterschiedlichen Sprachen kaum verändert.
* * *
Die Beiträge dieses Sammelbandes gehen mehrheitlich auf die Tagung „Ähnlichkeit als Strukturkategorie der Lyrik. Perspektiven für die interkulturelle und komparatistische Literaturwissenschaft” zurück, die von der DFG-KollegForschungsgruppe „Russischsprachige Lyrik in Transition” (FOR 2603) vom 4. bis 7. Dezember 2019 an der Universität Trier veranstaltet wurde. Für die wertvolle Unterstützung bei der redaktionellen Bearbeitung der Beiträge danken wir Dr. Hannah Schlimpen und Dr. Emilia Tkatschenko herzlich. Ebenso danken wir Sandra Ehnert vom Peter Lang-Verlag für die professionelle Betreuung dieser Publikation.
Trier, Dezember 2022,
die Herausgeber
Literatur
Benn, G. (2001): Probleme der Lyrik. In: Ders.: Sämtliche Werke. Bd. VI: Prosa 4. Herausgegeben v. G. Schuster. Stuttgart. 9-44.
Bhatti, A. u. a. (2011): Ähnlichkeit: Ein kulturtheoretisches Paradigma. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Bd. 36. Heft 1. 233-247.
Epple, A. / Erhart, W. (Hgg., 2015): Die Welt beobachten. Praktiken des Vergleichens.
Frankfurt am Main/New York.
Fischer, B. (2016): „Probleme der Lyrik” (1951). In: Hanna, Ch. M. / Reents, F. (Hgg.): BennHandbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, 215-219.
Foucault, M. (1974): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften.
Frankfurt am Main.
Friedrich, H. (1956): Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg.
Funk, G. / Mattenklott, G. / Pauen, M. (2001): Symbole und Signaturen. Charakteristik und Geschichte des Ähnlichkeitsdenkens. In: Dies. (Hgg.): Ästhetik des Ähnlichen. Zur Poetik und Kunstphilosophie der Moderne. Frankfurt a.M. 7-34.
Kimmich, D. (2015a): Orte der Ähnlichkeit. Literarische Aushandlungen im bürgerlichen Realismus. In: Bhatti, A. / Dies. (Hgg.): Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma. Konstanz. 187-202.
Kimmich, D. (2015b): Im Fluss. Joseph Conrads „Heart of Darkness” und die ‚entsetzliche‘
Ähnlichkeit der ‚Wilden‘. In: Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Bd. 2. 187-194.
Osterhammel, J. (2015): Ähnlichkeit – Divergenz – Konvergenz. Für eine Historiographie relationaler Prozesse. In: Bhatti, A. / Kimmich, D. (Hgg.): Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma. Konstanz 2015. 75-91.
Patrut, I. (2016): Rezension: Bhatti, A. / Kimmich, D. (Hgg.): Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma. Konstanz 2015. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik. Bd. 7. Heft 1. 195-200.
Rilke, R. M. (1988): Sämtliche Werke. Herausgegeben v. Rilke-Archiv in Verbindung mit R. Sieber-Rilke. Besorgt durch E. Zinn. Bd. 1: Gedichte. Erster Teil. Wiesbaden.
Sneis, J. (2019): Ähnlichkeit und Vergleich. Bemerkungen zu einer aktuellen kulturtheoretischen Diskussion. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Bd. 44. Heft 1. 132-145.
Details
- Pages
- 284
- Publication Year
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9783631901984
- ISBN (ePUB)
- 9783631901991
- ISBN (Softcover)
- 9783631900024
- DOI
- 10.3726/b20822
- Open Access
- CC-BY
- Language
- German
- Publication date
- 2023 (May)
- Keywords
- Vergleich Gedicht Übersetzung Reflexion Differenz
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 284 S., 5 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG