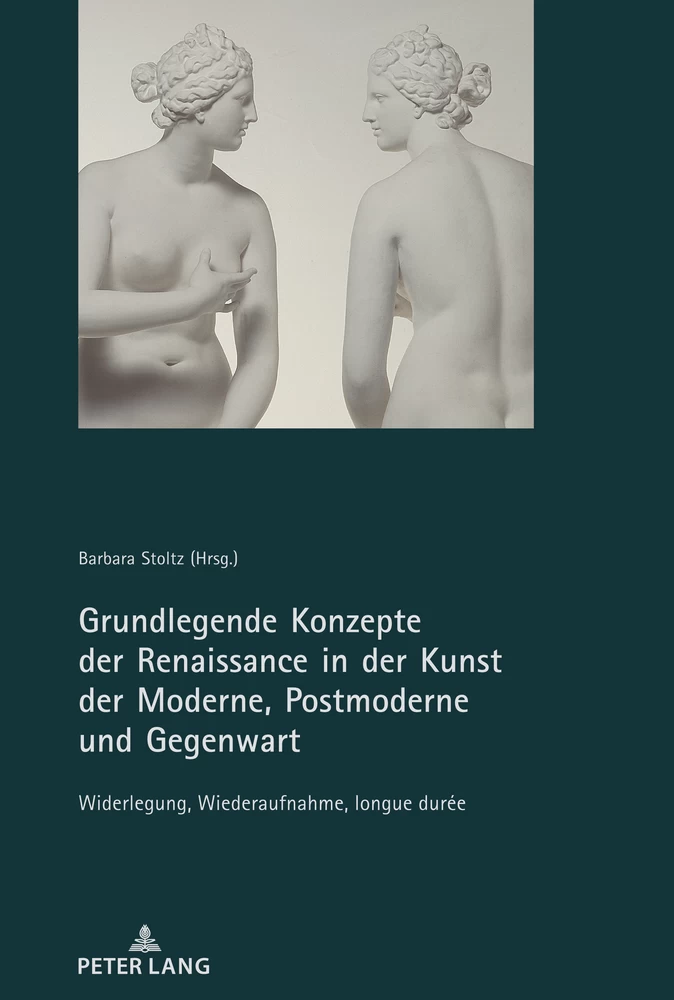Grundlegende Konzepte der Renaissance in der Kunst der Moderne, Postmoderne und Gegenwart
Widerlegung, Wiederaufnahme, longue durée
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- Abstract (zum gesamten Buch)
- Künstlerische Konzepte und Kunsttheorie seit der Renaissance – aus der Sicht der Moderne und Postmoderne
- Renaissance und Gegenwartskunst. Rekonstruktion einer Beziehungslosigkeit
- Immaterialisierungen. Anmerkungen zur Diskursgeschichte konzeptueller Kunst – von Giorgio Vasari über Charles Le Brun und Yves Klein zu gegenwärtigen Positionen
- Konzepte des Zeichnerischen. Von Vasaris „disegno“ zu Mel Bochners „Working Drawings“
- Dignitas contra Banality: Konzepte der Harmonie und Würde bei Francesco Vezzoli, Jeff Koons und Giulio Paolini
- Beträger*innen
Abstract (zum gesamten Buch)
Die Kunstwissenschaft stellt immer wieder die Frage nach der Tradition, Entwicklung oder Wandlung bestimmter künstlerischer Gedanken, Begriffe oder Diskussionen. Als Beispiel sei etwa die Einbildungskraft genannt, welche unter dem Begriff der phantasia die Künstler*innen und Denker*innen beschäftigt, oder etwa der Entwurf (Zeichnung, disegno) und die Bilderfindung (invenzione) oder schließlich das Prinzip der Harmonie, das von einem Kunstwerk gefordert wird. Mitunter in aufwendigen Monographien lassen sich solche künstlerischen Grundsätze geschichtlich rekonstruieren. Doch was geschieht, wenn man die Perspektive ändert und die Wandlungen der künstlerischen Gedanken aus der Rückschau betrachtet, insbesondere aus der Sicht der Gegenwartskunst? Dann stellen sich etwa folgende Fragen: Kann man die heutige Kunst nach tradierten, historischen Konzepten aufschlüsseln, oder ist es gegeben sich von diesen Paradigmata abzukoppeln? Bedient sich die Kunst nicht aber nach wie vor der historischen Muster, oder verwendet Materialien und Verfahrensweisen, die sie unweigerlich in die Schemata der Kunstkonzepte der Vormoderne lenken? Oder ist es etwa nicht so, dass sich bestimmte künstlerische Konzepte oder Errungenschaften, insbesondere seit der Renaissance, in der die kunsttheoretischen Gedanken in maßgeblichen Schriften wie denjenigen von Alberti bis Leonardo formuliert wurden, wie Konstanten in der Geschichte der Kunst durchziehen?
Der vorliegende Aufsatzband führt eine solche Rückschau vor und zeigt nicht nur, dass hierbei neue Ansätze des kunstwissenschaftlichen Umgangs mit künstlerischen Paradigmata bewerkstelligt werden, sondern auch, dass immer wieder grundsätzlich über die Bedeutung der Kunsttheorie, der Wirkmacht der Kunstwahrnehmung, des Kunstbetriebs und der Traditionswerte nachgedacht wird. Insbesondere muss aus der Sicht der Moderne und Postmoderne die Definition der Kunsttheorie überprüft werden. Es kommt diesbezüglich auch die Frage auf nach dem Verhältnis zwischen dem, was Kunsttheorie bedeutet, und dem, was sich als einzelne theoretische Überlegung, Begriff, Definition und vor allem Konzept, festsetzt. Nimmt man sich demnach zur Aufgabe, die Wandlungen, sprich: die Widerlegung, Wiederaufnahme und die longue durée von Konzepten seit der Renaissance zu untersuchen, muss geklärt werden: Was ist Kunsttheorie und was sind künstlerische Konzepte?
Auf die Frage, ob frühneuzeitliche Konzepte wie disegno oder invenzione als universelle Konstanten bezeichnet werden können, antworten die vorliegenden Beiträge aus unterschiedlichen Positionen heraus, veranschaulichen aber gleichzeitig die Dynamiken, die gerade deshalb entstehen, weil diese Konzepte immer wieder in den Mittelpunkt der künstlerischen Überlegungen rücken. Diese künstlerischen, modernen, postmodernen oder gegenwärtigen Rückblicke treten hierbei auf als Missverständnisse, aber auch als künstlerische Forschung, Künstlertheorie oder künstlerische Parodie. Die kunstwissenschaftliche Aufschlüsselung dieser Retrospektiven kann wiederum die brüchigen Entwicklungen der Konzepte erfassen, und dabei nicht nur das Hin und Her ihrer Auslegungen aufzeigen, sondern auch ihre Ideologisierungen oder Mystifizierungen, aber vor allem das kunstwissenschaftliche Verständnis der divergierenden Bedeutungen der historischen Konzepte immer wieder in neue Diskussionen setzen.
Barbara Stoltz
Künstlerische Konzepte und Kunsttheorie seit der Renaissance – aus der Sicht der Moderne und Postmoderne
Die Philosophin Susanne Langer (1895–1985) stellt in der Einleitung ihrer 1953 veröffentlichten Schrift Feeling and Form fest, dass, während die Kunst einer strikten Einheit und Logik folge, die Kunsttheorie von keinem System geleitet werde.1 Mit dieser Äußerung begründet Langer die Notwendigkeit der Aufstellung eines Denksystems, das als Basis für die zukünftige Entwicklung der Theorie der Kunst dienen würde. Langer richtet ihr Augenmerk auf die gegenwärtige Kunstkritik der Nachkriegszeit. Sie erwähnt in diesem Zusammenhang weder kunstliterarische noch kunstphilosophische Texte vergangener Epochen, doch ihre Forderung nach einer systematischen Kunsttheorie gilt sowohl für die zeitgenössische als auch für die vergangene Kunst. Ihr Ziel ist es, diese Theorie mit Methoden der Philosophie und in direkter Betrachtung der Kunst in einer kohärenten Struktur zu entwickeln.2
Langers Herangehensweise entspricht – in Bezug auf die Absicht, eine methodische Reflexion über die Kunst aufzustellen – derjenigen eines der prägnantesten Traktate aus der Renaissance, welcher die Kunsttheorie als literarische Disziplin endgültig etablierte: Due Lezzioni von 1549, verfasst von dem Literaten Benedetto Varchi (1503–1565).3 Beide Autoren verwenden philosophische Denksysteme, um eine umfassende Theorie der Kunst zu konstruieren. Es liegt aber nicht nur auf der Hand, dass sich über die Jahrhunderte hinweg zwischen diesen Abhandlungen das Verständnis und die Methoden der Philosophie gewandelt haben, sondern auch, dass eine gänzlich andere Bestimmung der Kunsttheorie vorliegt. Da Varchis Traktat in einer frühen Epoche der Kunsttheorie entsteht und Langers Schrift in eine Zeit der kritischen Auseinandersetzung mit der Kunst fällt, in der ein Bruch mit vormodernen, traditionellen theoretischen Leitlinien und auch mit der traditionellen Kunsttheorie bzw. Kunsttheorie im Allgemeinen stattfindet, ist eine Gegenüberstellung der Prinzipien dieser beiden Denksysteme lehrreich: Sie führt in Bezug auf die immer wieder gestellte Frage der Kunstwissenschaft – der sich der vorliegende Sammelband ebenfalls widmet – nach der Tradition, Entwicklung oder Wandlung bestimmter künstlerischer Gedanken, Begriffe oder Diskussionen4 zur generellen Frage nach dem Verhältnis zwischen dem, was Kunsttheorie bedeutet, und dem, was sich als einzelne theoretische Überlegung, Begriff, Definition und vor allem Konzept, festsetzt. Diese grundsätzliche Konfrontation erlaubt wiederum als Hintergrund, die tatsächliche Gewichtung der Wandlungen bestimmter künstlerischer Konzepte in der Geschichte der Kunst zu erfassen und nachzuvollziehen. Nimmt man sich demnach zur Aufgabe, die Wandlungen, sprich: die Widerlegung, Wiederaufnahme und die longue durée von Konzepten seit der Renaissance zu untersuchen, drängt sich die Frage auf: Was ist Kunsttheorie und was sind künstlerische Konzepte?
Kunsttheorie der Vormoderne: Dialog der Konzepte zwischen Reflexion und Praxis
Die Kunsttheorie, im übergeordneten Sinne, betrachtet alle Formen der ästhetischen poiesis. Streng genommen umfasst sie alle Phasen und Aspekte der Produktion eines Kunstwerks. Theorie, in ihrem ursprünglichen Sinne Schau, Betrachtung von Ideen oder Sachverhalten und seit der Frühen Neuzeit ein komplexes, sprachliches Gebilde, dessen Aufgabe es ist, Phänomene und ihre wesentlichen Eigenschaften zu ordnen, wird in Bezug auf die bildende Kunst erst mit den expliziten kunstliterarischen Schriften des 15. und 16. Jahrhunderts formuliert, angefangen von Literaten wie Cennino Cennini und Lorenzo Ghiberti bis Leon Battista Alberti und Leonardo da Vinci. Es sind Schriften, die einen maßgeblichen Reflexionsraum für die bildende Kunst gründen und sie als Wissensgebiet festsetzen, dem eine spezifische Terminologie unterliegt. Gemeint sind Begriffe wie „Zeichnung“, „Erhebungen“, „Helldunkel“ oder „Figurenkomposition“ (disegno, rilievo, chiaro e scuro, historia), die unmittelbar aus der Kunsttätigkeit hervorkommend zu kunstimmanenten oder ästhetischen Konzepten ausgebaut werden, im Sinne von gedanklichen, abstrakten Synthesen und Erklärungen.5 Diese Konzepte, in denen die praktische künstlerische Erfahrung mit den Lehren der Rhetorik, Philosophie oder auch der Dichtung konvergieren,6 konstituieren die eigentliche, eigenständige Theorie der bildenden Kunst.
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts vollzieht sich ein entscheidender Schritt. Die Notwendigkeit der Kunsttheorie wird endgültig festgelegt, insbesondere mit den oben erwähnten Vorträgen Due Lezzioni von Benedetto Varchi, welche, gänzlich der bildenden Kunst gewidmet, zunächst ein Sonett Michelangelos über die Kunst behandeln und anschließend Debatten über arte im Allgemeinen, über den Unterschied zwischen Skulptur und Malerei (paragone-Debatte) und schließlich zwischen der Malerei und Dichtung führen:7 Auf der Grundlage des Diskurses – anknüpfend an die aristotelisch beeinflussten Lehren – über den menschlichen Intellekt und über die Beziehung zwischen scienza und arte8 stellt Varchi auf die Frage, was die Kunst sei,9 zusammenfassend fest, sie sei „ein Aggregat oder eine Ansammlung von mehreren Regeln und allgemeinen Anleitungen, die sich nach dem Nutzen oder der Nützlichkeit für den Menschen richten.“10 Jede Kunstart folge einem spezifischen Wissen und der Erfahrung, welche jeden Schritt der Entstehung eines Kunstwerks begleiten. Es heißt in Due Lezzioni, die Kunst, ergo: der künstlerische Akt, beginne stets bei dem Künstler, sei ein Prozess – geführt von der Geisteskraft und Mühe – und verfolge sein Ziel nach einer bestimmten Ordnung und Kausalität im Umgang mit dem entsprechenden Material.11 Dieser prinzipielle Verlauf eines künstlerischen Akts gibt demnach ein theoretisches Gerüst für die spezifischen Terminologien und Konzepte, die in den Lezzioni nicht nur das praktische, spezifische Wissen erfassen, sondern außerdem den Modus, die Qualität und die Bedeutung der jeweiligen künstlerischen Schritte erörtern: beginnend mit der Disposition des Künstlers sind es etwa die Konzepte des ingegno und der fatica, den Schaffensprozess erfassend wiederum disegno oder industria, und schließlich, ausgerichtet auf die Beschaffenheit sowie Qualität des Ergebnisses, welches die Ordnung und Kausalität der Ausführung spiegeln sollte, sind es die Konzepte der Naturnachahmung, des rilievo oder der Ausgewogenheit der einzelnen Teile des Werks oder etwa auch seine erhabene Erscheinung: magnificenza.12
In Due Lezzioni vollzieht sich außerdem ein weiterer entscheidender Schritt, denn Varchi stellt sein Gedankensystem zum einen den Künstlern zur Verfügung, zum anderen legt er das Wissen und die Reflexion über die Kunst gleichzeitig in ihre Kompetenz:13 Die Künstler sind die eigentlichen Instanzen der Kunsttheorie (allen vorangestellt Michelangelo); Varchi „erlaubt“ sich nur, als Philosoph „einige Überlegungen“ vorzulegen.14 Die Lezzioni stellen somit nicht nur ein umfassendes theoretisches System auf und fixieren dabei die Notwendigkeit der Kunsttheorie in ihrer Definition als Aggregat der Konzepte (sprich: Anleitungen und Regeln und der damit verbundenen erklärenden Diskurse), sondern legen vor allem die unabdingbare Verbindung zwischen Wissen, Reflexion und künstlerischer Tätigkeit fest.15 Die Kunsttheorie seit der Renaissance lässt sich demnach als ein Gehäuse aus kunstimmanenten und ästhetischen Konzepten erklären, das, dem Wissen und der Praxis der Künstlerin/des Künstlers entstammend, den künstlerischen Schaffensprozess nachzeichnet und ihm wiederum daraus Normen und Regeln vorlegt. Theorie bedeutet demnach, spezifisch in Bezug auf die bildende Kunst der Vormoderne, eine systematische Struktur des Wissens um die künstlerische Praxis zusammen mit der Reflexion über ihren Modus, Ziel und Zweck. Konzepte sind hingegen ihre Bestandteile, die sich mit einzelnen Aspekten des Kunstschaffens befassend das praktische Wissen und die Reflexion über die Kunsttätigkeit vereinen.16
Details
- Pages
- 154
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034346665
- ISBN (ePUB)
- 9783034346672
- ISBN (Softcover)
- 9783034341806
- DOI
- 10.3726/b20413
- Language
- German
- Publication date
- 2024 (January)
- Keywords
- Kunsttheorie Künstlertheorie Retrospektive Gegenwartskunst Konzeptuelle Kunst Künstlerische Konzepte Zeichnung und Disegno Kunstbetrieb
- Published
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2024. 154 S., 18 farb. Abb., 8 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG