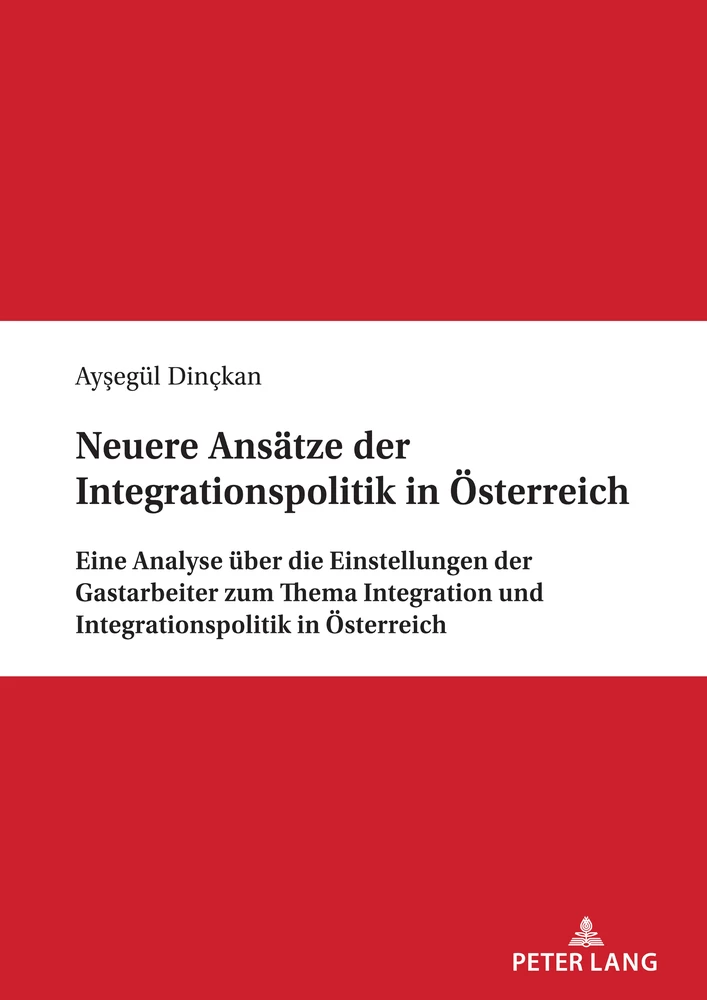Neuere Ansätze der Integrationspolitik in Österreich
Eine Analyse über die Einstellungen der Gastarbeiter zum Thema Integration und Integrationspolitik in Österreich
Summary
In diesem Werk erfolgt eine kritische Darstellung ausgehend von der Gastarbeiter-Anwerbung bis zur Einbettung der Integrationspolitik mit einem Tiefblick in die Institutionalisierungsphase. Darüber hinaus wird durch die Studie die Betrachtungsweise der Gastarbeiter über die integrationspolitischen Entwicklungen und das Integrationsbild von den nächsten Generationen der Gastarbeiterfamilien dargestellt, welche für manche Leser die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels anbieten wird.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- 1 Einführung
- 1.1 Forschungsleitende Fragen
- 1.2 Methode
- 1.2.1 Offene Befragung – Leitfadengestütztes Interview
- 1.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Migration, Integration, Assimilation und Segregation: Vorüberlegungen
- 2.1 Migration als Begriff
- 2.2 Integration als Begriff
- 2.3 Assimilation als Begriff
- 2.3.1 Assimilation nach Park und Burgess
- 2.3.2 Assimilation nach Esser
- 2.3.3 Assimilation nach Hoffmann-Nowotny
- 2.4 Segregation als Begriff
- 3 Integrationstheorien
- 3.1 Klassische Integrationstheorien
- 3.1.1 Robert E. Park/Ernest W. Burgess
- 3.1.2 Milton Gordon
- 3.1.3 Shmuel N. Eisenstadt
- 3.2 Klassiker der deutschen Integrationsforschung
- 3.2.1 Integrationstheorie von Hartmut Esser
- 3.2.2 Das Integrationsmodell von Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny
- 3.3 Moderne Integrationstheorien
- 3.3.1 Segmentierte Integration
- 3.3.2 Neoklassische Integration
- 3.3.3 Multikulturalismus
- 3.3.4 Transnationalismus
- 3.4 Feststellung der Indikatoren für eine erfolgreiche Integration
- 4 Einblick in die Migrationsgeschichte in Österreich
- 4.1 Migration von und nach Österreich
- 4.2 Beginn einer neuen Phase: Angeworbene Gastarbeiter
- 4.2.1 Wirtschaftliche Lage: Phase des Wiederaufbaus Österreichs
- 4.2.2 Rechtlicher Rahmen der Ausländerbeschäftigungspolitik
- 4.2.3 Die Gastarbeiter
- 4.2.4 Gastarbeiterkinder nach der Familienzusammenführung in Österreich
- 4.2.5 Gründe für den weiteren Verbleib in Österreich
- 4.2.6 Anwerbestopp und Rückkehr von Gastarbeitern
- 4.3 (Integrations-) Stand der Migranten als Gastarbeiter
- 4.3.1 Sprache/Muttersprache
- 4.3.2 Kontakt zur Aufnahmegesellschaft/Kontakt zur ethnischen Gesellschaft
- 4.3.3 Zugang zum Arbeitsmarkt
- 4.3.4 Bildung
- 4.3.5 Wohnsituation
- 4.3.6 Teilnahme an formellen und informellen Institutionen
- 4.4 Die Integrationsproblematik
- 4.5 Eine neue Zuwanderungswelle
- 5 Beginn einer „ernsthaften“ Integrationspolitik in Österreich
- 5.1 Beginn einer neuen politischen Debatte „Ausländerpolitik“
- 5.1.1 Fremdenpolizeigesetz 1987
- 5.1.2 Ausländerbeschäftigungsgesetz 1988/1990
- 5.1.3 Fremdengesetz und Aufenthaltsgesetz 1992
- 5.2 „Integration vor Neuzuwanderung“ - Fremdengesetz 1997
- 5.3 Die Einbürgerung als Endspurt des Integrationsprozesses - Staatsbürgerschaftsrecht 1999
- 5.4 Integrationsvereinbarung I - Fremdenrechtspaket 2002
- 5.5 Integrationsvereinbarung neu – Fremdenrechtspaket 2005
- 5.5.1 Fremdenpolizeigesetz 2005
- 5.5.2 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005
- 5.5.3 Ausländerbeschäftigungsgesetz 2005
- 5.5.4 Staatsbürgerschaftsgesetz 2005
- 5.6 Integrationsstand der Migranten seit der Wende der Integrationspolitik
- 5.6.1 Sprache/ Muttersprache
- 5.6.2 Zugang zum Arbeitsmarkt
- 5.6.3 Bildung
- 5.6.4 Wohnsituation
- 5.6.5 Kontakt zur Aufnahmegesellschaft/ Kontakt zur ethnischen Gesellschaft
- 5.6.6 Teilnahme an formellen und informellen Institutionen
- 6 Beginn der „institutionalisierten“ Integrationspolitik in Österreich
- 6.1 Integrationsplattform
- 6.2 Integrationsbericht 2008
- 6.3 Nationaler Aktionsplan für Integration
- 6.4 Fremdenrechts-Novelle 2009
- 6.5 Fremdenrechtspaket 2011
- 6.5.1 Deutsch vor Zuzug
- 6.5.2 Rot-Weiss-Rot-Karte – Kriterien-Punktesystem
- 6.5.3 Änderungen in der Integrationsvereinbarung
- 6.6 Staatssekretariat für Integration
- 6.6.1 Ziele der „Integration durch Leistung“
- 6.6.2 Schwerpunkte des Staatssekretariats für Integration
- 6.7 Bundesministerium für Integration
- 6.7.1 Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr
- 6.7.2 Islamgesetz 2015
- 6.7.3 Integration von Asylanten
- 6.8 Studie zum Integrationsstand der Gastarbeiter /-familien
- 6.8.1 Information über die Interviewpartner
- 6.8.2 Auswertung
- 6.8.3 Resümee der Studie
- 7 Schlussfolgerung
- 8 Quellen
- 8.1 Literatur
- 8.2 Internetquellen
- 9 Anhang
- 9.1 Interview 1
- 9.2 Interview 2
- 9.3 Interview 3
- 9.4 Interview 4
- 9.5 Interview 5
- 9.6 Interview 6
- 9.7 Interview 7
- 9.8 Interview 8
- 9.9 Interview 9
- 9.10 Interview 10
- 9.11 Interview 11
- 9.12 Interview 12
- Abstract in Deutsch
- Abstract in English
1 Einführung
Österreich war de facto immer schon ein Einwanderungsland. Jedoch war ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die zunehmende Arbeitsmigration hauptverantwortlich für die Erhöhung des Migrantenanteils. Als Österreichs Wirtschaft nach dem 2. Weltkrieg wieder zu wachsen begann, war Österreich, wie auch andere europäische Länder – zwar erst relativ spät – auch mit dem Arbeitskräftemangel konfrontiert, weshalb es nach 1962 in die internationale Anwerbepolitik eintrat. Nach Spanien wurden im Jahre 1964 mit der Türkei und im Jahre 1966 mit Jugoslawien ein Vertrag abgeschlossen, damit Gastarbeiter im Rotationsprinzip (d.h. der temporären Beschränkung auf ein Jahr) nach Österreich kommen1.
Den ersten Höhepunkt der „Gastarbeiterbeschäftigung“ mit 230.000 ausländischen Arbeitskräften erreichte man im Jahre 19732. Zwar konnte mit der Zeit festgestellt werden, dass das Rotationsprinzip aufgrund des wirtschaftlichen Interesses der Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer, übergangen wurde, jedoch blieb man bei diesem Zugang. Deshalb akzeptierte man in Österreich sehr lange Zeit nicht, ein Einwanderungsland zu sein und betrachtete daher auch eine Integrationspolitik nicht als notwendig.
Eine zweite Hochphase der Migration nach Österreich erlebte das Land zwischen den Jahren 1989-1993, wobei in dieser Zeit eine verstärkte Flüchtlingsmigration aus dem ehemaligen Jugoslawien herrschte3. Um die Zuwanderung zu reduzieren, wurde im Jahr 1991 das neue Asylgesetz und im Jahr 1992 das Fremden- und Aufenthaltsgesetz verabschiedet (siehe 5.1.2 und 5.1.3).
Erst nach dieser Phase wurde in Österreich das Problem der Integration angesprochen. Somit trat am 1. Jänner 1998 das erste Integrationspaket in Kraft (siehe 5.2.). Jedoch bekannte sich Österreich durch die ersten Institutionen ab 2007 (siehe 6.1.) und auf der Bundesebene durch die Errichtung des Staatssekretariats für Integration im Jahr 2011 dazu, ein Einwanderungsland zu sein, deshalb sei auch die Integrationspolitik notwendig4.
In Österreich befindet sich laut den aktuellsten Statistiken 14,6%5 ausländischer Anteil an der Bevölkerung, davon haben 12,5% eine ←13 | 14→Zuwandererbiographie6. Aus den Gastarbeiterfamilien, die sich seit den 60er Jahren in Österreich befinden, lebt bereits die dritte Generation in Österreich.
Laut den Statistiken gehören derzeit 43% der türkischen Migranten und 30% aus dem ehem. Jugoslawien (außerhalb der EU) der zweiten Generation an. Wenn man die Einbürgerung näher betrachtet, sind unter der ersten Generation bereits 31% und unter der zweiten Generation bereit 67% österreichische Staatsbürger.
1.1 Forschungsleitende Fragen
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet:
Wie ist die Sichtweise der Gastarbeiter, die bis 1976 kamen, über den Integrationszustand der unterschiedlichen Gastarbeiterfamiliengenerationen und über die Integrationspolitik in Österreich?
Aufbauend auf diese Frage müssen folgende weitere Fragen forschungsleitend beantwortet werden:
- Wie gut sind die Gastarbeiter, die gekommen sind und heute in Österreich leben, aus ihrer eigenen Sicht integriert?
- Wie hat sich das Verhalten der Gastarbeiter bezüglich „Integration“ auf die nächste Generation ausgewirkt?
- Wie ist der Integrationsprozess der Gastarbeitergenerationen in Österreich verlaufen?
- Welche integrationspolitischen Maßnahmen wurden in der Zeitfolge getroffen?
1.2 Methode
Neben der Literatur- und Medienrecherche wird für die Studie die Methode der offenen Befragung ausgewählt, deren Analyse nach der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring durchgeführt werden soll.
1.2.1 Offene Befragung – Leitfadengestütztes Interview
Bei der offenen Befragung handelt es sich um ein Gespräch zwischen zwei Personen über ein bestimmtes Thema, wobei der Interviewer dem Befragten die offenen Fragen ausgehend von einem Leitfaden stellt. Dabei reagiert der ←14 | 15→Interviewer auf den Gesprächsverlauf, durch das Weglassen von Fragen, die implizit beantwortet wurden oder durch das Aufgreifen neuer Aspekte, die sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Somit wird der Gesprächsverlauf vom Befragten bestimmt, wobei er die Fragen als Anhaltspunkt betrachtet, um seine Sichtweise darzustellen7.
Dabei wird der Befragte aufgrund der persönlichen Befragungssituation stärker als Person und nicht nur als Informationsquelle betrachtet, da er die Möglichkeit der Meinungsäußerung bekommt – ohne auf die vorgegebenen Kategorien festgelegt zu sein. Die Flexibilität des Interviewers und die Bestimmung des Gesprächsverlaufs durch den Befragten sind die wichtigsten Eigenschaften der Methode der offenen Befragung8Bei dieser offenen Befragung wird das Leitfadeninterview als Methode der qualitativen Datensammlung ausgesucht. Bei einem Leitfadeninterview werden vom Forscher die Themen zusammengestellt, die während der Befragung unbedingt besprochen werden sollen. Jedoch kann es variieren, wie sehr die Fragen ins Detail gehen9.
1.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse
Die qualitative Inhaltsanalyse hat das Ziel, Texte – in diesem Fall die transkribierten Interviews – systematisch zu analysieren. Dabei wird streng methodisch kontrolliert und das Material schrittweise analysiert. Deshalb wird das Material in Einheiten zerlegt, wobei ein entwickeltes Kategoriensystem im Zentrum steht. Das Kategoriensystem bestimmt diejenigen Aspekte, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen10.
Dabei sind die Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Die Zusammenfassung ist ein Abbild des Grundmaterials, so dass der wesentliche Inhalt erhalten bleibt. Diese inhaltsanalytische Zusammenfassung dient der induktiven Kategorienbildung. Dabei müssen innerhalb der Logik der Inhaltsanalyse die Kategorisierungsdimension und das Abstraktionsniveau definiert und ein Selektionskriterium für die Kategorienbildung festgelegt werden. Durch Finden von passenden Textstellen werden Kategorien konstruiert und weitere passende Textstellen werden dieser Kategorie zugeordnet. Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu spezifischen Textstellen, die der Auswertung dienen soll.11
←15 | 16→Bei der Explikation wird vorher definiert, wo nach geeignetem Zusatzmaterial gesucht wird, um weniger verständliche Stellen zu explizieren. Diese Suche soll systematisiert werden12.
Die Strukturierung der qualitativen Inhaltsanalyse hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern, wie formale, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen. Wichtig ist, dass das Kategoriensystem so genau strukturiert definiert wird, dass eine eindeutige Zuordnung von Textstellen zu Kategorien immer möglich ist13.
Bei der Auswertung der leitfadengestützten Interviews wird der transkribierte Text somit zu einer Kategorienbildung, aber auch systematisch strukturiert. Damit geht einher, dass der Text einer Untergliederung ausgesetzt ist und gleichzeitig die Strukturen deutlich gemacht werden, die sich in dieser Arbeit auch in anderen Teilen wiederfinden werden. Somit soll es möglich werden, dass die Analyse der Interviews in gründlicher und detaillierter Form stattfindet.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit widmet sich im Kapitel zwei den essentiellen Begriffen der Arbeit: Migration, Integration, Assimilation und Segregation. Somit soll auch die Problematik der Begriffsdefinition überwunden werden.
Im dritten Kapitel widmet sich die Arbeit den Integrationstheorien. Dabei werden alle klassischen Integrationstheorien, mitunter die deutschsprachigen und die modernen Integrationstheorien, diskutiert. Aus den diskutierten Theorien werden die bedeutendsten Indikatoren für eine erfolgreiche Integration abgeleitet, so dass die Arbeit im empirischen Teil auf diesen Indikatoren basieren wird.
Das vierte Kapitel gibt einen tieferen Einblick in die Migrationsgeschichte Österreichs. Dabei wird die Gastarbeiterphase genauer unter die Lupe genommen und anschließend wird der Stand der Migranten als Gastarbeiter auf Basis der festgelegten Indikatoren diskutiert.
Die ersten gesetzlichen Maßnahmen und die daraus folgenden Auswirkungen bzw. der Integrationsstand der Migranten in der Phase bis zum Beginn der „institutionalisierten“ Integrationspolitik wird in Kapitel fünf dargestellt.
Im letzten Kapitel vor der Schlussfolgerung werden die einzelnen Schritte der „institutionalisierten“ Integrationspolitik im Detail besprochen, darunter die ←16 | 17→Einrichtung des Staatssekretariats für Integration, der Nationale Aktionsplan für Integration und die Handlungsfelder. Darüber hinaus befindet sich in diesem Kapitel die Studie über die Integration der Gastarbeitergenerationen. Diese stellt die im Zuge der Forschung durchgeführten Interviews sowie die Analyse, Interpretation und die daraus zu ziehenden Erkenntnisse dar.
In der Schlussfolgerung sollen die Ergebnisse in einem Überblick zusammenfassend dargestellt und alle forschungsleitenden Fragen beantwortet werden.
←17 | 18→1 Hahn, 2016, S. 32
2 Fassmann & Münz, 1996, S. 216
3 Lebhart & Münz, 1999, S. 9
4 Fassmann & Dahlvik, 2012, S. 160
5 migration & integration. zahlen.daten.indikatoren 2016, 2016, S. 22
6 migration & integration. zahlen.daten.indikatoren 2016, 2016, S. 23
7 Behnke, Baur, & Behnke, 2012, S. 244
8 Behnke, Baur, & Behnke, 2012, S. 244f.
9 Behnke, Baur, & Behnke, 2012, S. 248
10 Mayring, 2002, S. 114
11 Mayring, 2002, S. 115ff.
12 Mayring, 2002, S. 117
13 Mayring, 2002, S. 118
2 Migration, Integration, Assimilation und Segregation: Vorüberlegungen
Wenn das Thema Migration behandelt wird, finden neben Migration oft verschiedene Begriffe Anwendung. In diesem Kapitel sollen diese Begriffe behandelt, besprochen bzw. diskutiert werden.
2.1 Migration als Begriff
Im Rahmen der Migrationsanalyse wurde von verschiedenen Theoretikern versucht, den Begriff Migration, lateinisch migratio = (Aus)wanderung14 näher zu definieren. Obwohl sie hinsichtlich der „Bewegung oder Wanderung von bestimmten Gruppen…15“ sich einig sind, geht das Endergebnis der Definitionserklärung doch in verschiedene Richtungen. Denn es werden verschiedene Aspekte der Migration miteinbezogen.
So hat Rudolf Heberle Migration definiert als…
„… jeden Wechsel des Wohnsitzes, und zwar des de facto-Wohnsitzes, einerlei ob freiwillig oder unfreiwillig, dauernd oder vorübergehend. Dagegen werden „Umzüge“ innerhalb derselben Gemeinde nicht als Wanderung angesehen, auch nicht das Reisen, denn der Reisende beabsichtigt an seinen alten Wohnort zurückzukehren, während der Wandernde einen neuen Wohnsitz sucht. Die gewohnheitsmäßigen Wanderarbeiter wie auch die Landstreicher, die wandern, weil sie nicht arbeiten mögen, werden in unseren Begriff eingeschlossen. Dagegen nicht die sogenannte „Pendelwanderung“, die vielmehr als ein Ersatz für echte Wanderung angesehen werden muss.16“
Everett S. Lee erklärt Migration wie folgt:
“Wanderung ist allgemein definiert als ein permanenter oder semi-permanenter Wechsel des Wohnsitzes. Dabei soll keine Einschränkung in Bezug auf die Entfernung des Umzugs oder auf die freiwillige oder unfreiwillige Art der Handlung, kein Unterschied zwischen externer und interner Wanderung gemacht werden. Daher wird der Umzug über das Treppenhaus von einer Wohnung zur anderen genauso sehr als Akt der Wanderung gezählt wie ein Umzug von Bombay in Indien nach Cedar Rapids in Iowa… Jedoch nicht alle Arten der räumlichen Mobilität sind in diese Definition eingeschlossen. Ausgeschlossen sind z.B. die ←19 | 20→kontinuierlichen Bewegungen von Nomaden und Wanderarbeitern, die keinen dauernden Wohnsitz haben, und zeitweilige Umzüge, wie die in die Berge für die Sommerzeit.17“
Für Elias/Scotson spielt bei der Definition von Migration…
„…der Wechsel der Gruppenzugehörigkeit“ eine Rolle. „Was geschieht, scheint… nur zu sein, dass Menschen sich physisch von einem Ort zum anderen bewegen. In Wirklichkeit wechseln sie immer von einer Gesellschaftsgruppe in eine andere über“18.
Albrecht definiert die Migration als…
„…die Ausführung einer räumlichen Bewegung, die einen vorübergehenden oder permanenten Wechsel des Wohnsitzes bedingt, eine Veränderung der Position also im physischen und im sozialen Raum“19.
Für Schrader spielt bei der Definition die Entfernung eine Rolle:
Details
- Pages
- 282
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631894262
- ISBN (ePUB)
- 9783631894279
- ISBN (Softcover)
- 9783631892091
- DOI
- 10.3726/b20447
- Language
- German
- Publication date
- 2023 (February)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 282 S., 5 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG