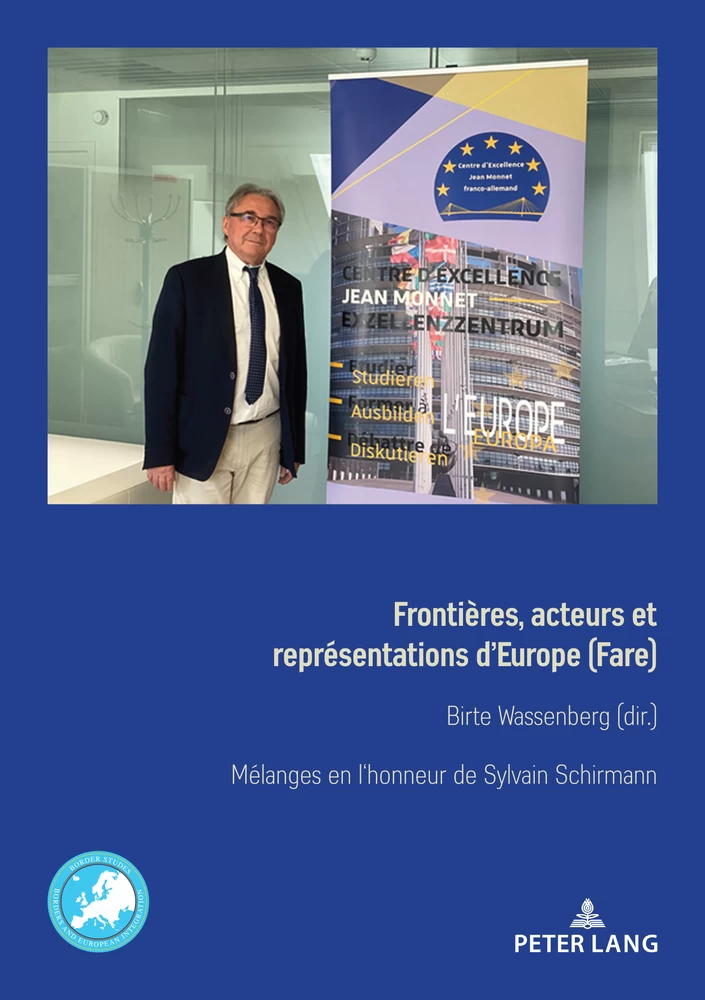Frontières, acteurs et représentations d’Europe (Fare) Grenzen, Akteure und Repräsentationen Europas
Mélanges en honneur de Sylvain Schirmann Festschrift für Sylvain Schirmann
Summary
thèmes : les frontières, les acteurs et les représentations de l’Europe (Fare). Avec un clin
d’oeil à l’ancien laboratoire Fare des historiens des Relations Internationales à Strasbourg,
il est dédié à Sylvain Schirmann, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Strasbourg et ancien directeur de Sciences Po Strasbourg. A l’occasion de son départ à
la retraite, il rend aussi hommage à sa fonction de directeur du Centre d’excellence Jean
Monnet franco-allemand (2018-2022). Ses collègues se penchent, chacun(e) à sa manière,
en français ou en allemand, sur les enjeux qui ont été au coeur de ses recherches et
celles du Centre d’excellence : les acteurs économiques dans la construction européenne,
les relations franco-allemandes, la coopération transfrontalière... Leurs contributions
constituent à la fois un témoignage de la reconnaissance et de l’affection de leurs auteurs
envers Sylvain Schirmann et la confirmation de sa capacité de fédérer des chercheurs
venant de différents pays européens et disciplines scientifiques.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières/Inhaltsverzeichnis
- Préface (Michel Deneken)
- Kurzeinleitung (Birte Wassenberg)
- Introduction (Birte Wassenberg)
- Partie 1 Frontières : conflits et coopérations
- Teil 1 Grenzen: Konflikte und Kooperationen
- L’architecture des frontières dans l’Union européenne au travers des lunettes du juriste (Frédérique Berrod)
- Libre circulation, frontières et migrations en Europe. L’espace Schengen (1985–2010) (Michel Catala)
- Genèse et gestion des conflits frontaliers. Morceaux choisis (Anne Klébes-Pellissier)
- Frontières et sacré. Crises et nouveaux récits (Jean Peyrony)
- Les espaces transfrontaliers à l’épreuve de la gestion de la pandémie. Le cas de de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (Hansjörg Drewello, Jean-Alain Héraud & Emmanuel Muller)
- Le processus de paix au Proche-Orient. Entre Charybde et Scylla (Alexis Vahlas)
- L’histoire des jumelages en Europe. L’invention d’une diplomatie par en bas (Corine Defrance)
- Pour une grille de lecture « réaliste » dans l’approche historique de la coopération transfrontalière sur le Rhin supérieur (Martial Libera)
- Dépasser les frontières et populariser le projet européen. Le sport, passeur d’Europe ? (William Gasparini)
- Vers une histoire de la frontière pyrénéenne. Des traités de lies et passeries à la coopération transfrontalière (Martine Camiade)
- La frontière franco-belge. Batailles, patrimoines et Europe (Fabienne Leloup)
- Partie 2 Acteurs
- Teil 2 Akteure
- La France et le financement de l’économie sarroise de 1945 à 1959. Ampleur et limites d’une volonté réformatrice (Jean-François Eck)
- Le ministère Bouchardeau dans l‘arène européenne. Arracher un compromis entre résistance interne et pressions externes (1983–1985) (Laurent Warlouzet)
- Trente ans d’ENA à Strasbourg (1991–2021) (Fabrice Larat)
- Quand la dynamique européenne vient buter sur une frontière institutionnelle. Jacques Delors et le traité de Maastricht (Éric Bussière)
- L’implication de la Roumanie dans le processus d’adhésion européenne de la Moldavie. Une analyse des discours du président Klaus Iohannis (2014–2019) (Antoanela-Paula Mureșan)
- La Roumanie entre les deux guerres mondiales. Le début du processus de modernisation et d’européanisation de l’économie (Nicolae Păun)
- Der Aachener Vertrag und die deutsch-französische Kooperation in der Klima- und Energiepolitik (Christine Aquatias & Clara Eichinger)
- Rééducation an der Universität Mainz. Die Studentenzeitschrift „Die Burse“ 1947/1948 (Michael Kiβener)
- Partie 3 Représentations de l’Europe
- Teil 3 Repräsentationen von Europa
- „Europa ohne Grenzen“. Mythus oder Realität? Eine historische Analyse (Birte Wassenberg)
- Mémoire et stratégie : Au cœur de la guerre des sièges onusiens Vienne, une capitale oubliée de l’Europe ? (Laurence Badel)
- L’Europe vue dans et par les territoires transfrontaliers. Entre mémoires et représentations, une problématique des espaces-frontières (Philippe Hamman)
- Une nouvelle « Déclaration du 9 mai ». Un exercice de fiction politique (Michel Mangenot)
- Grenzregionen als Europäische Integrationsräume? Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive (Joachim Beck)
- Was hat das Meer mit Europa zu tun? Essay über einen neuen Zugang zur Geschichte unseres Kontinents (Jürgen Elvert)
- Liste des auteurs
- Autorenliste
- Titres de la collection
Préface
Le cinéphile qu’est Sylvain Schirmann aura peut-être vu un film réalisé par le cinéaste finlandais Lauri Törhönen 2007, Raja 1918 (La frontière 1918) basé sur l’histoire vraie du père de son producteur. Il se passe à la fin de la guerre civile finlandaise au printemps 1918, et met en scène un jeune scientifique, capitaine appelé sous les drapeaux de la Finlande enfin indépendante. Carl von Munck est envoyé dans la petite ville de Rajajoki, afin de délimiter et de fermer la frontière entre la Finlande et la Russie devenue bolchévique. Il y tombe amoureux d’une institutrice, secrètement fiancée à un révolutionnaire de l’Armée rouge, nouant ainsi dans les fibres les plus intimes de sa vie le drame inhérent à toute frontière. C’est qu’une frontière naît de la guerre. Alors que le village est inondé de réfugiés des purges russes, von Munck doit décider qui sera autorisé ou non à entrer en Finlande, jeune terre de liberté. Autant de cas particuliers, autant de dilemmes et de drames. L’histoire de Raja 1918 se termine tragiquement, séparant, dans la spirale des logiques tribales, éternels Montaigu et Capulet, familles et amis par une frontière qui sera un rideau de fer séparant l’Est de l’Ouest.
Car les histoires de frontières, si elles inspirent des programmes de recherche, sont avant tout des histoires humaines. Sylvain Schirmann, par naissance et conviction, est un homme des frontières. Si notre lieu de naissance détermine de manière d’abord géographique nos vocations professionnelles et humaines, le destin académique de celui que ce très riche volume de mélanges honore l’illustre parfaitement. Ainsi, s’il a fini par s’intéresser aussi à l’histoire de l’intégration européenne, c’est en quelque sorte par élargissement de son lieu natif, marqué par la rencontre des cultures, entre Lorraine, Alsace, Sarre et Rhénanie-Palatinat. Puis, regardant par-delà les frontières jusqu’à s’intéresser à la partie plus orientale de l’Europe, il irrigue ses recherches et son enseignement de la sève puisée profond et large de ses racines par définition transfrontalières. Et, de ce fait, aussi, transdisciplinaires. Autant de lieux qui appellent ←11 | 12→à méditer sur ce qu’est une frontière, tantôt nécessaire, tantôt superflue mais toujours présente. Déclare-t-on une frontière levée ? Voilà qu’elle se referme à la première crise migratoire venue. La dit-on superflue ? Voilà qu’une pandémie fait se lever un pont-levis sur le Rhin.
Les contributions que ce volume réunit honorent la dimension pluridisciplinaire aussi revendiquée qu’avérée de Sylvain Schirmann, historien, politiste, sociologue… Professeur d’histoire des relations internationales contemporaines à l’Université de Strasbourg il a été directeur de l’Institut d’études politiques de Strasbourg. Il obtient une chaire Jean Monnet-Histoire de la construction européenne et devient directeur du centre d’excellence Jean-Monnet. Membre du Groupe de liaison des Professeurs d’Histoire contemporaine auprès de la Commission européenne, président du Comité scientifique de la Maison de Robert Schuman : autant de titres auxquels ce volume rend hommage de manière polyphonique. Ses recherches dans les domaines des relations franco-allemandes ou de la politique extérieure de l’Allemagne ou encore sur les milieux socio-économiques et l’organisation de l’Europe au XXe siècle ou sur les organisations internationales au XXe siècle révèlent un chercheur qui ne se met pas de frontières. Il allait alors de soi que les auteurs des contributions de ce volume de mélanges célèbrent Sylvain Schirmann par-delà les frontières nationales et disciplinaires.
Sylvain Schirmann est un Européen avant tout. Non de cette espèce désincarnée de l’Européen de caricature. Il s’enracine dans l’histoire concrète de l’Europe sans a priori ni préjugé. Il incarne cette manière d’être européen qui répond à la définition d’Edgar Morin : « L’Europe est une notion incertaine, naissant du tohu-bohu, aux frontières vagues, à géométrie variable, subissant des glissements, ruptures, métamorphoses1. »
Dans ce volume Sylvain Schirmann est honoré par des articles originaux en signe de profonde gratitude tant il a enrichi intellectuellement l’Université de Strasbourg. Une université sur la frontière, sur le Rhin qui procède de la tension féconde entre France et Allemagne au cœur de l’Europe. Les trois mouvements de cette polyphonie composée par des enseignants-chercheurs de toutes disciplines sous la direction de Birte Wassenberg offrent au lecteur une dynamique par-delà les frontières. Le premier mouvement donne le ton en faisant entendre cette dialectique ←12 | 13→particulière de la frontière source de conflits et de coopération. Le deuxième mouvement donne la voix aux acteurs pour montrer que les volontés politiques font exister les frontières soit comme ponts vers l’autre, soit comme rideau abaissé sur la liberté de rencontrer. Le dernier mouvement, consacré aux représentations, offre une ouverture comme autant d’invitations à la réflexion sur ce qu’est l’Europe. Cette construction est un vrai projet puisqu’il pose la question de la frontière en termes aussi politiques que philosophiques. En quoi les auteurs font œuvre utile et nécessaire en ces temps troublés de frontières violées et d’acteurs qui font de l’histoire un mensonge.
Finalement, l’ouvrage fait apparaître en filigrane le portrait de celui qui y est fêté et remercié : Sylvain Schirmann comme un homme formé par « l’identité de frontière »2. Claudio Magris est cet auteur lié à Trieste et au Danube, deux lieux mouvants qui interrogent et l’appartenance à un pays et au continent Européen. Il désigne la frontière comme une « terre de personne », un entre-deux comme la Trieste de son enfance. Or « parfois, cette terre de personne, cet entre-deux, peut-elle être une bonne demeure »3. La demeure de Sylvain Schirmann ? Enraciné dans l’Est de la France, au cœur de l’Europe. Fidèle serviteur de l’université, chercheur exigent et pédagogue exceptionnel. La frontière comme oxymore fondateur d’une Europe plus que jamais nécessaire. Merci Sylvain Schirmann de nous avoir mis aux postes frontières de la réflexion dont les barrières ne pourront jamais être fermées.
Kurzeinleitung
Birte Wassenberg
Die Europäische Union ist lange als gelungenes Modell einer integrierten regionalen Organisation gelobt worden. Seit 2008 hat jedoch die Krisensituation in Europa – Wirtschafts- und Finanzkrise, Terrorismus, Migration, Covid-19 Pandemie- dieses Image stark beschädigt. Die Rückkehr von Grenzkontrollen in der EU, die Reflexe von Protektionismus, der Anstieg neuer nationalistischer Bewegungen und des Euroskeptizismus sind viele Anzeichen dafür, dass die Europäische Idee stagniert. Aber anstatt sich über den Integrationsprozess Gedanken zu machen, beobachtet man ein neues Narrativ der Europäischen Desintegration, deren erstes Vorzeigebeispiel der Brexit sei.
Dieser Sammelband schlägt stattdessen vor, die Europäische Idee unter drei Gesichtspunkten neu zu überdenken: Grenzen, Akteure und Repräsentationen von Europa (Fare). Die Auswahl dieser drei Schwerpunktthemen für die Festschrift zu Ehren von unserem Kollegen Sylvain Schirmann anlässlich seiner Emeritierung ist kein Zufall. Sie stellt ein Augenzwinkern zum ehemaligen Forschungsinstitut Fare der Historiker Zeitgenössischer Internationaler Beziehungen in Strasbourg dar, das er in der Traditionslinie der französischen Schule der Historiker Internationaler Beziehungen initiiert hat und das 2009 von den zeitgenössischen Historikern des Europainstitutes (IHEE) der Universität Strasbourg gegründet wurde. Das Institut wurde zwar 2014 in die UMR Dynamiques européennes integriert, der Name blieb jedoch über die dem Institut angeschlossenen Zeitschrift Fare erhalten, die weitergeführt wird und deren 21. Ausgabe im Jahr 2021 gerade erst erschien.
Wir haben diese drei Schwerpunktthemen auch ausgewählt, weil sie sowohl die Hauptforschungsthemen von Sylvain Schirmann als auch die des Deutsch-französischen Jean Monnet Exzellenz-Zentrums darstellen, das er 2018 von der Europäischen Kommission erhalten hat und das 2022 ausläuft. Grenzen, Akteure und Repräsentationen von Europa bildeten in der Tat eine Art Grundorientierungslinie in der beruflichen ←15 | 16→Karriere von Sylvain Schirmann, sowohl was seine Lehre und Forschung betrifft, als auch seine Zielsetzungen als Direktor von Sciences Po Strasbourg von 2016 bis 2015.
Der Begriff, der diese drei Schwerpunktthemen zusammenbringt ist Europa und Sylvain Schirmann ist eng damit verbunden. Als Doktorand von Raymond Poidevin gehört er zu den Anhängern der französischen Schule der Geschichte Internationaler Beziehungen, die von Pierre Renouvin und Jean-Baptiste Duroselle in den 1960ger Jahren gegründet und danach von René Girault und Raymond Poidevin in den 1970ger und 1980ger Jahren weitergeführt wurde. Sein Interesse für die Geschichte der Europäischen Einigung zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere: Nach Marie-Thérèse Bitsch war er einer der ersten Professoren an der Universität Strasbourg, die einen Jean Monnet Lehrstuhl von der Europäischen Kommission erhalten haben und seit 2008 ist er außerdem Gastprofessor des Europakollegs in Brügge und Natolin. Seine führenden Funktionen im Bereich von Forschung und Ämter im öffentlichen Interesse sind zahlreich: so leitet er seit 2004 den wissenschaftlichen Rat des Robert Schuman Hauses und seit 2010 den des Lieu d’Europe in Strasbourg. Von 2000 bis 2004 war er Direktor des Forschungszentrums für Geschichte und Zivilisation Westeuropas an der Universität Metz und wurde 2009 Mitglied der Liaisons-Gruppe zeitgenössischer Historiker bei der Europäischen Kommission. Er hat außerdem Herausgabeverantwortung für den Bereich Geschichte der Europäischen Integration übernommen, zunächst, von 2006 bis 2015, als Publikationsleiter der Zeitschrift Études européennes und danach als Mitgründer und -Herausgeber, zusammen mit Jürgen Elvert, der Kollektion Études sur l’Histoire de l’intégration européenne – Studien zur europäischen Integrationsgeschichte beim Franz Steiner Verlag in Stuttgart. Drei Referenzwerke von Sylvain Schirmann sind im Rahmen der Europastudien besonders hervorzuheben : ein erstes über die Zwischenkriegsperiode1 und zwei weitere, eines über die Europäische Architektur (Quelles architectures pour quelle Europe)2 und das andere, interdisziplinäre, das ←16 | 17→er mit seinem Politikwissenschaftskollegen Michel Mangenot über die EU Institutionen herausgegeben hat (Les institutions européennes font leur histoire)3.
Insbesondere har er jedoch als Direktor des Politikwissenschaftsinstituts in Strasbourg (IEP) die Europastudien gestärkt, innerhalb der filière für Europäische und Internationale Studien, durch die Schaffung neuer Programme und Lehrveranstaltungen zur EU und durch die Integration des Europainstituts (IHEE) ins IEP. Wenn Strasbourg heute als eine der besten Sciences Po Schulen für Europastudien gilt, so ist dies vor allem dem intensiven Bemühen, der Expertise und dem savoir-faire von Sylvain Schirmann zu verdanken.
Die „Grenzen“ sind schon Teil der Forschung von Sylvain Schirmann, als er die Nachbarschaftsbeziehungen Frankreichs behandelt. Zunächst sind es die Deutsch-Französischen Beziehungen, die seine Aufmerksamkeit erregen, z.B., während eines von Raymond Poidevin und Franz Knipping geleiteten Forschungsprogramms zu den Deutsch-Französischen Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert, von 1989 bis 1991, oder danach, im Rahmen eines Historikerseminars über Deutsch-Französische Wirtschaftsbeziehungen von 1981 bis 2004, das vom Deutschen historischen Institut und dem Ausschuss für die Wirtschafts- und Finanzgeschichte Frankreichs organisiert wurde. Diese Beziehungen werden auch in seinen Publikationen behandelt, z.B. im cahier Fare n° 7 im Jahr 2014 über das deutsch-französische Paar (Le couple franco-allemand vu par certains États tiers)4 oder in seinem Artikel über die deutsch-französische Versöhnung im Jahr 20165. Von 2010 bis 2014, untersuchte Sylvain Schirmann auch die Nachbarschaftsbeziehungen Frankreichs mit Deutschland und den Benelux-Staaten in einem Forschungsprogramm zu den „lieben Nachbarn“ (Ces chers voisins), zusammen mit seinen beiden Freunden und Kollegen Eric Bussière und ←17 | 18→Michel Dumoulin – das „infernale Trio“, wie er sie selbst bezeichnet6. Aber sein Interesse für Grenzen wurde ihm auch von seinen Kollegen zugetragen und ich bin hier selbst die Hauptverantwortliche. Als ich 2009 als junge Juniorprofessorin beim IHEE anfing, mit einer Doktorarbeit über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein, hat Sylvain Schirmann nicht gezögert, dieses Thema, von dessen innovativem Charakter er für die Europawissenschaften überzeugt war, zu unterstützen. So erinnere ich mich gut daran, als er mich in sein Direktorenbüro im IEP Strasbourg gerufen hatte, um mir ein Budget für ein mehrjähriges Forschungsprogramm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa anzuvertrauen. Er hatte sich nicht geirrt: in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Joachim Beck aus den Verwaltungswissenschaften hat diese Unterstützung zu einer Reihe von sechs Sammelbänden zum Thema Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleben und erforschen geführt, die von 2009 bis 2014 veröffentlicht wurden7.
Sein Engagement für die Forschung über Grenzen wurde im Rahmen des Deutsch-Französischen Jean Monnet Exzellenzzentrums bestätigt, das Sylvain Schirmann 2018 von der Europäischen Kommission erhalten hat, denn das ausgewählte Thema war: die Grenze erleben. Das Projekt umfasste drei Bereiche von Aktivitäten: Bildung, Forschung und Verbreitung in der Zivilbevölkerung und jeder davon war auf einen Schwerpunkt „Grenze“ ausgerichtet. So war im Bereich der Bildung die Einrichtung eines trinationalen Bachelors zu Grenzüberschreitenden Europastudien zwischen den Universitäten Basel, Freiburg und Strasbourg vorgesehen. Im Bereich der Forschung behandelten sechs Seminare auf unterschiedlichste Weise das Thema Grenzen, bezogen auf die sozialen und wirtschaftlichen Akteure, den grenzüberschreitenden Sport, die Governance, den Deutsch-Französische Aachener Vertrag, die Sicherheit an Grenzen… Schließlich programmierte das Zentrum für die Verbreitung in Kooperation mit dem Odyssee Kino eine Reihe von Filmen und Dokumentationen über Grenzen und während des jährlichen Geopolitik-Festivals und bei Webinaren wurden viele Grenz- Themen ←18 | 19→und Konflikte behandelt, wie z.B. der Brexit, Grenzschließungen währen der Covid-19 Pandemie oder der Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
Das Schwerpunktthema „Akteure“ findet sich ebenfalls im Herzen der vorrangigen Forschungen von Sylvain Schirmann wieder. Sein Interesse gilt vor allem zwei Arten von Akteuren: erstens, den öffentlichen Akteuren und deren Rolle in den internationalen Beziehungen – Staaten, politische Persönlichkeiten, aber auch Europäische und internationale Organisationen- und zweitens, den Wirtschaftsakteuren und deren Rolle in der Europäischen Integration. Es sind demnach sowohl die öffentlichen wie die privaten Akteure, die seine Aufmerksamkeit wecken. In der ersten Kategorie findet sich vor allem Deutschland im Zentrum seiner Forschungsarbeiten sowie einer der Gründungsväter Europas, Robert Schuman, aber auch allgemein Europäische und internationale Organisationen wie der Völkerbund, die Europäische Gemeinschaft oder die zentrale Rheinschifffahrtskommission. Seine Prioritäten spiegeln sich auch in seinen verschiedenen Funktionen und Affiliationen wieder, denn er leitete z.B. die 2. Achse zu den Akteuren der Europäischen Integration der Forschungseinheit Fare und war mitverantwortlich für ein Forschungsprogramm der Maison interuniversitaire de Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) zu Deutschland in Europa oder auch Mitglied des Verwaltungsrates des Forschungsverbundes (GIS) „Mondes germaniques (Deutschsprachige Länder)“. Außerdem war er von 2008 bis 2014 Herausgabedirektor und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitschrift Revue d’Allemagne et des pays de langue germanique.
Was die erste Kategorie der staatlichen Akteure betrifft, hat sich Sylvain Schirmann seit seiner Doktorarbeit zu den Deutsch-Französischen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen von 1932 bis 1939 immer wieder der Rolle Deutschlands in den Internationalen Beziehungen gewidmet, wie z.B. in einer Publikation, die er zusammen mit Jürgen Elvert 2008 herausgab oder in einem Dossier der Revue d’Allemagne im Jahr 2015, von denen beide das Thema Deutschland in Europa behandelten8. Erst kürzlich, im Jahr 2021, hat er zwei Herausgaben der Zeitschrift Relations ←19 | 20→Internationales zur Außenpolitik Deutschlands nach der Wende veröffentlicht9. Im Bezug auf die Schlüsselpersonen der Europäischen Integration hat er dank seiner Funktion im Schuman Haus in Scy-Chazelles in Lothringen noch unerforschte persönliche Archive Robert Schumans erforschen können und im Jahre 2008 dann ein Buch zur politischen Kultur und den Bildungsjahren des Europäischen Gründungsvaters veröffentlicht10. Und im Bezug auf Europäische und internationale Organisationen hat Sylvain Schirmann nicht nur die Geschichte des Völkerbundes, die der Europäischen Kommission und die des ersten gewählten Europaparlamentes erforscht, sondern er hat auch zusammen mit Martial Libera die Geschichte einer weniger beachteten internationalen Organisation geschrieben, deren Sitz sich in Strasbourg befindet: die Zentrale Rheinschifffahrtskommission11.
In der zweiten Kategorie sind es die Wirtschaftskreise – Firmen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände- denen seine Forschung gewidmet ist. So hat er im Jahr 2006 zusammen mit Eric Bussière und Michel Dumoulin die Wirtschaftsakteure und deren Rolle in der Europäischen Integration im 20. Jahrhundert behandelt12 und im Jahr 2014 einen Sammelband zur Wirtschaftsintegration und Europäischen Governance veröffentlicht13. In demselben Jahr veröffentlicht sind auch zwei seiner Artikel zu den Gewerkschaften und der Schaffung eines sozialen Europas und zu den französischen Gewerkschaften und der Europäischen Integration zu unterstreichen14. Im Allgemeinen verfolgt Sylvain ←20 | 21→Schirmann eine Angehensweise zu den Akteuren der Internationalen Beziehungen, die ich als „realistisch“ bezeichnen würde. Er ist überzeugt davon, dass es die Interessen der Akteure sind, die zählen und dass es das Zusammenspiel dieser Interessen ist, die den Kurs der Geschichte der Europäischen Einigung bestimmen.
Es ist dieser Realismus, der auch seine Forschungsarbeiten zum dritten Schwerpunktthema bestimmt, den Repräsentationen von Europa. Es ist daher nicht eine konstruktivistische Vision, die annimmt, dass man sich Stück für Stück zu einem föderalistischen Ideal der Europäischen Integration entwickelt, die er verteidigt. Von dieser Vision, die bei vielen Forschern der Europastudien vorherrscht, die wie auch ich Idealisten der Europäischen Idee sind, ist er nicht überzeugt, da sie einen teleologischen Ansatz zur Europäischen Integration verfolgt. Auf einen theoretischen Rahmen zur Europäischen Idee übertragen könnte man Sylvain Schirmanns Ansatz eher als funktionalistische Schule der Europäischen Integration bezeichnen – der auch Robert Schuman angehörte – allerdings ohne dabei das finale Ziel einer EU-Föderation zu integrieren.
Dieser Ansatz hat Sylvain Schirmann nicht darin gehindert, zu einem der Pioniere der französischen Historiker Internationaler Beziehungen zu gehören, die über die Repräsentationen Europas geforscht haben. So wurde er 2008 Mitglied des Netzwerkes „Europäische Identitäten“ der UMR-IRICE Paris I–Paris IV, in dem er zusammen mit Michel Dumoulin und Eric Bussière eine Forschungsachse zu Wirtschaft und der Europäischen Integration geleitet hat. Aber er betrachtet die Repräsentationen Europas auch aus der Perspektive der Memorialstudien, denn er wurde 2013 Mitglied des Wissenschaftsrates vom Memorial Elsass-Moselle. Es war auch der Moment, an dem er eine Forschungsprojekt zur Enthaltung, dem Euroskeptizismus und dem Anti-Europäismus bei den Europawahlen seit 1979 initiiert hat15. Sein realistischer Ansatz zur Europäischen Integration ermöglichte es ihm, den Blickwinkel auf die EU zu ändern und nicht nur die Fortschritte der Europapolitik und die Vertiefung der Integration zu berücksichtigen, sondern auch die Krisen, Rückschritte ←21 | 22→und sogar die Desintegration. Er betont immer, dass es zahlreiche Repräsentationen von Europa gibt, die sich nicht nur auf die EU oder auf ihr Integrationsmodell beschränken. Der Alter-Europäismus ist ihm zufolge omnipräsent in der Geschichte der Europäischen Integration, und zwar von Beginn an, wie es die vielen Diskussionen über die Europäische Idee in der Zwischenkriegszeit zeigen.
Aber Sylvain Schirmann ist nicht unempfänglich für den Europäismus. Im Jahr 2019, in einer Studie zur Geschichte des ersten gewählten Europaparlaments von 1979 bis 1989, hat er sich der politischen Kultur und den Repräsentationen von Europa der Europaparlamentarier gewidmet. Im Bezug aus die Eröffnungsrede von Louise Weiss bei der ersten Europaparlamentssitzung am 17 Juli 1919 widersteht auch er nicht ihrem idealistischen Humanismus und ihrem Appel für eine gemeinsame Europäische Identität, die auf die Grundwerte des Rechts, der Demokratie und der Menschenrechte basiert. Aber dies ist weder inkompatibel mit seinem realistischen oder (post-)funktionalistischen Ansatz der Europäischen Integration noch mit seiner internationalistischen Vision. Denn insgesamt bleibt die Europäische Integration für Sylvain Schirmann ein Teil der Geschichte der internationalen Beziehungen und die EU bleibt eine regionale Organisation unter vielen, die sich in der globalen Architektur internationaler Organisationen in der Welt eingliedert. Seine Devise ist also die Verflechtung von Europa- und internationalen Studien, wie er es selbst ausdrückt: „Europa bedeutet internationale Beziehungen und internationale Beziehungen bedeutet Europa“.
In dieser Festschrift zu Ehren von Sylvain Schirmann widmen sich seine Kollegen und Freunde, jede(r) auf seine Weise, auf Deutsch oder auf Französisch, einem dieser drei Schwerpunkthemen, die im Mittelpunkt seiner Forschung und der des Deutsch-Französischen Jean Monnet Exzellenzzentrums standen: Grenzen, Akteure und Repräsentationen Europas. Im ersten Teil über Konflikte und Kooperationen an Grenzen behandelt Frédérique Berrod zunächst die Architektur der Grenzen der EU aus der juristischen Perspektive, während Michel Catala die Entwicklung des Schengener Abkommens nachzeichnet. Anschließend untersuchen Anne Klebes-Pélisser, Jean Peyrony, Hansjörg Drewello, Jean-Alain Héraud, Emmanuel Muller und Alexis Vahlas verschiedene Arten und Formen von Grenzkonflikten in Europa und in der Welt: die Genese und das Management von border disputes, Krisen und Grenzziehungen in Europa, die Covid-19 Pandemie und der Friedensprozess im Nahen Osten sind alles Themen, die die Vielfalt und Diversität von ←22 | 23→Grenzkonflikten illustrieren. Im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, schlagen die Autoren ebenfalls unterschiedliche Perspektiven vor: die von Corine Defrance über die Städtepartnerschaften in Europa, die von Martial Libera über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein, die von William Gasparini über den grenzüberschreitenden Sport in Europa, die von Martine Camiade über die Geschichte der Pyrenäengrenze, oder die von Fabienne Leloup zu Konflikten, Kulturerbe und Europa an der französisch-belgischen Grenze.
Im zweiten Teil des Sammelbandes über die Akteure widmen sich zunächst mehrere Autoren den französischen Staatsakteuren. So erforscht Jean-François Eck Frankreich und die Finanzierung der Saarwirtschaft von 1945 bis 1959, Laurent Warlouzet schreibt über das Ministerium von Bouchardeau und die Europäische Regulierung der Automobilumweltverschmutzung, Fabrice Larat bietet ein Panorama zu Dreißig Jahren der ENA in Strasbourg und Eric Bussière untersucht die Rolle von Jacques Delors bei der Erarbeitung des Maastrichter Vertrages. Zwei Artikel beziehen sich danach auf Rumänien, der eine von Antonela-Paula Mureşan über den Beitrag von Rumänien zum Europäischen Beitrittsverfahren von Moldawien und der andere von Nicolae Păun über das Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen und die Anfänge der Modernisierung und Europeanisierung der rumänischen Wirtschaft. Schließlich behandeln zwei Artikel Deutschland und die Deutsch-Französischen Beziehungen: Christine Aquatias und Clara Eichinger analysieren den Aachener Vertrag unter dem Blickwinkel der Klima- und Energiepolitik und Michael Kißener widmet sich einem deutschen öffentlichen Akteur, der Universität Mainz und der Rolle der Studentenzeitschrift „Die Burse“ 1947/1948.
Im dritten Teil über die Repräsentationen Europas, untersuchen die Autoren unterschiedliche Visionen zur Europäischen Integration, zur Europäischen Erinnerungskultur und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Nach einer kritischen Evaluierung des Ideals eines „Europa ohne Grenzen“ von Birte Wassenberg, widmen sich Laurence Badel und Philippe Hamman aus unterschiedlicher Perspektive den Fragen der Europäischen Erinnerungskultur: die der Stadt Wien als (vergessene) Hauptstadt Europas und die der Grenzgebiete und ihrer Repräsentationen von Europa. Ein origineller Beitrag ist der von Michel Mangenot, der eine fiktive Neuschreibung der „Deklaration vom 9. Mai“ anbietet, während Joachim Beck die Repräsentation von Grenzregionen als Modellräume Europäischer Integration behandelt. Zuletzt schließt ←23 | 24→der Beitrag von Jürgen Elvert diesen Sammelband ab, der die Frage zur Rolle des Meeres bei der Repräsentation von Europa stellt: „Was hat das Meer mit Europa zu tun?“.
Details
- Pages
- 544
- Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9782807619609
- ISBN (ePUB)
- 9782807619616
- ISBN (Softcover)
- 9782807619593
- DOI
- 10.3726/b20108
- Language
- French
- Publication date
- 2022 (October)
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 544 p., 8 tabl.