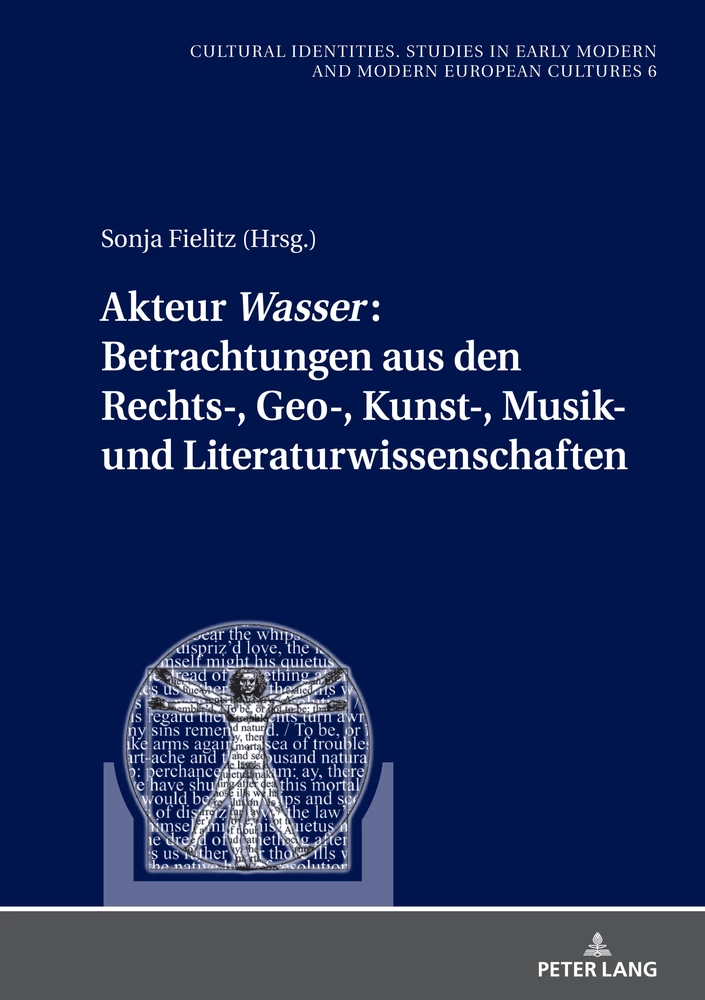Akteur «Wasser»: Betrachtungen aus den Rechts-, Geo-, Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaften
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Vorwort der Herausgeberin (Sonja Fielitz)
- Verzeichnis der Beiträgerinnen und Beiträger
- Global
- Wem gehören eigentlich die Wasserflächen auf der Erde? (Gilbert Gornig)
- Fluss / Innengewässer
- „Woge, du Welle, walle zur Wiege!“ Zur Bedeutung des Wassers für Richard Wagners ‚Kunstwerk der Zukunft‘ (Hartmut Schick)
- Water Patriotism in 18th Century Scottish Highland Literature on the example of James Macpherson’s Ossianic Collections (Aileen-Laura Schäfer)
- “Domains of the cold-blooded” – The Function of Wetlands in Daisy Johnson’s FEN and Hope Dickson Leach’s The Levelling (Evelyn Koch)
- Meer
- In-Between the Elements: Water Matters and Metaphors in Joseph Conrad’s Sea Writing (Nora Pleßke)
- Das unbeirrt bewegte Meer. Ein Ort der Emotionen in den Bildwelten des 17. bis zum 19. Jahrhundert (Pablo Schneider)
- Ästhetik und Allegorie: Brunnen und Bäder
- Der Sound der fontane: Kompositionen über römische Brunnen (Magdalena Zorn)
- Erkundungen über Wasser und Erde in der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Beobachtungen zu den regionalen Anfängen der Geowissenschaften (Friedrich Frhr. Waitz von Eschen)
- Die Göttin Diana und das Wasser (Eva-Bettina Krems)
- Barockes Wasser: Der Garten als Bühne für ein flüchtiges Element (Stephanie Hanke)
- Der Tag, die Nacht und der Tau. Zur Metaphorik der Herrscher-Regeneration im Badhaus der Sommerresidenz Schwetzingen (Astrid Zenkert)
- (Öffentliche) Brunnen in Karlsruhe – zwischen Repräsentation und Daseinsvorsorge (Nina Rind)
- Reihenübersicht
Sonja Fielitz
Vorwort der Herausgeberin
„Das Prinzip aller Dinge ist Wasser“ – diese Feststellung des Tales von Milet gilt seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bis heute unverändert: Wasser ist die Grundvoraussetzung für jedes organische Leben auf der Erde. Im kritischen Bewusstsein der Wissenschaft ist die essentielle Bedeutung von Wasser spätestens seit den 1970er Jahren angekommen, und die Disziplinen der Rechts-, Geo-, Klima-, Land-, Forst- und Energiewirtschaft haben längst das öffentliche Bewusstsein geschaffen, dass es eine der großen Herausforderungen der Zukunft sein wird, die Verteilung von Wasser zwischen den Extremen von Dürreperioden und Überschwemmungen weltweit zu sichern. So wird auch der vorliegende Band eröffnet mit einem global ausgerichteten Beitrag des Rechtswissenschaftlers Gilbert Gornig, der die Frage stellt, wem eigentlich die Wasserflächen auf der Erde gehören.1
Jenseits der oben genannten Disziplinen ist das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser freilich noch deutlich ausbaufähig. Wie der vorliegende Band zeigt, kann Wasser auch in den Geisteswissenschaften auf vielfältige Weise signifikant sein, da es als ebenso faszinierende wie vielfältige Projektionsfläche für unterschiedlichste Anliegen in Kunst, Literatur, Architektur, Musik, Religion und Geschichte dienen kann. Das Motiv Wasser hat von jeher die bildende Kunst inspiriert, und auch die Musik hat sich seit Jahrhunderten prominent der Repräsentation von Wasser angenommen. Auch in der Gartenarchitektur spielt es (unter anderem in der Diskussion um „art versus nature“) eine wichtige Rolle. In der Literatur fasziniert Wasser in Schauspielen wie beispielsweise William Shakespeares The Tempest, Sagen, Mythen und Märchen wie „Das Wasser des Lebens“ der Gebrüder Grimm oder Seefahrer-Romanen wie Herman Melvilles Moby Dick bis hin zu deutschen Gedichten wie Goethes „Gesang der Geister über den Wassern,“ in all denen Meere, Flüsse und/oder Seen eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus ist die reinigende Kraft des Wassers Teil vieler Religionen, wenn etwa im Christentum die Taufe durch das Übergießen mit Wasser ←7 | 8→vollzogen wird. Der Islam kennt die rituelle Gebetswaschung vor dem Betreten einer Moschee, der Glaube der Hindus umfasst ein rituelles Bad im Fluss Ganges. Nicht zuletzt sollen hier auch andere (historische) Nutzungsformen des Wassers nicht unerwähnt bleiben, sei es als Transportbasis für kulturelle Artefakte wie Flöße, Boote und Schiffe, als ‚Betreiber‘ von Mühlen, oder als Wirtschaftsfaktor für Kur- und Badeorte.
Der Ansatz
Vor diesem Hintergrund der globalen Signifikanz und Ubiquität von Wasser nehmen die Beiträge in diesem Band aus den Disziplinen der Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft, Geowissenschaft und Kunstgeschichte die oben skizzierten Phänomene in den Blick, wobei sie nicht lediglich eine Motivgeschichte des Wassers vorlegen. Vielmehr eint diese der Ansatz, Wasser als ein mit vielfältigen kulturellen Bedeutungen aufgeladenes Phänomen zu verstehen, was im Folgenden zu erläutern sein wird.
Grundlegend charakteristisch für Wasser ist seine materielle Wandelbarkeit,2 und dies bereits in seinen Aggregatszuständen wie Dampf, Regen, Schnee, Eis, oder auch Tau, der den Übergang der Nacht zum Tag signalisiert. Wasser ist einerseits Lebensquell für Menschen, Tiere und Pflanzen auf unserem Planeten, kann aber andererseits bei Übermaß auch deren Tod und Vernichtung herbeiführen. Es stürzt (als Wasserfall oder Kaskade) über Felsen und überwindet dabei kraftvoll bis zerstörerisch Hindernisse, die ihm im Weg sind.
Die Transparenz und Reflexion von Wasser birgt ästhetisches Potential. Eine ruhige Wasseroberfläche kann Dinge reflektieren, oder in (rhythmischer) Bewegung auch verzerren oder sogar zerstören. In Bewegung tropft, fließt oder strömt Wasser, und dies mit variabler Intensität, Frequenz und Rhythmus. In diesem Kontext interpretiert hier Magdalena Zorn die musikalische Sprache der Kunstbrunnen in Rom, indem sie diese zu bekannten Kompositionen in Bezug setzt.
Physikalisch kann sich Wasser mit anderen flüssigen Stoffen ‚vereinen‘, d.h., mischen, oder kann diese umgekehrt ‚verwässern‘ und eignet sich somit in vielerlei Hinsicht dazu, Grenz- und Übergangsräume zu markieren. So zeigt Aileen-Laura Schäfer aus Sicht der Literaturwissenschaft, dass Wasser als Element der Natur alles durchdringt, auch zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Bereichen fließt und somit als Mittler zwischen Mensch und Natur ←8 | 9→fungieren kann; ein Aspekt, dem sich auch Nora Pleßke widmet. Sie untersucht die Darstellung des Meeres in ausgewählten Romanen und Kurzgeschichten von Joseph Conrad und zeigt auf, dass die Fluidität und Nicht-Fixierbarkeit von Wasser besonders geeignet ist, um Grenzbereiche von literarischer und metaphorischer Verwendung in literarischen Texten zu verdeutlichen. Wasser als Schwellenelement sieht auch Evelyn Koch mit Bezug auf sogenannte Fenlands, also von Wasseradern durchzogenen Moorlandschaften in England. Sie untersucht deren mediale Repräsentation in einer Sammlung von Kurzgeschichten und einer filmischen Umsetzung aus dem 21. Jahrhundert, in denen sich Natur, Kultur und menschliche Imagination treffen. Wie sie entwickelt, eignet sich Wasser aufgrund seines hybriden Status in der Literatur besonders dazu, um Transformationsprozesse zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Existenzen, aber auch in menschlichen (Identitäts)Krisen zu situieren.
Wie Stephanie Hanke und Eva-Bettina Krems aus der Kunstgeschichte, und auch Aileen-Laura Schäfer aus der Literaturwissenschaft zeigen, kann Wasser die Rolle eines zentralen Protagonisten (wie in einer Theaterinszenierung) einnehmen, sei es als Kaskade in Reggia di Caserta (Krems), in der Gartenarchitektur des Barock (Hanke) oder in der schottischen Dichtung des 18. Jahrhunderts (Schäfer). Wasser kann dabei nicht nur eine visuelle, sondern auch eine soziale Rolle zukommen, wenn es soziale und/oder geographische Abgrenzung markiert. So kann es etwa auch die programmatische Rhetorik eines Herrschers verdichten, wie Astrid Zenkert in ihrem Beitrag darlegt. Wie eine Brücke, Schleuse oder Membran ermöglicht Wasser, dass beispielsweise in einer herrschaftlichen Badanlage ‚Mensch‘ und ‚Amt‘ eines Herrschers nicht mehr als voneinander getrennt inszeniert werden. Programmatik kann sich freilich nicht nur in sozialer Hinsicht über Wasser kommunizieren, sondern auch in werkimmanenter Weise. So zeigt Hartmut Schick anhand von Richard Wagners Rheingold auf, wie Wasser der ideale programmatische Träger für Wagners ‚Kunstwerk der Zukunft‘ ist.
Die Funktion einer sozialen Schwelle oder Brücke greift Nina Rind in ihrem Beitrag auf, in dem sie sich der wandelnden Verwendung von Wasser zwischen Repräsentation und Daseinsfürsorge der öffentlichen Brunnen in Karlsruhe widmet.
Rezipienten können Wasser visuell, akustisch, haptisch und gegebenenfalls auch olfaktorisch erfahren; Wasser spricht also unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und -empfindungen des Menschen an – was sich wiederum in den Künsten widerspiegelt. Wie Pablo Schneider in seinem Beitrag entwickelt, hat etwa das Meer als ständig bewegtes Element (u.a. Ebbe und Flut) die visuelle Macht, die Betrachtenden in der Kunst emotional zu bewegen und sogar deren Denken und Handeln zu ←9 | 10→verändern. Auch aus dieser Perspektive erweist sich Wasser erneut als Akteur (siehe oben).
Wasser braucht freilich, zumindest in flüssigem Zustand, auch immer einen Rahmen, also ein Behältnis wie ein Rohr, eine Badewanne, ein größeres Bad (siehe den Beitrag von Astrid Zenkert), ein Flussbett, eine gestaltete Kaskade (siehe den Beitrag von Friedrich Frhr. Waitz von Eschen), eine Skulptur oder einen Brunnen (siehe die Beiträge von Stephanie Hanke und Eva-Bettina Krems), mit dem es wiederum in einen künstlerischen und ästhetischen Dialog tritt. Insgesamt ist Wasser also ein höchst wandelbarer Akteur, der sich selbst und seine Umgebung in geradezu unbegrenzter Vielfalt verändern und beeinflussen kann.
Wie alle Beiträge in diesem Band zeigen, ist es aufgrund von vernetzten Erkenntnisinteressen und Perspektiven zum Thema Wasser aus unterschiedlichen Fachdisziplinen möglich, ein ebenso differenziertes wie facettenreiches Bild der Repräsentation und Bedeutung von Wasser auf ganz verschiedenen Gebieten der Wissenschaften zu entwerfen. Das Zusammenspiel derer ermöglicht eine Weitung des Blicks über den üblichen Rahmen einer jeweiligen Disziplin hinaus, mag somit neue Perspektiven in der geisteswissenschaftlichen Betrachtung von Wasser eröffnen und ist nicht zuletzt geeignet, eine neue Sicht auf Wasser auch in den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu werfen.
*
Etwa die Hälfte der hier repräsentierten Beiträge geht zurück auf eine (Corona-bedingt online durchgeführte) Tagung zum Thema „Wasser: Kunst – Geschichte – Literatur,“ die am 2. und 3. Juli 2021 in einer Zusammenarbeit der Universität Marburg, vertreten durch Prof. Dr. Sonja Fielitz, und der Museumslandschaft Hessen Kassel (mhk), vertreten durch deren Direktor, Prof. Dr. Martin Eberle, stattfand. Die Tagung war gekoppelt mit der Ausstellung der mhk zum Thema „Kassel… mit allen Wassern gewaschen!“ (16.5. – 12.9.2021), welche sich auf fünf verschiedene Ausstellungen an fünf Standorten mit der lebensspendenden Kraft dieses Elements beschäftigte und auch auf seine symbolische Bedeutung in Geschichte und Kultur einging. „Badende in der Kunst!“ wurden im Teil „WasserLust“ im Schloss Wilhelmshöhe gezeigt; der „Mythos Wasser in Antike und Gegenwart!“ wurde im Teil „WasserGeister“ in der Neuen Galerie in den Blick genommen. Die vielfältigen Nutzungsarten des Wassers waren Thema der Ausstellung „WasserMeister… Bierkrug, Biber, Badehose!“ im Hessischen Landesmuseum. Rituale des Waschens und Badens am landgräflichen und später kurfürstlichen Hof Kassel waren Gegenstand von „WasserScheu… Fürsten gehen baden!“ im Westpavillon der Orangerie. Und nicht zuletzt war Wasser als ←10 | 11→gestalterisches Element in der Gartenkunst Gegenstand von „WasserPracht… in Gold getaucht!“ in Schloss Wilhelmsthal. Dieser Teil der Ausstellung fokussierte sich auf die Geschichte und Bedeutung der 28 vergoldeten Figuren aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der künstlich angelegten Grotte im Park von Schloss Wilhelmsthal.
Die wissenschaftliche Tagung kontextualisierte, vernetzte und vertiefte einzelne Aspekte dieser großen Ausstellung. Die institutionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen der Philipps-Universität Marburg und der Museumslandschaft Hessen Kassel schuf so eine Gelegenheit, Repräsentationen des Wassers in Kunst, Geschichte, Literatur, Musik und Architektur sowohl durch das gesprochene Wort wie auch die materielle Präsenz aufzuzeigen und ermöglichte damit eine breite und diversifizierte Kontextualisierung des Phänomens Wasser für ganz unterschiedliche Rezipientengruppen.
Danksagung
Mein Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Martin Eberle, sowie Herrn Dr. Justus Lange und Frau Dr. Antje Scherner von der mhk für die stets harmonische, fokussierte und produktive Zusammenarbeit im Prozess der Planung der Tagung, sowie während deren Verlauf. Wertvolle Unterstützung im Vorfeld leistete auch Frau Natascha Callebaut, und große Verdienste um die technisch reibungslose Abwicklung während der Tagung erwarb sich Herr Siamak Chad Bakht. Frau Malena Rotter und Frau Xenia Schürmann unterstützten den/die Sektionsvorsitzende/n (Chair) ebenso unermüdlich wie engagiert. Allen möchte ich für ihre Mühen herzlich danken. Für die Erstellung des vorliegenden Bandes danke ich Frau Ingrid Knauf von der mhk für die freundliche Genehmigung von insgesamt drei Abbildungsrechten der Museumslandschaft Hessen Kassel, sowie Herrn Dr. Justus Lange für seine stets prompte und hilfsbereite Unterstützung bei meinen Rückfragen zur Ausstellung.
Für das Zustandekommen des vorliegenden Bandes gilt mein Dank insbesondere Herrn Dr. Michael Rücker vom Verlag Peter Lang, der dieses Projekt ebenso engagiert wie kompetent und freundlich begleitete. Meiner studentischen Hilfskraft Hanna Schulte verdanke ich wertvolle Recherchearbeiten, und meine Kolleginnen Victoria Gath und Aoife Holmes-Rein entlasteten mich dankenswerterweise in der letzten Phase meiner redaktionellen Arbeit maßgeblich, indem sie mir Zeit verschafften. Ihnen möchte ich sehr herzlich danken.
Widmen möchte ich diesen Band Rosie.
Details
- Pages
- 264
- Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631879160
- ISBN (ePUB)
- 9783631879177
- ISBN (Hardcover)
- 9783631870914
- DOI
- 10.3726/b19875
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (September)
- Keywords
- Gemälde Brunnen Literatur Gartenarchitektur Komposition
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 264 S., 52 s/w Abb.