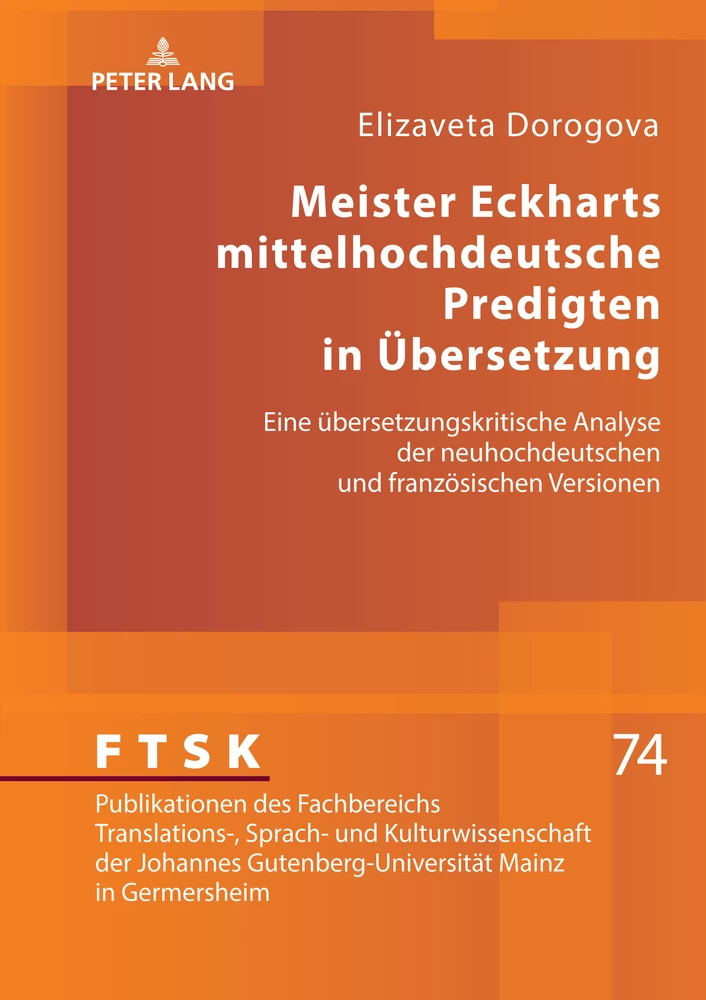Meister Eckharts mittelhochdeutsche Predigten in Übersetzung
Eine übersetzungskritische Analyse der neuhochdeutschen und französischen Versionen
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Gegenstandsspezifische Problematik
- 1.1. Ausgewählte Fragen der Philosophie-Übersetzung
- 1.2. Interpersonale Übersetzung
- 1.3. Meister Eckhart verstehen
- 1.4. Übersetzungsethos und Verantwortung der Texte
- 1.5. Zweisprachigkeit in Meister Eckharts Predigten
- 2. Methode der Übersetzungskritik nach Antoine Berman
- 2.1. Darstellung der Methode: Strukturelle Aspekte
- 2.2. Kritik und Eingrenzung der Methode Bermans
- 2.3. Rezeption Bermans durch Paul Ricœur
- 2.4. Zwischenfazit. Übersetzungskritischer Standpunkt
- 3. Übersetzer und Übersetzungen
- 3.1. Gustav Landauer
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.2. Herman Büttner
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.3. Friedrich Schulze-Maizier
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.4. Josef Quint
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.5. Dietmar Mieth
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.6. Louise Gnädinger
- Die Übersetzerin
- Die Übersetzung
- 3.7. Uta Störmer-Caysa
- Die Übersetzerin
- Die Übersetzung
- 3.8. Edward Viesel
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.9. Paul Petit
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.10. Gwendoline Jarczyk und Pierre-Jean Labarrière
- Die Übersetzer
- Gwendoline Jarczyk
- Pierre-Jean Labarrière
- Die Übersetzung
- 3.11. Reiner Schürmann
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.12. Alain de Libera
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 3.13. Jeanne Ancelet-Hustache und Eric Mangin
- Die Übersetzerin
- Der Übersetzer
- Die Übersetzung
- 4. Übersetzungskritische Analysen
- 4.1. Predigt 9
- Analyse der Übersetzung der Predigt 9
- 4.2. Predigt 2
- 4.3. Ein Fallbeispiel: die Präposition durch
- Die Präposition durch in den Bibelkommentaren
- Die Präposition durch in Eckharts Kommentar zum Johannesevangelium
- 5. Übersetzung und Edition
- 5.1. Pfeiffers Beitrag
- 5.2. Probleme der Authentizität
- 5.3. Das Problem des Originals
- 6. Ausgewählte Fragen der Intertextualität
- 6.1. Liber XXIV philosophorum – Eckhart und Hermetismus?
- 1. Übereinstimmungen
- 2. Kontrafaktische Intertextualität
- 3. Stilistisch-bildliche Gemeinsamkeiten
- 6.2. Metatextualität
- 6.3. Über die retrospektive Intertextualität
- 7. Schlussbetrachtungen
- 7.1. Rückblick auf die Übersetzungsanalysen
- Deutsche Übersetzungen
- Französische Übersetzungen
- 7.2. Allgemeine Schlussbetrachtungen
- Übersetzungsunterschiede
- Edition als Übersetzung
- Verantwortung der Texte, Verantwortung der Übersetzer
- Übersetzungsagnostizismus, Unübersetzbarkeit und Übersetzbarkeit als „religiöse“ Kategorien
- 8. Literaturverzeichnis
- 8.1. Verwendete Eckhart-Editionen
- 8.2. Verwendete Eckhart-Übersetzungen
- 8.3. Sekundärliteratur
- 8.4. Internetquellen
- Reihenübersicht
Einleitung
In the introduction, the objectives and subject matter of this book are presented. The corpus of editions and translations is described. The most important lines of research and questions are being traced. Apart from it, some theoretical questions are discussed. The theoretical premises of the work are being introduced to the reader as well.
Schlagworte: Ubersetzungskorpus, Rezeption Ubersetzungskritik, Ubersetzungsvergleich Methodologie, Ubersetzungswissenschaft als Disziplin, .
Obwohl Eckhart im 13. Jahrhundert geboren wurde, erfreuen sich seine Texte weltweit auch heute eines nicht nachlassenden Interesses. Der Erforschung seiner Theologie,2 aber auch seines Stils und seiner Sprache3 sind zahlreiche Veröffentlichungen gewidmet. Aussagen zur Übersetzung von seinen Texten finden sich jedoch fast ausschließlich in den von Übersetzern seiner Texte verfassten Einführungen zu Ausgaben seiner Werke. Eine übersetzungswissenschaftliche Rezeption bleibt bisher aus. In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit eine Lücke schließen.
Sie befasst sich mit den sinn- und inhaltsbezogenen Problemen, die sich aus der übersetzungskritischen Betrachtung der mittelhochdeutschen Predigten Meister Eckharts und ihrer modernen deutschen und französischen Übersetzungen ergeben. Es werden auch editionsphilologische Facetten herangezogen. Besondere Beachtung erfährt auch die Intertextualität-Problematik.
Es werden zwölf Übersetzungen analysiert, sieben deutsche: Gustav Landauer (1903), Herman Büttner (1912), Friedrich Schulze-Maizier (1927), Josef Quint (1955), Dietmar Mieth (1986), Louise Gnädinger (1999), Uta Störmer-Caysa (2010), Edward Viesel (online), und fünf französische: Paul Petit (1942), Jarczyk / Labarrière (1988), Ancelet-Hustache / Mangin (2015), Reiner Schürmann (2005), Alain de Libera (1995 [1993]). Die ←13 | 14→ Übersetzungen von Mieth, Viesel und Schürmann werden nur im Fall von Predigt 2 hinzugezogen, da sie für Predigt 9 nicht vorliegen. (Vgl. hierzu Kap. 8.2.)
Drei Editionen werden verwendet: von Josef Quint (1958), Franz Pfeiffer (1845–1857) und Franz Jostes (1895). (Vgl. hierzu Kap. 8.1.)
Im Folgenden wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit vorgestellt.
Im einführenden Kapitel wird auf solche Elemente wie Ziel und Gegenstand der Arbeit, Methodik, Original- bzw. Übersetzungskorpus eingegangen. Zu guter Letzt wird ein knapper chronologischer Überblick über Eckharts Übersetzungen in Frankreich und Deutschland geboten.
Im ersten Kapitel werden Fragen der philosophischen Übersetzung (u. a. auch im Kontext der Sprachenpaare) erörtert. Es wird das Konzept der interpersonalen Übersetzung eingeführt. Außerdem werden hermeneutische Probleme beleuchtet, die für die Predigten Meister Eckharts spezifisch sind.
Im zweiten Kapitel wird der methodische Rahmen der Übersetzungskritik in dieser Arbeit, nach dem Ansatz von Antoine Berman, abgesteckt und zugleich kritisch eingegrenzt.
Das dritte Kapitel, das bereits zum Kernteil der Arbeit gehört, ist den pragmatischen Faktoren gewidmet, die die analysierten Übersetzungen mitbestimmen. So werden u. a. solche Aspekte wie Bild des Autors, Selbstbild der Übersetzung, Rezeption der Fremdübersetzungen, Ziel der Übersetzung und das Interpretations- und Übersetzungsethos der Übersetzer beleuchtet. Außerdem werden solche Punkte wie Biografien der Übersetzer, ihre Weltanschauung und der geistesgeschichtliche Hintergrund, sprachphilosophische Einstellungen, Übersetzungsstrategien und -methoden behandelt. Zum Schluss wird das Bild des Adressaten beleuchtet sowie der kritische Apparat diskutiert.
Das vierte Kapitel ist den Übersetzungsanalysen gewidmet.
Das fünfte Kapitel ist der Editionsproblematik im Kontext der Eckhart-Übersetzung gewidmet. So werden Pfeiffers Beitrag, die Problematik der Authentizität, das Konzept des Originals und verschiedene editionsphilologische Faktoren ins Blickfeld gerückt.
Im sechsten Kapitel wird die Intertextualitätsproblematik untersucht. Das Kapitel umfasst unterschiedliche Fragestellungen aus dem Bereich Übersetzung und Intertextualität. So werden exemplarisch Eckharts hermetische Hypotexte hypothetisch postuliert. Außerdem wird das Augenmerk auf die Kategorie der Metatextualität gerichtet. Es wird das Konzept der retrospektiven Intertextualität eingeführt und ein Versuch der theoretischen Verortung unternommen.
Im siebten Kapitel werden Schlussfolgerungen, sowohl zu den einzelnen Übersetzungen als auch insgesamt gezogen.←14 | 15→
Da es in dieser Arbeit gegenstandsbedingt zur Vermischung von Sekundär- und Primärliteratur kommt (Einleitungen und Kommentare der Übersetzer werden (auch) als Primärliteratur gehandhabt), entsteht eine relativ hohe Zitatlastigkeit, die jedoch in Anbetracht der hohen Anzahl an Übersetzungen und den methodischen bzw. genrespezifischen Voraussetzungen (Übersetzungskritik) die Autorin für unumgänglich erachtet, wenn dem Leser ein fairer intersubjektiver Zugang zu den Gedankengängen dieser Arbeit ermöglicht werden soll. Es wäre natürlich auch der Weg denkbar, zur Ermittlung der weltanschaulichen Situierung der Übersetzerinnen und Übersetzer werkimmanent zu arbeiten und sich hauptsächlich darauf zu stützen, was sich aus den Übersetzungstexten selbst erschließen lässt. Dies würde jedoch einer Grundüberzeugung dieser Arbeit widersprechen – der Prämisse der Übersetzbarkeit und der These, dass viele Übersetzungsprobleme nicht auf der Ebene der Übersetzung liegen, sondern vielmehr auf Edition oder etwa Intertextualität zurückzuführen sind.
Antoine Bermans Ansatz stellt, in Anbetracht der Tatsache, dass er Raum für punktuelle Betrachtung problematischer Stellen bietet, ohne dabei eine chronologische Vorgehensweise erforderlich zu machen, einen besonders vorteilhaften methodischen Rahmen für die vorliegende Arbeit dar. Außerdem präsentiert dieser Ansatz ein harmonisches Zusammenspiel zwischen den Elementen der Übersetzungsanalyse und -kritik. Dabei spielen der Kontext der Entstehung der Übersetzung sowie die Bedingungen, unter denen der Übersetzer arbeitete, eine gewichtige Rolle für Kritik und Bewertung der Übersetzung.4
Auch Jeremy Munday auf die Bedeutsamkeit der Bedingungen aufmerksam, unter denen die Übersetzer arbeiten, für den Übersetzungsprozess und stellt die noch nicht ausreichende Beachtung heraus, die diesen seitens der Übersetzungswissenschaft geschenkt wird.5 Die vorliegende Arbeit will u. A. diese Lücke füllen.
Der Übersetzungskritiker muss dabei von einer zu stark wertenden Herangehensweise Abstand halten und die Vorstellung von einer einzig wahren Übersetzung meiden.6
←15 | 16→Man muss sich als Übersetzer, und natürlich auch als Übersetzungskritiker, der deutschen Predigten Eckharts stets die Frage stellen: Spricht Eckhart hier als Muttersprachler des Mittelhochdeutschen zu seinen „Mit-Muttersprachlern“, soll heißen, zu weiteren Mitgliedern seiner Sprachgemeinschaft, oder spricht er hier als Theologe, als Philosoph, als Rezipient komplexer, weit in die Vergangenheit zurückreichender Traditionen, wie etwa der apophatischen, mit ihren eigenen termini technici, und dann auch als Glied in einer geschichtlichen Kette, das, ohne die Verbindung nun zu kausal machen zu wollen, auf Jahrzehnte volkssprachlicher Mystik folgt?
Nun fragt sich: Welche Voraussetzungen sollte der ideale Eckhart-Übersetzer mitbringen? Wenn man sich als Germanist an den idiomatischen Besonderheiten des Mittelhochdeutschen orientiert, läuft man Gefahr, zum einen Eckharts idiolektische Besonderheiten auszublenden, zum anderen den theologischen Kontext zu vernachlässigen.
Hier ließe sich fragen: Wer ist besser geeignet für diese Aufgabe? Ein professioneller Übersetzer, der sich gründlich mit Theologie befasst hat, oder ein Theologe, der die entsprechende Sensibilität für die Übersetzung mitbringt? Oder nun ein Germanist, der übersetzungsbezogene Kompetenzen bzw. Theologie- Kenntnisse mitbringt? Man muss sich von der linearen Formulierung dieser Frage zugunsten eines mehrseitigen Ansatzes entfernen, bei dem jeder Experte sein Kolorit zum Gesamtbild beiträgt.
Es lässt sich auf der Seite der Übersetzungswissenschaft7 anmerken, dass es aktuell vergleichsweise wenige als Übersetzer ausgebildete Experten gibt, die sich mit solch alten Texten beschäftigen. Auch wird den vielen übersetzungsbezogenen Beiträgen von Spezialisten aus anderen Fachbereichen als Übersetzung vonseiten der Übersetzungswissenschaften kaum Beachtung geschenkt. Dabei hat gerade der Theologe und Plato-Übersetzer Schleiermacher zu seiner Zeit die übersetzungstheoretische Diskussion vorangetrieben. Die Verwurzelung ←16 | 17→der Übersetzungswissenschaft in der praktischen Welt führt zu einem „Rechtfertigungszwang“, der in den anderen bereits angesprochenen Disziplinen nur in einem ganz anderen Kontext spürbar ist8, da die Verwurzelung in der Praxis von Anfang an nicht bzw. nicht in der Form vorgesehen war und nicht zu den Erwartungen, auch und gerade, der breiteren Öffentlichkeit gehörte.9
Die Parteibildung, ja „Kriegsführung“, zwischen den Praktikern und Theoretikern der Übersetzung bringt Jörn Albrecht folgendermaßen auf den Punkt:
Die Vertreter einer hermeneutischen Position in unseren Wissenschaften und die Vertreter der sog. Praxis sind der „real existierenden“ Übersetzungswissenschaft gegenüber meist unfreundlich gesonnen. Die Vertreter der Position, die ich hier einmal mit einem etwas unscharfen Terminus die analytische nennen möchte, strafen sie in der Regel mit völliger Mißachtung. Als wissenschaftsfähig gelten den Vertretern dieser Richtung allenfalls die Bemühungen um die maschinelle Übersetzung.10
Wenn von Mystik im Zusammenhang mit Sprache die Rede ist, gehört es fast zum guten Geschmack, ja, es wird erwartet, dass auf die Unaussprechlichkeit der mystischen Erfahrung hingewiesen wird, dass die Ohnmacht, aber auch die Wichtigkeit der Sprache als Vehikel der mystischen Erfahrung thematisiert wird.11 Einer der Verfechter des Ineffabilitätsgedanken war William James.12 Die entgegengesetzte Position wurde am prominentesten von Steven T. Katz verteidigt.13 Die vorliegende Arbeit glaubt mit E. D. Hirsch und dem frühen Wittgenstein an die Analysierbarkeit der sprachlichen Bilder, zumindest an ihr Ordnen-Können, in kleineren Teilen Betrachten-Können. Sie will die Probleme der Sinn-Übersetzung zumindest ansatzweise systematisieren und kategorisieren – im Hinblick auf die Texte Meister Eckharts. Diese Arbeit will auch wagen, zu hinterfragen, ob sich mystische Sprache tatsächlich stets an der Grenze zum Unausdrückbaren bewegt. Vielmehr will sie in der ←17 | 18→mittelhochdeutschen Knappheit des Meisters stabile und strenge Denkkonstrukte aufdecken, die Bedeutung, die sie für die Übersetzung haben, und die Form, die sie darin annehmen. So schreibt auch Martina Roesner: „Insofern für Eckhart die Vernunft Gottes und die Vernunft des Menschen vom Wesen her dieselbe ist, stellt auch die äußerlich hörbare, menschliche Sprache kein Hindernis für die Artikulation der Einheit mit Gott dar, sondern ist im Gegenteil der Ort, wo die schöpferische Macht des göttlichen Logos in besonderer Weise erfahrbar wird“.14
Details
- Seiten
- 296
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631885925
- ISBN (ePUB)
- 9783631885932
- ISBN (Hardcover)
- 9783631878774
- DOI
- 10.3726/b20033
- DOI
- 10.3726/b20032
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (August)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 296 S., 30 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG