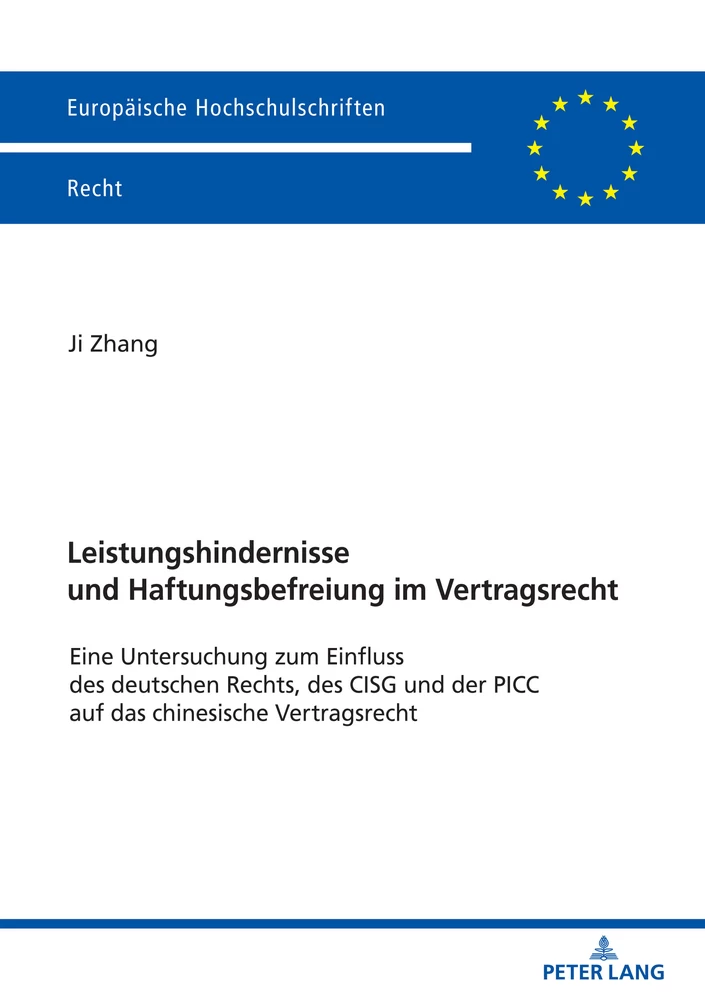Leistungshindernisse und Haftungsbefreiung im Vertragsrecht
Eine Untersuchung zum Einfluss des deutschen Rechts, des CISG und der PICC auf das chinesische Vertragsrecht
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1 Grundriss des chinesischen Leistungsstörungsrechts
- I. Übersicht: Das chinesische Vertragsrecht
- 1. Das ZGB und das chinesische Zivilrecht
- 2. Entwicklung der vertraglichen Gesetzgebung
- II. Das chinesische Leistungsstörungsrecht
- 1. Struktur des Leistungsstörungsrechts im VG 1999
- 2. Neuerungen durch das ZGB
- 3. Von der Garantiehaftung zur Verschuldenshaftung
- 4. Haftungsbegründung: die Vertragsverletzung
- 5. Haftungsausfüllung: Rechtsbehelfe des Gläubigers
- Teil 2 Die chinesischen Befreiungsregelungen
- I. Die Befreiungsfigur der höheren Gewalt
- 1. Entwicklung der Befreiungsfigur im chinesischen Recht
- 2. Tatbestand des § 117 VG
- 3. § 117 VG und Art. 79 CISG im Vergleich
- 4. Rechtsfolge des § 117 VG
- 5. Bedeutung des § 117 Abs. 1 S. 2 VG
- 6. Änderung durch § 590 ZGB
- II. Die Befreiung vom Erfüllungsanspruch
- 1. Schaffung der Regelungen in Anlehnung an die PICC
- 2. Tatbestand des § 110 Nr. 1 VG
- 3. Tatbestand des § 110 Nr. 2 Fall 2 VG
- 4. Rechtsfolge des § 110 VG
- 5. Änderungen durch §§ 580, 581 ZGB
- III. Die Befreiungsfigur der veränderten Umstände
- 1. Entwicklung der Befreiungsfigur im chinesischen Recht
- 2. Tatbestand des § 26 AB II
- 3. Die tatbestandliche Besonderheit des § 26 AB II
- 4. Rechtsfolge des § 26 AB II
- 5. Änderung durch § 533 ZGB
- Teil 3 Dogmatik, Systematisierung und Verbesserung
- I. Probleme durch die Rezeption ausländischer Rechtsfiguren
- II. Leistungshindernisse im allgemeinen Schuldrecht des BGB
- 1. Einführung
- 2. Unmöglichkeit
- 3. Störung der Geschäftsgrundlage
- 4. Abgrenzungsproblem durch Schuldrechtsreform
- 5. Eingrenzung des Problemfelds
- 6. Abgrenzung in der Diskussion
- 7. Der Parteiwille: eine Frage des Seins oder Sollens?
- 8. Dogmatische Einordnung von § 275 Abs. 2 BGB und § 313 BGB
- 9. Konsequenz für das deutsche Recht
- III. Leistungshindernisse im UN-Kaufrecht
- 1. Einführung
- 2. Art. 79 CISG im Vergleich mit dem deutschen Recht
- 3. Diskussionen zu Art. 79 CISG
- 4. Dogmatische Einordnung des Art. 79 CISG
- 5. Konsequenz für die Befreiungsvoraussetzung
- 6. Konsequenz für den Erfüllungsanspruch
- 7. Konsequenz für die Behandlung der Hardship
- IV. Leistungshindernisse im chinesischen Vertragsrecht
- 1. Privatautonomie und das chinesische Vertragsrecht
- 2. Möglichkeit des Rückgriffs auf die PICC-Vorschriften
- 3. Drei Trennungen als dogmatische Voraussetzung
- 4. Unterschiedliche Befreiungsmaßstäbe
- 5. Dogmatische Zuordnung der höheren Gewalt
- 6. Dogmatische Zuordnung der veränderten Umstände
- 7. Dogmatische Zuordnung der Ausschlussgründe für den Erfüllungsanspruch
- 8. Vorschläge für das chinesische Vertragsrecht
- 9. Korrigierende Anwendung der Regelungen des ZGB
- Zusammenfassung
- 1. Grundriss des chinesischen Leistungsstörungsrechts
- 2. Die chinesischen Befreiungsregelungen
- 3. Dogmatik, Systematisierung und Verbesserung
- Literaturverzeichnis
- Liste der chinesischen Vorschriften
Einleitung
Der Grundsatz der Vertragstreue stößt in den Konstellationen der Leistungshindernisse auf erhebliche Probleme. Moderne Rechtsordnungen kennen Regelungen, die den Schuldner in Extremsituationen entlasten wollen.1 Diese Regelungen werden bislang überwiegend als Ausnahmevorschriften, welche die Bindung an den Vertrag im Interesse der Vertragsgerechtigkeit einschränken sollen, angesehen.2
Auch das chinesische Recht sieht verschiedene Möglichkeiten der Befreiung vor. Das chinesische Zivilgesetzbuch (ZGB)3 hat die Vorschriften des Vertragsgesetzes (VG)4 von 1999 zu den Leistungshindernissen übernommen und zudem die richterliche Regelung des § 26 der Auslegungsbestimmung II zum VG (AB II)5 kodifiziert. Dadurch ist das Problem entstanden, dass die Befreiungsregelungen miteinander kollidieren. Die chinesischen Befreiungsfiguren wurden im Wege einer Rechtstransplantation aus dem ausländischen Recht übernommen. Um die Modernisierung des Landes voranzutreiben, hat sich China seit über hundert Jahren an westlichen Rechtssystemen orientiert. Ausländische Vorschriften und Rechtskonzepte wurden ins chinesische Recht transferiert und modifiziert. In jüngerer Zeit hat sich eine erkennbare Tendenz abgezeichnet. Das chinesische Recht wendet sich vom deutschen Recht als Vorbild ab und orientiert sich zunehmend an internationalen Regeln, insbesondere dem UN-Kaufrecht (CISG) und den UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC).
Um das Anwendungsproblem des Vertragsrechts zu lösen, ist die Bildung einer Rechtsdogmatik nicht nur vorteilhaft, sondern auch geboten. Nach der Kodifizierung des ZGB steht für die chinesische Rechtswissenschaft die Aufgabe der Systematisierung und Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelungen ←11 | 12→im Vordergrund. Für diese Aufgabe ist die Rechtsdogmatik ein wertvolles Werkzeug, um Rechtslücken zu schließen und Widersprüche zu beseitigen. Bei der Herausarbeitung der Befreiungsdogmatik wird daher weitgehend auf die Diskussionen zum deutschen Recht und dem CISG zurückgegriffen, die für das chinesische Vertragsrecht als Vorbild gedient haben. Es zeigt sich jedoch schnell, dass das Thema der Leistungshindernisse und Schuldnerbefreiung auch in den Vorbildländern höchst umstritten ist.
Betrachtet man das deutsche Schuldrecht, hat § 275 BGB durch die Schuldrechtsreform im Jahr 20026 eine neue Kontur erhalten. Das alte Recht der Unmöglichkeit wurde im Grunde aufgegeben und das Gesetz sieht nun eine Unterscheidung zwischen Unmöglichkeit und Unverhältnismäßigkeit vor. Außerdem wurde mit § 313 BGB das Richterrecht der Geschäftsgrundlage kodifiziert, das den Schuldner entlastet, wenn eine „Zumutbarkeitsgrenze“ überschritten ist. Da beide Regelungen bei einer Leistungserschwerung anwendbar sind, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Noch grundsätzlicher stellt sich mit Blick auf diese Regelungen die Frage, was der eigentliche Grund für die Befreiung des Schuldners ist. Ein weiteres Beispiel bietet das CISG, das die zentrale Befreiungsvorschrift des Art. 79 CISG vorsieht. Auch diese Vorschrift scheint mehr Fragen aufzuwerfen als zu beantworten, weil über die Befreiung nach dem CISG zahlreiche Streitigkeiten bestehen.
Die Kontroversen um die Frage der Befreiung sollten aber den Blick nicht verstellen, dass es sich im Wesentlichen nur um zwei Pflichten des Schuldners handelt: die rechtsgeschäftliche Leistungspflicht und die gesetzliche Haftungspflicht. Die erste Frage behandelt die Reichweite der vertraglichen Vereinbarung und damit die Konkretisierung des Grundsatzes der Vertragstreue,7 bei der zweiten steht dagegen der Schutz bestehender Vermögenswerte im Vordergrund.8 So unterschiedlich, wie die Begründungen sind, können auch die Befreiungsschwellen sein. Eine Lösung des Problems verlangt, dass für jede Befreiungsvorschrift eine dogmatische Zuordnung ermöglicht wird.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Zunächst wird das chinesische Leistungsstörungsrecht in seiner aktuellen Form dargestellt. Die Regelungen der Leistungshindernisse sind nur unter dem Bezugssystem der Leistungsstörungen verständlich. In diesem Zusammenhang weist das chinesische Recht ←12 | 13→viele Besonderheiten gegenüber dem deutschen Recht und dem CISG auf. Im zweiten Teil werden die einzelnen chinesischen Befreiungsregelungen unter die Lupe genommen. Dabei wird nicht nur die Entstehungsgeschichte der Regelungen untersucht, sondern auch die Besonderheiten im Tatbestand und in den Rechtsfolgen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Änderungen bei der Kodifizierung, die neue Probleme aufwerfen. Die ersten beiden Teile der Arbeit haben eine zeitliche und eine örtliche Dimension: Die Regelungen werden stets unter Bezugnahme auf ihre Vorgängervorschriften und die entsprechenden ausländischen Regelungen betrachtet.
Der dritte Teil ist der Systematisierung und Verbesserung der Regelungen gewidmet. Auch wenn dogmatische Diskussionen in China bisher nicht sehr verbreitet sind, wird hier der Versuch unternommen, eine Rechtsdogmatik für Befreiungsfragen zu entwickeln. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Übernahme fremder Rechtskonzepte mit einer Rezeption der ausländischen Rechtsdogmatik einhergehen kann.9 Die sich aus der Rechtsübernahme ergebenden Anwendungsprobleme sollen unter Rekurs auf die Diskussionen zu den Mustervorschriften gelöst werden. Für die Ausarbeitung der Rechtsdogmatik wird auf eine in der deutschen Literatur vertretene Rechtsauffassung zurückgegriffen, deren Anwendung im chinesischen Recht getestet wird.
I. Übersicht: Das chinesische Vertragsrecht
1. Das ZGB und das chinesische Zivilrecht
Das chinesische Zivilgesetzbuch (ZGB) ist entstanden. Am 28. Mai 2020 stimmten die chinesischen Abgeordneten in der dritten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses mit überwiegender Mehrheit für die Verabschiedung des ZGB,10 das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Gleichzeitig traten die Einzelgesetze – der Allgemeine Teil des Zivilrechts, das Vertrags-, Sachenrecht-, Deliktshaftungs-, Ehe-, Erb-, Adoptions- und Garantiegesetz – außer Kraft. Mit der Verabschiedung des ZGB wurde verkündet, dass Chinas „Ära des Zivilgesetzbuchs“ angebrochen ist.
Als das erste Zivilgesetzbuch seit der Gründung der Volksrepublik11 enthält das ZGB insgesamt 1.260 Artikel, aufgeteilt in sieben Bücher in folgender Reihenfolge: Allgemeiner Teil, Sachen-, Vertrags-, Persönlichkeits-, Ehe- und Familien-, Erb- und Deliktsrecht.12 Der Allgemeine Teil wurde im März 2017 in Gestalt eines Einzelgesetzes, ATZ 2017, erlassen.13 Die Bausteine für den Besonderen Teil lagen auch in Form von Einzelgesetzen vor, deren Zusammenstellung und Überarbeitung bisher ausblieb. Bei den im Prozess der Kodifizierung geschaffenen Vorschriften stammte ein großer Teil aus den bestehenden justiziellen Auslegungen, die zum geltenden Recht gehörten.14 Trotz aller Umstände ist die Kodifizierung des Zivilrechts innerhalb fünf Jahren als sehr schnell anzusehen.15 Um den ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten, konnte die Mehrheit der aus der Lehre und Praxis gemeldeten Vorschläge nicht berücksichtigt ←17 | 18→werden. Zu Recht wird kritisiert, dass die wissenschaftlichen Debatten bei der Kodifizierung an Intensität verloren haben und die Kodifikation eher als eine Konsolidierung der bestehenden Gesetze anzusehen ist.16
Details
- Seiten
- 212
- Erscheinungsjahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631881941
- ISBN (ePUB)
- 9783631881958
- ISBN (MOBI)
- 9783631881965
- ISBN (Paperback)
- 9783631881729
- DOI
- 10.3726/b20034
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Juli)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 212 S.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG