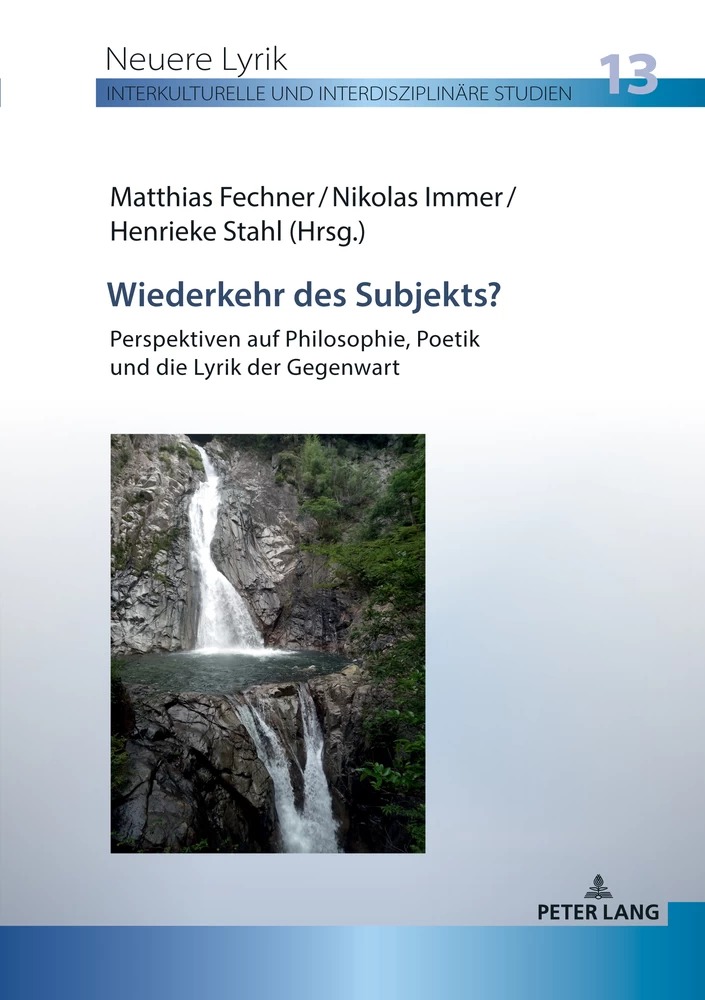Wiederkehr des Subjekts?
Perspektiven auf Philosophie, Poetik und die Lyrik der Gegenwart
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Einleitung: Produktive Transformationen. Zur Konjunktur des Subjekts in der Philosophie, Poetik und Lyrik der Gegenwart (Matthias Fechner (Trier) / Nikolas Immer (Trier) / Henrieke Stahl (Trier))
- I. Philosophische und theoretische Perspektiven
- Subjektivität als Erfahrung höherer Art. Essay eines historischen Streifzugs (Harald Schwaetzer (Bernkastel-Kues))
- „in te ipsum redi“. Der Rückgang des Subjekts ins Selbst (Tilman Borsche (Hildesheim))
- Subjekt und Lyrikologie (Rüdiger Zymner (Wuppertal))
- Wer hat Angst vor dem Lyrischen Subjekt? Anmerkungen zur Lyrikologie des ‹ sujet lyrique › und des ‘textual subject’ (Ralph Müller (Fribourg))
- Leser – Abstrakter Autor – Autorbild – Interpretation in der Lyrik (Willem G. Weststeijn (Amsterdam))
- Subjekt und Selbst in der chinesischen Tradition und in neueren Untersuchungen zur chinesischen Lyrik von 1980 bis 1995 (Christian Soffel (Trier))
- From Transcendental to Transformative Subject: Encountering Recent Chinese Poetry (Yi Chen (Heidelberg) / Boris Steipe (Toronto))
- II. Poetologische und transgressive Perspektiven
- Zwischen „Ich“ und „Wir“. Zur Problematik des Subjekts in der ukrainischen Lyrik von der Romantik bis nach der Postmoderne (Alessandro Achilli (Cagliari))
- Poets at War in Ukraine: Between Poetics and Ideology (Anna Fees (Trier))
- Spiele mit Perspektive und „Subjektkonstitution“: Einige Beobachtungen zur Deixis in der Gegenwartslyrik (Ekaterina Friedrichs (Trier))
- Das poetische Subjekt und der Körper in russischer und deutscher Lyrik der Gegenwart (Rainer Grübel (Oldenburg))
- Russisch-amerikanische Gegenwartsdichter als Selbstübersetzer (Adrian Wanner (Pennsylvania))
- The Broken Mirror of Subjectivity in Contemporary Brazilian Poetry (Adalberto Müller (Rio de Janeiro / Trier))
- Two Typewriters Travelling across the Atlantic (Chile and the United Kingdom): Cecilia Vicuña’s and Anamaría Briede’s Performances, Artistic and Poetic Practices (Macarena Urzúa Opazo (Santiago de Chile))
- Lyrik und Autismus: Potentiale und Perspektiven (Bernhard Schmalenbach (Alfter bei Bonn))
- III. Exemplarische und vergleichende Perspektiven
- „Hölderlin“ als Stimme des poetischen Subjekts in der zeitgenössischen deutschsprachigen Poesie: Friederike Mayröcker und Gerhard Falkner (Juliana Kaminskaja (St. Petersburg))
- Das zuverlässig unzuverlässige Subjekt. Gerhard Falkners „Apollokalypse“ (2016) im literaturgeschichtlichen Kontext des Berlinromans (Matthias Fechner (Trier))
- Hohn-ich-Protokoll. Idiotische Dekonstruktion des Subjekts bei Monika Rinck (Hiroshi Yamamoto (Tokyo))
- „Ich weiß, was ich schreibe…“ Auf den Spuren des Subjekts in der Poesie von Arkadij Dragomoščenko (Juliana Kaminskaja (St. Petersburg))
- Das andere Ich im exophonen Schreiben: Überlegungen mit Beispielen von Minae Mizumura und Yoko Tawada (Hiroko Masumoto (Kobe))
- Das eingeklammerte Ich – Über das lyrische Ich in Yoko Tawadas japanischem Gedichtband „Die Leiche des Regenschirms und meine Frau“ (Miho Matsunaga (Tokyo))
- Die symbiotische Beziehung zwischen Körper und Sprache am Beispiel der Lyrik Du Fus und Zheng Xiaoqiongs (Huiru Liu (Trier))
- „Ich bin, was davon übrig bleibt“ – « أ ان ام ىقبت نم كلذ »: Die Konstituierung des weiblichen Subjekts in der Lyrik von Iman Mersal (Noha Abdelrassoul (Saarbrücken))
Einleitung: Produktive Transformationen. Zur Konjunktur des Subjekts in der Philosophie, Poetik und Lyrik der Gegenwart
Matthias Fechner (Trier) / Nikolas Immer (Trier) / Henrieke Stahl (Trier)
Die Frage nach dem Subjekt ist seit der griechischen Antike immer wieder aufgegriffen und neu reflektiert worden. Schon bei Hesiod, Herodot und später auch bei Plutarch beginnt sich „ein intensives Interesse am Individuellen“ herauszubilden.1 Als prägend erweist sich die Kategorienlehre des Aristoteles, in der zwischen Subjekten und Dingen, die zu den Subjekten gehören, unterschieden wird. Mit der Differenz zwischen ‚res cogitans‘ und ‚res extensa‘ etabliert Descartes ein dualistisches Modell, das für die neuzeitliche Subjektphilo-sophie des 17. und 18. Jahrhunderts paradigmatische Bedeutung gewinnt (Locke, Leibniz, Hume u.a.). Ebenso wie Descartes vertreten noch Kant, Fichte und Hegel die Position, dass erstens „die menschliche Subjektivität letztlich den Quellgrund aller Wirklichkeit und Wahrheit bildet“ und dass es zweitens gewiss sei, „daß sich die menschliche Subjektivität im Denken als solches vollzieht“.2 Diese Annahmen werden im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend diskutiert und in Frage gestellt: Das Subjekt wird nicht mehr als „Quellgrund“ aufgefasst, sondern vielmehr als Medium, das von Machtkonstellationen und Triebimpulsen bestimmt ist.3 Diese Dezentrierung des Subjekts wird mit der im Postrukturalismus aufkommenden Rede vom ‚Tod des Subjekts‘ rhetorisch überhöht.4 Das Postulat vom „Verschwinden des Subjekts“, das Michel Foucault Anfang der 1980er Jahre in seinen Vorlesungen am Collège de France formuliert,5 erweist sich keineswegs als irreversibel. Vielmehr bleibt die Diskussion um die Stellung des Subjekts bis in die Gegenwart kontrovers und lebendig. So stellt Rüdiger Zymner im Rekurs auf Peter Bürger fest, dass die „Schriftsteller und Autoren der Romania als repräsentative Zeitanzeiger in der Geschichte der Moderne fungieren“6 – ein Befund, der selbstverständlich auf die Postmoderne zu erweitern ist. Seit einigen Jahren ist dabei allerdings eine Verlagerung des Diskurses nach Nordamerika zu beobachten, eine Bewegung, die Ralph Müller in seinem Beitrag nachvollzieht.7
←9 | 10→So ist das Subjekt niemals verschwunden, sondern vielmehr permanent in Transformation begriffen. Eine solche Verwandlung des Subjekts veranschaulicht exemplarisch Alain Robbe-Grillets Film « Trans-Europ-Express » (1966),8 in dem vorgeführt wird, wie der Schauspieler Jean-Louis Trintignant gleichsam vier Mal ‚verschwindet‘: Er selbst geht im Schauspieler auf (1), der wiederum seiner Rolle im laufenden Film (2) zu folgen hat, die in den dortigen Dialogen jedoch dramaturgische Veränderungen (3) erfährt und in mehreren Versionen das Verschwinden ihres Subjekts (4) vorsieht. Auch aus der Perspektive Robbe-Grillets löst sich der Autor vier Mal auf: Der Mensch Alain Robbe-Grillet (1) tritt hinter den Drehbuchautor Robbe-Grillet (2) zurück, dessen Werk wiederum durch den Regisseur Robbe-Grillet (3) übernommen wird, um sich in der Rolle im Gespräch (4) mit dem Produzenten zu verändern. Angesichts dieser Interferenzen und Transformationen ist es den Rezipient*innen aufgegeben, zwischen den verschiedenen Subjektformen zu differenzieren und sie deutend auf die Handlung zu beziehen.9
Bemerkenswerterweise hat Roland Barthes zwei Jahre später am Beginn seines Essays « La mort de l’auteur » (1968) ähnliche Beobachtungen angestellt, um das Verschwinden der Stimme in der Schrift zu beschreiben.10 Dort rekurriert er auf Honoré de Balzacs Novelle « Sarrasine » (1830) und fragt mit Bezug auf die Figur eines Kastraten, der als Frau verkleidet ist:
Wer spricht hier? Ist es der Held der Novelle, […] der sich hinter der Frau verbirgt? Ist es das Individuum Balzac mit seiner persönlichen Philosophie über die Frau? Ist der Autor Balzac, der ‚literarische‘ Ideen über das Weibliche verkündet? Ist es die Weisheit schlechthin? Die romantische Psychologie?11
←10 | 11→Auch wenn Barthes anschließend auf die ‚Flucht des Subjekts‘ eingeht,12 betonen seine Fragen die Komplexität insbesondere jener Subjektformen, die in literarischen Texten vorkommen. Dabei legen sowohl das Beispiel Robbe-Gril-lets als auch das von Barthes aufgegriffene Balzac-Beispiel die Erforderlichkeit der Präzisierung des mehrdeutigen und vielgestaltigen Subjektbegriffs nahe.13
Schon Hans Michael Baumgartner hat unter der Leitfrage „Welches Subjekt ist verschwunden?“ jene zentralen Aspekte resümiert, die für die Konstitution eines Subjekts unentbehrlich bleiben: den indexikalischen Aspekt (Personalpronomina als Bezeichnung der Selbstreferenz des Redenden im Hier und Jetzt); den Aspekt der Identität und Synthesis (Festhalten der Identität des Wissens); den Personalitäts-Aspekt (das Ich als vernünftiges Wesen) sowie den Intersubjektivitäts-Aspekt (das kommunizierende Subjekt); lediglich bei dem Aspekt der Erhebung des Ich zum Absoluten kann von einem Verschwinden des Ich bzw. Subjekts gesprochen werden.14
Trotz der von Baumgartner skizzierten Kontinuitäten, die den Kern des Subjektbegriffs ausmachen, befindet sich das künstlerische Subjekt des 21. Jahrhunderts in einem völlig neuen Spannungsfeld, das vor allem durch die Aufhebung der Grenzen zwischen Sprachen, Kulturen und Kunstformen sowie die Kurz- und Gleichzeitigkeit der daraus resultierenden Transformations-prozesse verstärkt innovative Impulse erhält. Das Subjekt kann sich kreativer zwischen seinen angestammten Referenzfeldern – Text, Autor*in, Leser*in – bewegen, um sich in neuen, wandelbaren Konstellationen wiederzufinden. Im vorliegenden Band zeigt etwa Rainer Grübel, wie das Subjekt in der – leider nicht (mehr) ausgeführten – Performance «Вознесение» („Elevation“) Dmitrij Prigovs Gestalt gewinnt. Dort sollte es in der Rolle Prigovs in einem Schrank vom untersten Geschoss des Gebäudes der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) ins oberste, 22. Stockwerk expediert werden und dabei Puškins «Ев-гений Онегин» („Eugen Onegin“) deklamieren, selbstverständlich – samt Text – nach Prigovs Dramaturgie. Wir finden das Subjekt aber auch in einer ungewöhnlichen Schnittmenge zwischen konträren Positionen der Literatur, der radikalen Trennung vom und der höchsten Symbiose mit dem Autor: im Shishōsetsu, dem japanischen Ich-Roman. Zentrales Charakteristikum dieses in der Moderne entstandenen Genres ist eine autobiographisch geprägte Perspektive, die jedoch bewusst durch fiktionale Elemente ergänzt wird. In Hiroko Masumotos Beispiel rechnet die Autorin Minae Mizumura in “Shishosetsu from left to right” (1995) durch ihre Stellvertreterin, die Studentin Minae, mit ihrem Leben in den Vereinigten Staaten ab. Mizumura selbst bezeichnet ihren Roman als “basically an autobiographical novel” und stellt sich in eine ←11 | 12→europäische Tradition, die bis zu Marcel Prousts « À la recherche du temps perdu » zurückreicht.15 Damit ist eine Selbsteinordnung formuliert, die aus japanischer Perspektive zwar durchaus wirksam bleibt, die aber aus westlicher Sicht, bei zumeist strenger Trennung von Autor und Subjekt, Fragen provoziert und neue Spannungsfelder schafft.
Der vorliegende Band versucht, diesen neuen, pluralen Prämissen gerecht zu werden und die Veränderungen der Literaturtheorie im 21. Jahrhundert anzuerkennen, denen Vincent Leitch eine globale Zukunft prophezeit:
Theory has gone global. It may be expected to continue going global, furthermore, by incorporating “foreign” elements, both classic and contemporary. At present, theory in North America and Europe does not usually include Arabic, Chinese, Indian, Japanese, Persian, or other non-European traditions. In the future, it will increasingly do so.16
Die Beiträge gehen dabei aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven auf die von Leitch beschriebene Konstellation ein. In der ersten Sektion, in der das Subjekt in philosophischen und theoretischen Perspektiven behandelt wird, wenden sich die Philosophen Harald Schwaetzer und Tilman Borsche den Fundamenten der Subjektivität in der europäischen Geistesgeschichte zu. Auf dieser Grundlage wird die Gattung der Lyrik in den Folgebeiträgen näher fokussiert: im Hinblick auf das lyrische Subjekt bei Rüdiger Zymner, Ralph Müller und Willem G. Weststeijn und im Hinblick auf die chinesische Lyrik bei Christian Soffel sowie Yi Chen und Boris Steipe. In der zweiten Sektion werden poetologische und transgressive Perspektiven entfaltet, die sich auf das Subjekt und seine literarischen Konfigurationen beziehen. Zunächst behandeln Alessandro Achilli, Anna Fees, Ekaterina Friedrichs und Rainer Grübel poetologische Fragestellungen, zu denen etwa das Verhältnis von lyrischem Subjektentwurf und ideologisch-politischen Ambitionen zählt, an-hand von Beispielen aus der ukrainischen, russischen und deutschen Gegenwartslyrik. Das transgressive Moment kommt in den auf Südamerika ausgerichteten Beiträgen von Adalberto Müller und Macarena Urzúa Opazo vorwiegend in geographischer Hinsicht zur Geltung, während Adrian Wanner und Bernhard Schmalenbach phänomenologische Grenzerweiterungen präsentieren: Selbstübersetzungen von Lyriker*innen einerseits und Gedichte autistischer Menschen anderseits. Die dritte Sektion versammelt eine Reihe von Fall-studien aus unterschiedlichen kulturellen Räumen und bietet somit exemplarische und vergleichende Perspektiven. Spannen Juliana Kaminskaja, Matthias Fechner und Hirsohi Yamamoto den Bogen ihrer Untersuchungen von ←12 | 13→Friederike Mayröcker über Gerhard Falkner bis zu Monika Rinck, widmen sich Hiroko Masumoto und Miho Matsunaga der Konstitution des Subjekts in der Lyrik Yoko Tawadas. Erweitert werden diese Beiträge um Huiru Lius Beobachtungen zur Lyrik Du Fus und Zheng Xiaoqiongs sowie um Noha Abdelrassoul Darstellung zur arabischen Gegenwartslyrik, mit dem Fokus auf den Gedichten Iman Mersals.
Die erste Sektion, die „Philosophische und theoretische Perspektiven“ eröffnet, beginnt mit dem Beitrag Harald Schwaetzers, der ausgewählte geistesgeschichtliche Stationen der Genese des Ichbegriffs mit Fundierung in der Transzendenz skizziert. Dieser gewinnt zunächst das Subjekt aus dem Gottesbezug, fundiert es dann transzendental, um schließlich in einer Transformation der transzendentalen Wende erneut zur Transzendenz vorzustoßen, jetzt allerdings im Existenzvollzug der Selbsterkenntnis. Schwaetzer sensibilisiert für die historische Wandelbarkeit von Begriffen und Bewusstseinsformen sowie für die Vielschichtigkeit der mit dem Ich-Begriff verbundenen Ebenen und Aspekte.
Während sich Schwaetzer auf die Entwicklung eines Subjektbegriffs mit Transzendenzbezug konzentriert und einen Bogen von der Antike bis zur Gegenwart schlägt, rückt Tilman Borsche die Begriffsgeschichte anhand der Begriffsnamen ‚Subjekt‘ und ‚Selbst‘ seit der Neuzeit bis zur Verabschiedung des Subjekts in der Postmoderne in den Fokus. Borsche zeigt dabei, dass die Bezeichnung ‚Subjekt‘ für das selbstbestimmte menschliche Individuum „ein[en] Sonderweg der deutschsprachigen Philosophie durch und seit Kant“ repräsentiert und die Begriffsgeschichte eine andere Bezeichnung für diesen Sachverhalt anbietet: das „Selbst“, welches den Menschen von seinem Gegenüber her und damit dialogisch und sozial zu denken nahe legt. Zugleich integriert der Begriff des ‚Selbst‘ die für den Subjektbegriff konstitutiven Aspekte wie leibhafte Präsenz und Selbstbestimmung, schließt aber die ursprüngliche Wortbedeutung von Subjekt für „Untergestell“ oder „Unterliegendes“ aus, die in anderen Sprachen erhalten geblieben sind.
Rüdiger Zymner knüpft an die historische Wandelbarkeit von Begriffen an und betont, dass die Frage nach dem Subjekt in der Lyrik zunächst eine Frage nach Konzepten darstellt: Konzepte entstehen, wandeln und lösen sich auf. Aus dieser Perspektive erklärt sich auch die Rede vom Verschwinden und der möglichen Wiederkehr des Subjekts – es geht um die Absage an bestimmte Begriffsnamen und mit ihnen verbundene Konzepte. Zymner weist aber auch auf Aspekte des Subjektbegriffs hin, die gegenüber diesem Wandel relativ beharrlich sind wie z.B. die Existenz von Personalpronomina; allein das ‚absolute Subjekt‘ im Sinne des Transzendentalen Idealismus hält er im Hinblick auf die Gegenwart für obsolet. Die enge Bindung der Lyrik an Namen und an den Begriff des ‚Subjekts‘ sieht er historisch begründet, zunächst durch die alte Verbindung von Lyrik mit der Musik, dann durch das romantisch-idealistische ←13 | 14→Erbe in der Theoriebildung. Die neuere Lyrik hingegen könne Formen der Problematisierung des Subjekts zeigen – oder auch nicht.
Ebenso betont Ralph Müller die Historizität, damit die Wandelbarkeit und Vielheit von Subjektkonzepten in der Lyriktheorie. Er fokussiert seinen Überblick über die Verwendung des Subjektbegriffs auf die neuere französische, nordamerikanische und deutsche Lyriktheorie und arbeitet die nationalphilologischen Differenzen und Verflechtungen der Diskurse heraus. Als tragfähig erweist sich für ihn der Subjektbegriff für die rezente Lyriktheorie und -analyse, wenn er einen Mehrwert gegenüber anderen Begriffen wie einerseits dem (ichhaften oder ichlosen) Adressanten, dem Sprecher oder der Stimme und andererseits dem Autor selbst bringt. Diesen Mehrwert erkennt er in einem Subjektbegriff, der sich sowohl von Autor wie Adressant als auch von der zwischen diesen Polen angesiedelten Instanz des ‚Textsubjekts‘ (Burdorf) absetzt, das mit dem in der Narratologie entwickelten Begriff des ‚abstrakten Autors‘ verwandt ist. Dieses Konzept des ‚lyrischen Subjekts‘ bildet vielmehr einen Spielraum zwischen realem Autor und mit diesem in einer distanzierten, aber relationierbaren Beziehung stehenden Adressanten aus, die sich einer eindeutigen Referenzierbarkeit entzieht. Gleichzeitig bietet diese Relation, weil sie ein jeweils auszulotendes Verhältnis zwischen Fakt und Fiktion eröffnet, dem Leser einen gleichsam ‚offenen‘ Raum an.
Willem G. Weststeijn votiert für die Verwendung eines weiteren Subjektkonzepts für die Lyrik, welches in der Narratologie entstanden ist, allerdings mit einer Korrektur: Der Begriff des „abstrakten Autors“ sei nicht im Sinne des Textkonstrukts oder – mit Burdorf – „Textsubjekts“, weiter zu verwenden, sondern als Bild des Autors, welches die Leser*innen entwerfen und auf das Gedicht beziehen. Weststeijn versteht unter dem „abstrakten Autor“ das Bild, das sich die Leser*innen vom Autor machen, und zwar einerseits anhand eines literarischen Textes und andererseits mithilfe sonstiger Quellen. Die Kenntnis der Person und der Biographie kann, wie an Beispielen gezeigt wird, die Interpretation des Textes stark verändern oder sogar umkehren in einem Sinn, wie es der Wortlaut des Textes selbst nicht nahelegt – analog etwa zur Deutung, wie sie eine Performance einem Text auflegen kann, indem etwa durch Tonfall, Gestik, musikalische Unterlegung, Choreographie, Kostümierung, Bühnenbild oder Aufführungsort neue Aspekte zum Text hinzukommen. Insbesondere Lyrik legt die Möglichkeit einer Performance nahe, welche sich an-hand der Vorstellung vom Autor konkretisieren lässt.
Die traditionelle chinesische Literatur weist, wie Christian Soffel ausführt, in der Lyrik keine starke Präsenz eines Subjektes auf, weil es erst mit der Modernisierung der Lyrik nach westlichen Vorbildern sichtbar ausgeprägt wird. Doch selbst wenn sowohl die klassische chinesische Philosophie als auch die Dichtung keine Lexeme und Begriffe bezüglich der Subjektivität in Analogie zu europäischen Traditionen ausgebildet haben, lassen sich Aspekte ←14 | 15→des modernen europäischen Subjektbegriffs durchaus nachweisen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass sowohl die Terminologie als auch die Konzeptbil-dung zum Themenkomplex ‚Subjektivität‘ erst durch die Rezeption westlicher Traditionen in der Lyrik selbst sowie ihrer Forschung ausgebildet wurden.
Yi Chens und Boris Steipes Beitrag fokussiert die Entwicklung vom transzendentalen zum transformativen Subjekt. Der rezeptive Zugang zu Lyrik verzichtet in der chinesischen Kultur auf dichotomische Sichtweisen, also auf eine Zweiteilung von Gut und Böse, eine intellektuelle Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Chen und Steipe ergründen nun, wie dieser Zugang, d.h. wie das Dào, sich auf das Rezipieren (und das Verfassen) von Gedichten auswirken könnte. Dazu betrachten sie unter anderem das Gedicht 大地 (Erde) von Li Shijiang, dessen Sprecher die Erde als Ort von Verwertungskreisläufen sieht, aber auch als Mutter, selbst im Vergleich mit einer Biomülltonne. Die Ambiguität von Lyrik wird von der Autorin, dem Autor dabei in Relation zur Uneindeutigkeit des Daoismus gesehen. In der Begegnung der Lesenden mit dem Gedicht vollziehe sich darüber hinaus eine Transformation, im Spannungsfeld von Self-ness (Emotionen) und Self Scope (Fähigkeiten), die mit der analytischen Rigidität der Naturwissenschaften in einem Diagramm visualisiert wird.
Die zweite Sektion, die „Poetologische und transgressive Perspektiven“ umfasst, wird von einem Beitrag Alessandro Achillis eingeleitet, der eine literarhistorische Erklärung für die Präsenz eines starken Subjekts gerade in der politischen Lyrik der Ukraine bietet. Die Identifikation von lyrischem Ich und Autor, der wiederum metonymisch für die Gesellschaft steht, wird zum nation building eingesetzt. Die Emanzipation des Individuums steht nicht nur für die kulturelle und politische Emanzipation der Ukraine, sondern soll diese auch befördern. Achillis Nachweis dieser Entwicklung setzt im späten 18. Jahrhundert bei Ivan Kotljarevskyj ein und greift über Taras Ševčenko bis ins 20. Jahrhundert zu Vasyl’ Symonenko und Vasyl’ Stus aus. Gezeigt wird außerdem, wie diese Linie in der Gegenwart bei dem vielleicht international bekanntesten Gegenwartslyriker der Ukraine, Serhij Žadan, ihre Weiterführung findet.
Anna Fees behandelt mit ihrem Beitrag über die Lyrik der beiden ukrainischen Dichter*innen Iya Kiva und Borys Humeniuk gleichzeitig eines der drängendsten politischen Probleme Europas: die militärischen und kriegerischen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland. Dabei weist Fees anhand eines kulturhistorischen Zuganges nach, dass Humeniuk eine eher männlich geprägte Perspektive anwendet, die durch populistische Elemente verhärtet wird, ohne jedoch den Gegner Russland in offensichtlicher Weise zu schmähen. Umgekehrt löst die auf Russisch schreibende Iya Kiva genau solche Verhärtungen auf, indem sie in ihrer Lyrik, aus einer Sichtweise, die Fees als weiblich bezeichnet, grundsätzlich das Schicksal aller Betroffenen des Krieges thematisiert.
←15 | 16→Ekaterina Friedrichs beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit den Bezügen und Bezüglichkeiten in Texten der Gegenwartslyrik, die in der als nicht-narrativ verstandenen, hermetischen und mitunter selbstreferentiellen Lyrik auch und gerade durch liminale Regelbrüche neu geschaffen werden. Dazu zählt sie insbesondere den „Verzicht auf bestimmte Sprachnormen, die Verletzung distributiver Reihen, die Instabilität syntagmatischer Grenzen und Wortgrenzen, sowie die kumulative Dynamik der Sinngehalte“.
Der Verbindung von Subjektkonstruktion, Körper und Dichtung geht Rainer Grübel anhand von Gedichten aus der russisch- und deutschsprachigen Lyrik nach. Dabei bewegt er sich durch die neuere Literaturgeschichte beider Sprachen, indem er Lyrik von Sergej Birjukov, Vera Pavlova, Anna Al’čuk, Dmitri Prigov oder Jurij Lejderman einerseits behandelt, andererseits – und ergänzend dazu – Gedichte von Ernst Jandl, Durs Grünbein oder Martina Hefter analysiert. Während die deutsche Gegenwartslyrik einen eher medizinischen und naturwissenschaftlichen Kontext aufruft, rekurriert die russische auf eine lange, bis in die Antike zurückgehende philosophische und theologische Tradition. Vor diesem Hintergrund wird die Separierung von Leib und Subjekt bzw. verschiedenen Subjektformen betont.
Auf die Frage der Selbstübersetzung (aus dem Russischen), die „otsebjatina“ («отсебятина»: abgeleitet von „ot sebja“ – „von sich selbst“), geht Adrian Wanner in seinem Beitrag über russisch-amerikanische Gegenwartsdichter*innen ein. Das vergleichsweise neue Forschungsfeld stellt Wanner dabei anhand zweier unterschiedlicher Beispiele dar, den Gedichten «ШЕРЕМЕТЬЕВО» (1998) bzw. “MOSCOW INTERNATIONAL AIRPORT” (1998) von Andrey Grits-man und «АВТОНАТЮРМОРТ В ПИЖАМЕ» (2002) bzw. “Self-Portrait in Pajamas” (2004) von Katja Kapovich. Augenfällig wird dabei, dass Selbstübersetzer größere Freiheiten in der Übersetzung für sich beanspruchen (können), das übersetzte Gedicht folglich eine neue Version darstellt, die sich stellenweise deutlich vom Ausgangstext entfernt. Mehrsprachige Menschen, folgert Wanner, schreiben daher, je nach Verwendung der Sprache, mit einer gefühlt anderen Identität, die wiederum die Definition des Subjekts beeinflusst.
In seinem Beitrag “The Broken Mirror of Subjectivity” skizziert Adalberto Müller den Weg des Subjekts durch die brasilianische Lyrik der Moderne (seit 1922) bis in die unmittelbare Gegenwart hinein. Der zerbrochene Spiegel der Subjektivität konfrontiert sowohl Lyriker*innen als auch Leser*innen mit ihren jeweils eigenen, subjektiven Perspektiven, die sich nicht mehr im Gesamtbild der brasilianischen Nation wiederfinden. Sein Essay bezieht dabei auch wichtige Ereignisse der neueren brasilianischen Geschichte und künstlerische Ausdrucksformen jenseits von Lyrik ein. In stark verdichteter Weise führt Adalberto Müller seine Leser vom Modernismo zur Konkreten Poesie (Concretismo), die er mit dem vor allem musikalisch ausgeprägten Tropicalismo verbindet, indem er beispielsweise die lyrischen Texte Caetano Velosos ←16 | 17→würdigt. Damit zieht er einerseits eine vertikale, historische Zeitlinie der Avantgarden, andererseits eine horizontale Verbindung, die sich auf die mannigfaltige Breite progressiver Künste in Brasilien erstreckt.
Macarena Urzúa Opazo erweitert Adalberto Müllers südamerikanische Perspektive mit einer akribischen Studie zur künstlerischen Arbeit der chile-nischen Gegenwartslyrikerinnen Cecilia Vicuña and Anamaría Briede. Auch sie arbeiten in der Schnittmenge weiterer Künste – Performance, Musik, Bildende Kunst –, in der inzwischen historischen Auseinandersetzung mit Diktatur, genauer: dem Pinochet-Regime, was insbesondere am Beispiel von Vicuñas frühem Gedichtband «Sabor a mí» (1973) in literaturgeschichtlich relevanten Detaillierungen ausgeführt wird. Im Schreiben der beiden feministischen Lyrikerinnen wird unter anderem die Schreibmaschine zu einem Instrument, einem Scharnier, das Physis, Performance, Kunst, Zeit, Raum, Klang und Poesie auf je unterschiedliche Weise verbindet.
Bernhard Schmalenbach geht in seinem Beitrag auf das Verhältnis von Lyrik und Autismus ein. In seiner grundlegenden Darstellung erklärt er im ersten Teil das Phänomen des Autismus, seine psychologischen Theorien, aber auch die besonderen Voraussetzungen und Ausprägungen künstlerischer Praxis bei Menschen in besonderen Lebenslagen. Im zweiten Teil seines Aufsatzes arbeitet Schmalenbach an poetischen Texten von Axel Brauns, Sarah Cobbe, Daniela Gonschorek sowie Kornelius und Konstantin Keulen heraus, wie sich Autismus in der literarischen Sprache zeigt bzw. welche Erkenntnisse wir über das hohe Potential von Autist*innen aus ihrer Literatur gewinnen können.
Die dritte Sektion, in der „Exemplarische und vergleichende Perspektiven“ entfaltet werden, beginnt mit einem Beitrag Juliana Kaminskajas zur Stimme Hölderlins in der Dichtung Friederike Mayröckers („Scardanelli“, 2007) und Gerhard Falkners („HÖLDERLIN REPARATUR“, 2008). Darin zeigt sie, dass mit der Freisetzung poetischer Kreativität auch das Subjekt zurückkehrt, wenngleich seine Erscheinungsformen indirekt, sublim und verborgen sein können. In diesem Prozess gestaltet sich das poetische Subjekt selbst: in imaginierten Stimmen und Personen auch historischen Ursprungs sowie dem Zusammenklingen in einem „Wir“, auch mit Bezug auf den realen Autor.
Mit der Fokussierung des „zuverlässig unzuverlässigen“ Subjekts unternimmt Matthias Fechner eine Exkursion in die lyrische Prosa von Gerhard Falkners Berlin-Roman „Apollokalypse“ (2016). Dabei stellt er, orientiert am Konzept des impliziten Autors, die Frage nach der demokratischen Verfasstheit des Subjekts im politisch motivierten Berlin-Roman von der Gründerzeit (Wilhelm Hegeler) bis zur unmittelbaren Gegenwart (Bude / Munk / Wieland).
Anschließend legt Hiroshi Yamamoto die poetischen Strategien der Dekonstruktion von Subjekt und Identität in den Essays und Gedichten von Monika Rinck frei. Insbesondere an ihrem Prosagedichtband „Honigprotokolle“ ←17 | 18→(2007), genauer: dem Gedicht „UNIO WIESEL“, demonstriert Yamamoto, wie die Subjektdekonstruktion mithilfe von Verfahren sprachlicher Zersetzung und Montage poetisch vollzogen wird. So verselbständigen sich etwa Silben und bringen neue, dem Wort fremde Bedeutungen in den Text hinein, oder es werden etymologische und fachsprachliche Bedeutungen oder semantische Konnotationen aufgerufen. Auch hier wird die Zersetzung gewohnter Grenzen als Entfaltung kreativen Potentials vorgeführt.
In ihrem zweiten Beitrag behandelt Juliana Kaminskaja Gedichte Arkadij Dragomoščenkos, den sie zwischen Lev Rubinštejn und Psoj Korolenko verortet. Dragomoščenko, der vor allem hermetische Gedichte veröffentlichte, positioniert sich in poetischer Selbsterkundung zwar am Rand der Gesellschaft, eröffnet seinen Rezipient*innen damit jedoch eine offenere Lesart, die umgekehrt auch deren Ich-Perspektive(n) zu stärken vermag. Diese wiederum vitalisiert das Ich als Stimme und Sprache des Gedichtes, als ein in der Kom-position verborgenes Textsubjekt.
Ein verwandtes Thema behandelt Hiroko Matsumoto in ihrem Beitrag über das exophone Schreiben bei Minae Mizumura und Yoko Tawada. Der in den Texten der beiden Schriftstellerinnen behandelte Raum ist nicht geographisch, sondern kulturell definiert. Tawada integriert die Veränderung ihres lyrischen Subjektes gezielt in die Sprache, offenbart einen inhaltlich und formal konstruktiven Prozess, der eurozentristische Perspektiven durch exophone Perspektiven hinterfragt. Tawadas erster Gedichtband, „Nur da wo du bist da ist nichts“ (1987) wurde deshalb bilingual – in Text und Layout – veröffentlicht und bildete damit bei Tawada den Auftakt eines poetischen Umgangs mit zwei Sprachen, die auf sehr menschliche Weise in einem gleichberechtigten, sich stets aufs Neue hinterfragenden Verhältnis stehen. Dies kontrastiert Matsumoto mit Mizumuras oben erwähntem bilingualem Ich-Roman „Shishoshetsu from left to right“, der eng an die Biographie der Autorin angelehnt ist. Darin wird die Geschichte des Scheiterns eines Subjekts zwischen der nordamerikanischen und der japanischen Kultur aufgerollt. Die Lösung in diesem bilingualen Roman, der erst 26 Jahre nach der japanischen Erstveröffentlichung in einem amerikanischen Verlag erschienen ist,17 besteht am Ende in der Rückwendung zur japanischen Kultur.
Miho Matsunaga ergänzt den vorangehenden Beitrag mit einer ebenso konzisen wie präzisen Studie zum lyrischen Ich in Yoko Tawadas japanischsprachigem Gedichtband „Die Leiche des Regenschirms und meine Frau“ [「傘の死体とわたしの妻」] (2006). Matsunaga – die Tawada auch durch ihre ←18 | 19→gemeinsame Tätigkeit an der Waseda Universität kennt18 – konzentriert sich dabei auf eine textimmanente Lesart, welche vor allem die Rolle der Personal-pronomina im Gedicht erschließt. Konkret wird dabei ihre Bedeutung bei der Darstellung des Weges zweier Frauen in eine Ehe behandelt; wobei Matsunaga dabei die Rolle des von der Autorin bewusst experimentell gestalteten Subjekts freilegt.
Huiru Liu nimmt in seinem Beitrag Maurice Merleau-Pontys „Phänomenologie der Wahrnehmung“ (1966) als Hintergrund für einen Vergleich, der allenfalls nach der Lektüre der ersten Sätze noch als ungewöhnlich erscheinen mag. Wie behandelt der vielleicht größte chinesische Dichter, Du Fu, „die symbiotische Beziehung zwischen Körper und Sprache“? Und wie wird dieses Verhältnis bei Xiaoqiong Zheng dargestellt, der lyrischen Stimme des Millionenheeres der Wanderarbeiterinnen in China? Die Konzentration in der Darstellung und der poetische Umgang mit dem Raum verbinden, so Liu, auf unterschiedliche Weise die Verse der beiden konträren Dichterpersönlichkeiten. In beiden Fällen gewinnt die Sprache dabei eine physische, korporeale Qualität, die ein tieferes Verständnis der dargebotenen Vorgänge ermöglicht.
Schließlich unternimmt Noha Abdelrassoul einen Exkurs in die arabischsprachige Lyrik der Gegenwart, mit einer analytischen Würdigung der feministischen Dichtung Iman Mersals. „Ich bin, was davon übrig bleibt“, zitiert sie die Dichterin bereits ebenso programmatisch wie ambigue im Titel. Was übrig bleibt: Nicht ganz das Gegenteil eines erfüllten Lebens, aber im Bewusstsein nicht gelebter Möglichkeiten vor allem Zorn über männliche Unzulänglichkeit, Willkür, Gewalt. Kontrastiert wird diese Gestaltung mit einem nüchternen Blick auf das eigene Unvermögen, sich außerhalb der patriarchalen Poetik zu bewegen.
Literatur
Barthes, R. (2007): Der Tod des Autors [1967/68]. In: Jannidis, Fotis u.a. (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart. 185-193.
Baumgartner, H. (1994): Welches Subjekt ist verschwunden? Einige Distinktionen zum
Begriff der Subjektivität. In: Schrödter, H. (Hg.): Das Verschwinden des Subjekts. Würzburg. 19-28.
Beck, E. (1991): Identität der Person. Sozialphilosophische Studien zu Kierkegaard, Adorno und Habermas. Würzburg.
Bishop, C. (ed., 2006): Participation. London / Cambridge (USA).
Bürger, P. (1998): Das Verschwinden des Subjekts. Eine Geschichte der Subjektivität von Montaigne bis Barthes. In: Bürger, Ch. / Bürger, P.: Das Verschwinden des Subjekts. ←19 | 20→Das Denken des Lebens. Fragmente einer Geschichte der Subjektivität. Frankfurt a.M. 9-254.
Foucault, M. (2001): L’Herméneutique du sujet (Transcriptions des cours au Collège de France. 1981–1982). Paris.
Hagenbüchle, R. (1998): Subjektivität: Eine historisch-systematische Einführung. In: Fetz, R. L. / Hagenbüchle, R. / Schulz, P. (Hg.): Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität. 2 Bde. Berlin. Bd. 1. 1-88.
Leitch, V. (2014): Literary Criticism in the 21st Century. Theory Renaissance. New York. Mizumura, M. (2004): Authoring Shishosetsu from left to right. In: 91st Meridian. 3.2 Winter 2004. https://iwp.uiowa.edu/91st/vol3-num2/authoring-shishosetsu-from-left-to-right (17/07/2020).
Reckwitz, A. (2021): Subjekt. 4., aktualisierte und ergänzte Aufl. Bielefeld.
Robbe-Grillet, A. (1966): Trans-Europ-Express. Film. Paris.
Zima, P. V. (2017): Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität zwischen Moderne und Postmoderne. 4., durchgesehene und erweiterte Aufl. Tübingen.
1 Hagenbüchle (1998, S. 24).
Details
- Seiten
- 432
- Jahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631883136
- ISBN (ePUB)
- 9783631883143
- ISBN (Paperback)
- 9783631882832
- DOI
- 10.3726/b19886
- Open Access
- CC-BY
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (Juli)
- Schlagworte
- Ich Poesie Diskurs Transformation Veränderung
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 432 S., 16 farb. Abb., 8 s/w Abb.