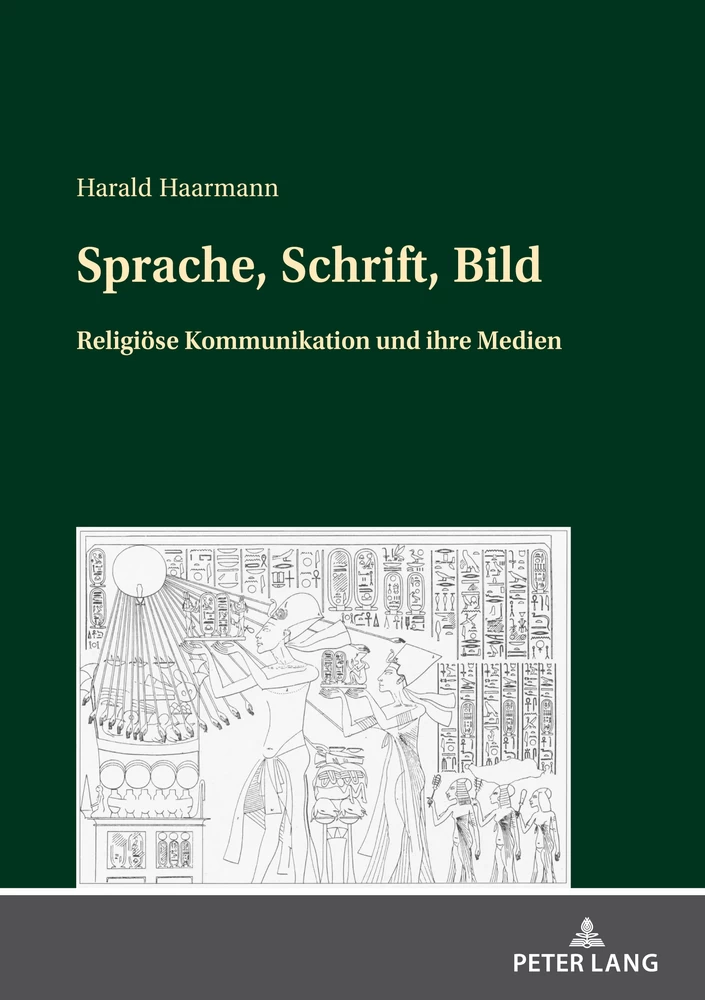Sprache, Schrift, Bild
Religiöse Kommunikation und ihre Medien
Summary
Die Sphäre des Übersinnlichen erschließt sich über die Religion. Das Gemeinsame in allen Religionen ist deren weitgehend ähnlich strukturiertes Fundament. Und der Baustoff dieses Fundaments ist Spiritualität. Sprache, Schrift und Bilder, diese wichtigen Komponenten zum Aufbau von Kultur, werden für die religiöse Kommunikation eingesetzt und in Riten und Ritualen aktiviert.
In dieser Studie werden die Umrisse für eine Urgeschichte der Transzendenz skizziert, respektive für eine anthropologische Konstante in allen Kulturen.
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Sprache, Schrift und Bild im Spiegel religiöser Kommunikation
- Teil 1: Heilige Zeichen und Bilder – Zum Verhältnis von kultureller Begriffsbildung und Spiritualität
- Kommunikation mit dem Übersinnlichen als anthropologische Konstante
- Lall-Kommunikation
- Tabusprache
- Magie der Sprachlaute
- Ritualsprache
- Schrift als Medium religiöser Weltanschauung
- Alphabetschriften im Dienst der Religion
- Fluktuationen des Realitätsbegriffs in der Kommunikation mit dem Übersinnlichen
- Teil 2: Spirituelle Kommunikation in Einzelskizzen – Schamanistische Rituale, das Wirken der Geister in der mythologischen Überlieferung, Heldenkult und göttliches Patronat, Errungenschaften früher Zivilisationen und ihre spirituell-religiöse Einbindung, Vorstellungen vom göttlich inspirierten Gewohnheitsrecht in der Antike, Gottheiten als Staatsikone im Rahmen der politischen Theologie, metaphysische Philosophie, spirituell motivierte Kunstästhetik usw.
- 1. Hatten die Frühmenschen totemistische Vorstellungen und praktizierten sie animistische Rituale?
- 2. Figurinen und Ritualwesen – Zur Langzeitwirkung spiritueller Vorstellungen
- 3. Sonne, Bär und Adler – Zur heiligen Trinität in der Mythologie eurasischer Völker
- 4. Der Gott des Lichts und die Welt seiner Bilder – Echnaton und Nofretete an der Wiege des Monotheismus
- 5. Dort wo der Name Gottes nicht verlautet werden darf – Die Tabuisierung des Gottesnamens im Hebräischen
- 6. Kommunikation mit den vergöttlichten Ahnen – Die Orakelinschriften Altchinas
- 7. Präzision zum Ausdruck von Heiligkeit – Zur Interaktion von buddhistischer Gestik und religiösem Sprachgebrauch in Südostasien
- 8. Auch das Holz hat eine Seele – Die spirituelle Dimension der Holzschnitzerkunst in Malaysia
- 9. Wie viele Namen haben die Geister? Die Gemeinschaft der Kachina bei den Hopi
- 10. Die geheime Kraft von Huna – Sondersprache und Ritualwesen der Schamanen von Hawai’i
- 11. Skarifikation als rituelle Handlung – Symbolisch-spirituelle Inhalte von Narbenmustern
- 12. Initiationsriten und Kommunikation mit pastoralen Göttern – Der soziokulturelle Nischenplatz der Maasai-Krieger
- 13. Spiritualität und Religiosität im Verbund – Synkretistische Traditionen bei den Swahili in Ostafrika
- 14. Die Orakelstätte von Delphi und ihre Rolle für die spirituelle Verankerung von Rechtstradition
- 15. Wer webte die ersten Textilien und wer baute die ersten Schiffe? Zivilisatorische Errungenschaften und die spirituelle Verbrämung von deren Entstehung
- 16. Politische Theologie in der Antike – Zur Rolle der Göttin Athene als Ikone des Athener Staatskults
- 17. Heldenkult und göttliches Patronat – Anatomie einer Institution der westlichen Zivilisation
- 18. Von ritueller Performanz zur Bühnenshow – Die spirituellen Ursprünge des Theaterwesens
- 19. Platons Kommunikation mit den griechischen Göttinnen – Spiritueller Wortschatz in der philosophischen Terminologie platonischer Dialoge
- 20. Das klassisch-griechische Schönheitsideal und seine spirituelle Verankerung in der darstellenden Kunst – Platons Beitrag zur Essenz des Schönen
- Bibliographie zu Einleitung & Teil 1
- Bibliographie zu Teil 2
- Abbildungen
- Appendix: Erwähnungen der Göttin Athene in der Odyssee (George 1999)
Einleitung: Sprache, Schrift und Bild im Spiegel religiöser Kommunikation
„Um über alle geheime Sympathie, oder gar magische Wirkung, vorweg zu lächeln, muss man die Welt gar sehr, ja ganz und gar begreiflich finden. Das kann man aber nur, wenn man mit überaus flachem Blick in sie hineinschaut, der keine Ahnung davon belässt, dass wir in ein Meer von Rätseln und Unbegreiflichkeiten versenkt sind und unmittelbar weder die Dinge, noch uns selbst, von Grund aus kennen und verstehen.“
(Arthur Schopenhauer 1788–1860; [1854] 1989/III: 434)
Die Vorstellung, dass wir Menschen mit all unserem Tun ganz allein auf uns selbst gestellt sind und keine Instanz auf irgendeiner höheren Ebene auf unsere Geschicke einwirkt, ist vom Standpunkt der Geschichte der menschlichen Evolution und kognitiver Begriffsbildung recht „jung“. Die längste Zeit während der Kulturgeschichte haben Menschen Vorstellungen von „Parallelwelten“ gepflegt, von einer diesseitigen Sphäre, und von einer Sphäre, die von übersinnlichen Gestalten bevölkert ist. Jedenfalls sind sich die Forscher weitgehend einig, dass den Menschen der Steinzeit radikale Vorstellungen unbekannt waren, wonach es keine übersinnliche Sphäre gäbe.
„Wenn Menschen des Neolithikums gefragt würden, ein Schema ihres Kosmos zu zeichnen – angenommen, sie würden verstehen, was die Frage bedeutet – würden sie wahrscheinlich den Platz angeben, wo sie leben, die Orte, von wo Handäxte [Steinwerkzeuge] und andere fremde Objekte kamen, und die Plätze, wo übersinnliche Wesen alle nach den gleichen Konventionen [wie die Menschen] lebten.“ (Lewis-Williams / Pearce 2005: 255)
Spätestens aber seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurden Konzepte der Welt entwickelt, bei denen übersinnliche Dimensionen ausgeblendet bleiben. Diejenigen, die mit dem Übersinnlichen nichts anfangen können, sind die, deren Sinn für Reales festgemacht ist an den Prinzipien des naturwissenschaftlichen Weltbilds, wonach es nichts gibt, was nicht mit den Sinnen erfassbar ist oder mit technischen Mitteln gemessen werden kann. Aus einer solchen Perspektive erübrigt sich jede Frage nach einer möglichen übersinnlichen Instanz. Doch da sind die Anderen, und bei denen erweitert sich die Sinngebung für ←9 | 10→unser Leben als Menschen im organischen Ganzen der Welt in den Bereich der Kommunikation mit dem Übersinnlichen.
Die längste Zeit während ihrer kulturellen Entwicklung haben sich Menschen bemüht, mit übersinnlichen Instanzen – ob nun Geister oder Götter – zu kommunizieren, und sie haben solchen Instanzen in ihren Kulturen die unterschiedlichsten Namen gegeben. Bei dieser Kommunikation geht es darum, eine höhere Instanz dazu zu bewegen, den Menschen Impulse zu vermitteln, die es ihnen ermöglicht, das intentionale Handeln der Instanz – und sei es nur in Ansätzen – begreiflich zu machen. In die Kommunikation mit dem Übersinnlichen werden seit altersher Wünsche und Vorstellungen projiziert, die sich Menschen von der Bereitschaft der Instanz machen, den Menschen zu helfen. Andererseits sind die Menschen bemüht, die Wechselfälle ihrer irdischen Existenz verständlich und absehbar zu machen, denn Unglück wie Krankheiten und Katastrophen stellt man sich als Strafen Gottes vor. Es geht also seit altersher auch darum, die Instanz zu besänftigen, um ihren Unwillen zu meiden.
Von Anbeginn ihrer Geschichte haben Menschen ihre Kultur und ihre sozialen Netzwerke nicht allein mit dem Wissen und den Erfahrungswerten organisiert, die auf Eindrücken der realen Umwelt auf sie einwirkten. Von Anbeginn waren auch Vorstellungen über das Jenseits und übersinnliche Mächte im Spiel. Wenn hier Aussagen über Verhaltens- und Denkweisen der Menschen in prähistorischer Zeit getroffen werden, stellt sich die Frage, ob dies rein spekulativ bleibt, oder ob sich dafür Beweise finden lassen, die es ermöglichen, Vorstellungswelten vor langer, langer Zeit zu rekonstruieren? Worauf man sich stützen kann, sind Indizien, die die Schlussfolgerung nahelegen: der Mensch hat immer schon das Bedürfnis gespürt, sich mit übersinnlichen Phänomenen auseinander zu setzen.
Dem vorsokratischen Philosophen Protagoras aus dem 5. Jahrhundert v.u.Z. wird die Sentenz zugeschrieben: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“ Diese Feststellung ist in der Geschichte der Philosophie ganz allgemein falsch interpretiert worden, als ob Protagoras damit die Existenz von Gottheiten negiert. Wenn man die Sentenz im Kontext der Fragmente liest, die von diesem Philosophen erhalten sind, wird klar, dass Protagoras die Menschen im Licht der Begrenztheit ihrer intellektuellen Fähigkeiten betrachtet hat. Nach seiner Ansicht sind Menschen nicht in der Lage, das Denken und Handeln auf der höheren Ebene des göttlichen Intellekts zu begreifen.
Die Existenz und Wirkung einer göttlichen Intelligenz hat Protagoras durchaus anerkannt. Die Hervorhebung der menschlichen Begrenztheit im Ausspruch von Protagoras ist Ausdruck von dessen Bescheidenheit angesichts göttlicher Allgegenwart und Vernunft. Den Menschen bleibt in ihrer ←10 | 11→intellektuellen Begrenztheit keine andere Alternative als mit menschlichen Denkkategorien umzugehen (Haarmann 2015: 163).
Trotz ihrer Begrenztheit oder vielleicht gerade deswegen waren die Menschen seit jeher darum bemüht, die Intentionen der Instanzen auf der Ebene des Übersinnlichen zu ergründen, um deren Wohlwollen für sich zu erlangen. Dieses Bedürfnis, sich den Dingen in der Sphäre des Übersinnlichen zu nähern, ist sogar älter als die Geschichte des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens sapiens) und reicht zurück in die Lebenswelt des archaischen Menschen, des Neandertalers (archaischer Homo sapiens). Neuerdings ist auch bekannt, dass schon Vertreter älterer Hominidenspezies mit Vorstellungen im Umkreis des Übersinnlichen beschäftigt waren. Die Anfänge dessen, was man als Ritualwesen umschreiben kann, reichen sogar weit über die Ära der Neandertaler in die Geschichte der Hominiden zurück, in eine Zeit vor über 300 000 Jahren.
Damals bereits haben Vertreter des Frühmenschen (Homo heidelbergensis) Spuren eines Rituals hinterlassen, das im Zusammenhang mit der Jagd auf Wildpferde stand. Jagdmagie gehört zu den ältesten Formen der Interaktion mit dem Übersinnlichen, und schon die Jäger der Vorzeit haben sich bemüht, sich durch spezielle Rituale ihr Jagdglück zu sichern (s. Kapitel über totemistische Vorstellungen des Frühmenschen).
Die Existenz der Menschen stand zu allen Zeiten in Abhängigkeit vom Wirken der Naturkräfte und von den Auswirkungen ihres eigenen Tuns. Die Menschen der Frühzeit waren im Besonderen angewiesen auf ein Gleichgewicht ihrer Lebensbedingungen, auf günstige Umstände für ihr Überleben. Verletzungen, Krankheiten, Komplikationen bei der Kindesgeburt, Unwetter oder durch Klimawandel ausgelöste Umweltkatastrophen konnten verheerende Konsequenzen haben und das Leben nicht nur von Individuen sondern ganzer Gruppen gefährden.
Das Bewusstsein ihrer Verletzlichkeit hat sicher bereits die Frühmenschen veranlasst, ihre Hoffnungen und Ängste auf ihre Kommunikation mit übersinnlichen Kräften zu projizieren und mit Artefakten zu assoziieren, die symbolische Funktion übernehmen. Diese stellt man sich als Glücksbringer (Talismane) vor, oder ihnen wird eine magische Wirkung als schutzbietende Kraftquellen (Amuletts) zugesprochen. Talismane und Amuletts haben uns durch alle Perioden der Kulturgeschichte begleitet. Bereits der Neandertaler hat sich Halsketten aus Bärenkrallen oder Anhänger aus einer einzelnen Kralle umgehängt und dies sehr wahrscheinlich nicht (allein) wegen der Schmuckfunktion, sondern wegen der imaginären Schutzfunktion.←11 | 12→
Die Lebensgestaltung verlief über die Anwendung der Lehren, die die Vertreter der älteren Generation ihren Nachkommen mit auf den Weg gaben. Die nützlichen Lehren der Vorfahren waren unverzichtbar, und dieses wertvolle Gut verband sich mit den eigenen Erfahrungswerten, die ihrerseits als kollektives Erinnerungspaket an die nachfolgende Generation weitervermittelt wurde. Über die spirituelle Interaktion mit den verstorbenen Vorfahren entfaltete sich in vielen Kulturen eine Tradition, die von Anthropologen „Ahnenkult“ genannt wird.
Vorstellungen davon, dass die Vorfahren die Geschicke der Lebenden lenken, sind aus der Antike wohlbekannt, und die Interaktion mit den Ahnen hat sich bis heute erhalten. Dabei ist es unerheblich, welchen Entwicklungsstand eine Kultur erreicht hat. Ahnenverehrung findet man in traditionalen Kulturen ebenso wie in hochentwickelten Gesellschaften. Bei den Luba in Westafrika tragen Frauen eine weibliche Figurine an einer Halskette. Diese Figurine wird bei bestimmten Anlässen rituell gesalbt und die Besitzerin kommuniziert mit einer verehrten Ahnfrau, häufig die Sippengründerin (s. Kapitel über die spirituelle Rolle von Figurinen). In der postindustriellen Gesellschaft Japans hat sich die Gewohnheit erhalten, in Wohnungen oder Häusern einen Heimaltar einzurichten, an dem in regelmäßigen Abständen Rituale abgehalten werden, um die Ahnen zu ehren. In Altchina sind die Anfänge des Schriftgebrauchs ursächlich mit dem Ahnenkult assoziiert (s. Kapitel über die altchinesischen Orakelinschriften).
Die Auseinandersetzung mit dem Übersinnlichen hat in der Kulturgeschichte weite Kreise gezogen und ist auch in Bereichen zum Tragen gekommen, die wir allgemein nicht mit spirituell-religiöser Thematik in Verbindung bringen. In der Philosophie wurde ausgiebig über die Seele reflektiert und wie durch die Hinwendung zum Göttlichen Erlösung erreicht werden kann. So charakterisiert ist die metaphysische Philosophie Platons mit Anlehnung an die Begrifflichkeit der Mysterienkulte. Spirituelle Strömungen sind auch für das Image des Staatskults verantwortlich, wie etwa die Rolle der Göttin Athene als Ikone der Athener Demokratie (Haarmann 2020: 96 ff.).
Details
- Pages
- 248
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631869383
- ISBN (ePUB)
- 9783631869390
- ISBN (Softcover)
- 9783631855348
- DOI
- 10.3726/b19205
- Language
- German
- Publication date
- 2022 (February)
- Keywords
- Interaktion Ritualsprache Sakralschrift Orakelinschriften Ahnenkult Schamanismus Totemismus Figurinenkunst
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 248 S., 48 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG