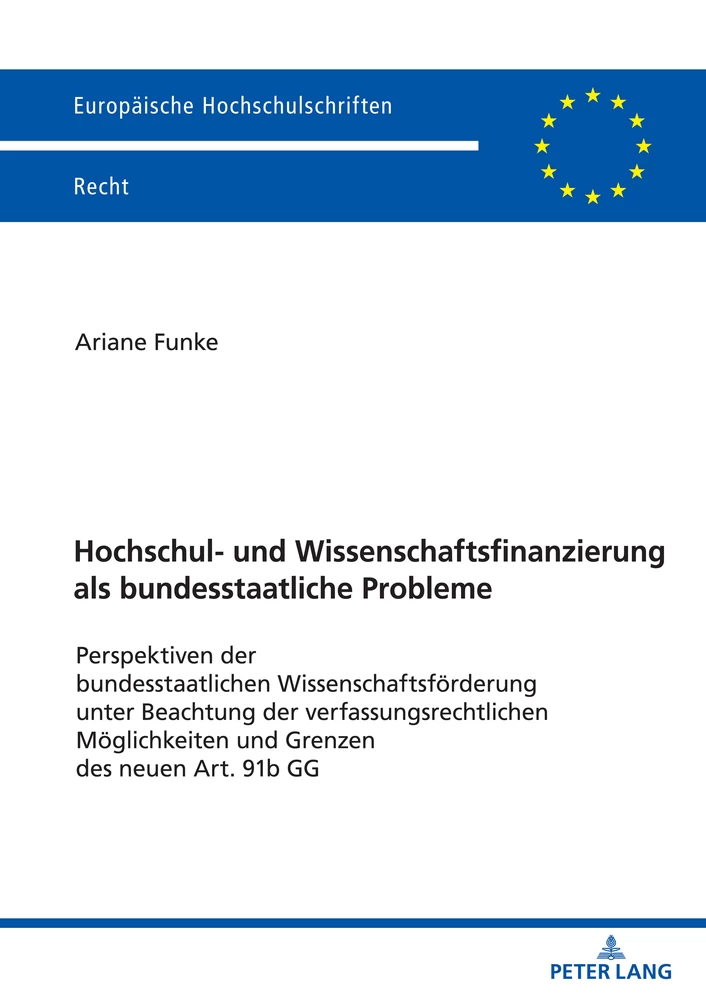Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung als bundesstaatliche Probleme
Perspektiven der bundesstaatlichen Wissenschaftsförderung unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen des neuen Art. 91b GG
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsübersicht
- A. Einleitung und Gang der Untersuchung
- I. Einleitung und Fragestellung
- II. Forschungsstand
- III. Wissenschaft und Wissenschaftsfinanzierung
- 1. Wissenschaft
- a) Forschung
- b) Lehre
- 2. Wissenschaftsfinanzierung
- IV. Ausgangspunkt und Gang der Untersuchung
- 1. Ausgangspunkt der Untersuchung
- 2. Gang der Untersuchung
- B. Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskompetenzen im Wissenschaftsbereich
- I. Grundlagen föderaler Zuständigkeitsverteilung
- II. Gesetzgebungskompetenzen des Bundes
- 1. Gesetzgebungskompetenzen vor der Föderalismusreform I
- a) Grundgesetz von 1949
- b) Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch die Finanzreform von 1969
- aa) Einführung der Rahmengesetzgebung für das Hochschulwesen in Art. 75 I 1 Nr. 1a GG (i.d.F. v. 1969)
- bb) Hochschulrahmengesetz
- cc) Einführung der Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Ausbildungsbeihilfen in Art. 72, 74 I Nr. 13 GG
- 2. Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch die Föderalismusreform I
- a) Aufhebung der Rahmengesetzgebungskompetenz
- b) Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes
- 3. Gesetzgebungskompetenzen nach der Föderalismusreform I
- a) Ausbildungsbeihilfen und Forschungsförderung – Art. 72, 74 I Nr. 13 GG
- aa) Ausbildungsbeihilfen – Art. 72, 74 I Nr. 13 Alt. 1 GG
- bb) Forschungsförderung – Art. 72, 74 I Nr. 13 Alt. 2 GG
- cc) Erforderlichkeit nach Art. 72 II GG
- dd) Verwaltungskompetenzen
- b) Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse – Art. 72, 74 I Nr. 33 GG
- aa) Hochschulzulassung – Art. 72, 74 I Nr. 33 Alt. 1 GG
- bb) Hochschulabschlüsse – Art. 72, 74 I Nr. 33 Alt. 2 GG
- cc) Abweichungsrecht der Länder nach Art. 72 III GG
- dd) Verwaltungskompetenz
- c) Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder – Art. 72, 74 I Nr. 27 Alt. 1 GG
- d) Ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen
- 4. Übergangsregelungen der Föderalismusreform I – Art. 125a, 125b GG
- a) Fortgeltung von Bundesrecht, das so nicht erlassen werden könnte – Art. 125a GG
- b) Fortgeltung von Bundesrecht im Bereich der Abweichungskompetenz – Art. 125b GG
- 5. Zusammenfassung und Bewertung
- III. Verwaltungskompetenzen des Bundes
- 1. Gesetzesakzessorische Verwaltung
- 2. „Gesetzesfreie“ Verwaltung
- a) Ungeschriebene Bundesverwaltungskompetenzen
- b) Ungeschriebene Bundesverwaltungskompetenz aus der Natur der Sache
- 3. Zusammenfassung und Bewertung
- IV. Finanzierungskompetenzen des Bundes
- 1. Bundesstaatliche Verteilung der Ausgabenverantwortung – Art. 104a I GG
- a) Entwicklungsgeschichte
- b) Konnexität von Aufgaben und Ausgabenverantwortung – Art. 104a I GG
- c) Ausnahmen vom Konnexitätsprinzip
- 2. Gemeinschaftsaufgaben bis 2015
- a) Begriff der Gemeinschaftsaufgaben
- b) Kooperation von Bund und Ländern von 1949–1969
- c) Kodifizierung der Gemeinschaftsaufgaben durch das Finanzreformgesetz von 1969
- d) Neuregelung durch die Föderalismusreform I von 2006
- 3. Gemeinschaftsaufgaben seit 2015
- a) Ausgangslage
- b) Neuregelung durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91b GG) vom 23. Dezember 2014
- aa) Stellung von Art. 91b GG im Verfassungsgefüge
- bb) Voraussetzungen des Zusammenwirkens
- (1) Vereinbarung
- (2) Beteiligungs- und Zustimmungserfordernisse – Art. 91b I 2 u. 3 GG
- (3) Überregionale Bedeutung
- (4) Zusammenwirken und Förderung
- cc) Gegenstände des Zusammenwirkens
- (1) Förderung außerhalb von Hochschulen – Art. 91b I 1 GG
- (2) Förderung an Hochschulen – Art. 91b I 1 und 2 GG
- (3) Förderung sog. Zwittereinrichtungen
- (4) Förderung von Forschungsbauten einschließlich Großgeräten
- (5) Allgemeiner Hochschulbau
- dd) Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens – Art. 91b II GG
- ee) Kostentragung – Art. 91b III GG
- c) Finanzwirtschaftliche Bedeutung von Art. 91b I GG
- d) Zusammenfassung
- 4. Kritik an den Gemeinschaftsaufgaben im Wissenschaftsbereich
- a) Kritik an der Neufassung von Art. 91b I GG
- b) Kritik am Gesetzgebungsverfahren
- c) Kritik an der Beschränkung der Reform auf den Wissenschaftsbereich
- d) Verflechtung als bundesstaatliches Problem
- aa) Verflechtung und das Demokratie- und Bundesstaatsprinzip in Art. 20 I, II GG
- bb) Rechtfertigung der Extension von Art. 91b I GG
- e) Zusammenfassung
- 5. Geldleistungsgesetze des Bundes – Art. 104a III GG
- a) Regelungsgehalt von Art. 104a III GG
- b) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- c) Zusammenfassung und Bewertung
- 6. Finanzhilfen des Bundes
- a) Bundesfinanzhilfen seit 1949
- b) Einführung von Art. 104a IV GG (i.d.F. v. 1969) durch das Finanzreformgesetz
- c) Neuregelung durch die Föderalismusreform I von 2006
- d) Neuregelung durch die Föderalismusreform II von 2009
- e) Neuregelungen 2017 und 2019
- f) Zusammenfassung und Bewertung
- 7. Ungeschriebene Finanzierungskompetenzen des Bundes
- 8. Zusammenfassung und Bewertung
- C. Kooperative Wissenschaftsförderung in der Staatspraxis
- I. Kooperationsgremien
- 1. Wissenschaftsrat
- a) Aufgaben
- b) Organisation
- c) Rechtsgrundlage
- d) Finanzierung
- 2. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK)
- a) Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)
- b) Gründung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz
- c) Aufgaben
- d) Organisation
- e) Gegenstand der gemeinsamen Förderung
- f) Finanzierung
- II. Gemeinsame Förderung von Hochschulen
- 1. Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie
- a) Exzellenzvereinbarung I (2006–2011)
- b) Exzellenzvereinbarung II (2011–2017)
- c) Exzellenzstrategie (seit 2017)
- d) Durchführung der Exzellenzinitiative und Exzellenzstrategie
- e) Rechtsgrundlagen und Verfassungsmäßigkeit
- aa) Rechtsgrundlagen
- bb) Gesetzesvorbehalt
- (1) Institutioneller Gesetzesvorbehalt
- (2) Grundrechtlicher Gesetzesvorbehalt und Vereinbarkeit mit Art. 5 III 1 Alt. 2 GG
- (3) Zwischenergebnis
- f) Zusammenfassung und Bewertung
- 2. Hochschulpakt 2020 und Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“
- a) Hochschulpakt I (2007–2010)
- b) Hochschulpakt II (2011–2015)
- c) Hochschulpakt III (2016–2023)
- d) Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ (ab 2021)
- e) DFG-Programmpauschalen
- f) Rechtsgrundlagen und Verfassungsmäßigkeit
- g) Zusammenfassung und Bewertung
- 3. Professorinnenprogramm
- a) Die ersten beiden Programmphasen (2008–2012 und 2013–2017)
- b) Professorinnenprogramm III (2018–2022)
- c) Rechtsgrundlagen und Verfassungsmäßigkeit
- d) Zusammenfassung und Bewertung
- 4. Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen
- a) Finanzierung
- b) Rechtsgrundlagen und Verfassungsmäßigkeit
- c) Zusammenfassung und Bewertung
- 5. Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“
- a) Durchführung und Finanzierung
- b) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- c) Zusammenfassung und Bewertung
- 6. Qualitätspakt Lehre und „Innovation in der Hochschullehre“
- a) Qualitätspakt Lehre (2011–2020)
- b) „Innovation in der Hochschullehre“ (ab 2021)
- c) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- d) Zusammenfassung und Bewertung
- 7. Qualitätsoffensive Lehrerbildung
- a) Förderverfahren und Finanzierung
- b) Anerkennung von Lehramtsabschlüssen und Studienleistungen
- c) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- d) Zusammenfassung und Bewertung
- 8. Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen
- a) Förderung nach der AV-FuG bis 2019
- aa) Fördergegenstand und -verfahren
- bb) Finanzierung
- cc) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- b) Förderung nach der AV-FGH seit 2019
- aa) Fördergegenstand und -verfahren
- bb) Finanzierung
- cc) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- c) Zusammenfassung und Stellungnahme
- 9. Förderinitiative „Innovative Hochschule“
- a) Förderverfahren
- b) Finanzierung
- c) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- d) Zusammenfassung und Bewertung
- 10. Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
- a) Förderverfahren und Finanzierung
- b) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- c) Zusammenfassung und Bewertung
- 11. Personalgewinnung und -entwicklung an Fachhochschulen
- a) Förderverfahren und Finanzierung
- b) Rechtsgrundlage und Verfassungsmäßigkeit
- c) Zusammenfassung und Bewertung
- 12. Gemeinsame Förderung von Hochschulen im Überblick
- 13. Zusammenfassung und Bewertung
- III. Gemeinsame Förderung von außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen
- 1. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- a) Zweck
- b) Förderprogramme der DFG
- c) Finanzierung und ihre Rechtsgrundlage
- 2. Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)
- a) Zweck
- b) Finanzierung und ihre Rechtsgrundlage
- 3. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG)
- a) Zweck
- b) Finanzierung und ihre Rechtsgrundlage
- 4. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)
- a) Zweck
- b) Finanzierung und ihre Rechtsgrundlage
- 5. Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL)
- a) Zweck
- b) Finanzierung und ihre Rechtsgrundlage
- 6. Förderung sonstiger außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen im Rahmen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz
- 7. Gesetzesvorbehalt
- a) Institutioneller Gesetzesvorbehalt
- b) Grundrechtlicher Gesetzesvorbehalt und Vereinbarkeit mit Art. 5 III 1 Alt. 2 GG
- 8. Pakt für Forschung und Innovation
- a) Pakt für Forschung und Innovation I (2005–2010)
- b) Pakt für Forschung und Innovation II (2011–2015)
- c) Pakt für Forschung und Innovation III (2016–2020)
- d) Pakt für Forschung und Innovation IV (2021–2030)
- e) Rechtsgrundlagen und Verfassungsmäßigkeit
- f) Zusammenfassung und Bewertung
- 9. Gemeinsame Förderung von außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen im Überblick
- 10. Wissenschaftsfreiheitsgesetz – WissFG
- 11. Zusammenfassung und Bewertung
- D. Reformperspektiven der bundesstaatlichen Wissenschaftsfinanzierung
- I. Status quo – de constitutione lata
- 1. Reformoptionen des Bundes
- a) Gemeinschaftsaufgaben – Art. 91b GG
- b) Finanzhilfen des Bundes – Art. 104b I GG
- c) Kompetenzen des Bundes kraft Natur der Sache
- d) Neuregelung der Umsatzsteuerverteilung – Art. 106 III 4, IV GG
- 2. Reformoptionen der Länder
- a) Umverteilung der Länderausgaben zugunsten der Hochschulen
- b) Einführung allgemeiner Studiengebühren
- c) Einführung einer nachgelagerten Akademikerabgabe
- 3. Zusammenfassung und Bewertung
- II. Verfassungsänderungen – de constitutione ferenda
- 1. Reformen im Rahmen der bestehenden bundesstaatlichen Aufgaben- und Finanzierungskompetenzen
- a) Erneute Reform von Art. 91b GG
- b) Lockerung des Neuverschuldungsverbots in Art. 109 III 1 u. 5 GG für Bildungsinvestitionen
- 2. Grundlegende Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
- a) Einführung einer eigenständigen Gemeinschaftsaufgabe Bildung
- b) Streichung von Art. 91b GG
- c) Streichung von Art. 107 II 6 Alt. 2 GG
- 3. Zusammenfassung und Bewertung
- III. Kombination verschiedener Reformoptionen
- E. Fazit und Ausblick
- Anhang: Synopse von Art. 91b GG
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
A. Einleitung und Gang der Untersuchung
I. Einleitung und Fragestellung
Wissenschaft und Forschung werden bereits seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 als vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht von Art. 5 III 1 Alt. 2 GG geschützt. Sie sind hierzulande die wichtigsten Rohstoffe und gelten laut Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aus dem Jahr 2018 als „die Schlüsselthemen für Deutschlands Zukunft“.1 Hinsichtlich ihrer Finanzierung stellt Werner Thieme zu Recht lapidar fest: „Die moderne Wissenschaft benötigt sehr viel Geld. Wissenschaft kann daher nur erfolgreich betrieben werden, wenn der Hochschule genügend Geld zur Verfügung gestellt wird.“2 Die Finanzierung des deutschen Wissenschaftssystems ist wesentlich durch das föderale System der Bundesrepublik Deutschland geprägt.3 Traditionell zuständig für die Finanzierung der Bereiche Wissenschaft und Forschung sind in Deutschland grundsätzlich die Länder. Die Länder hatten in der jüngeren Vergangenheit jedoch zunehmend Schwierigkeiten eine ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen zu gewährleisten. Ursache hierfür ist neben der schwierigen Finanzlange einiger Länder sowie der Einführung des Neuverschuldungsverbots in Art. 109 III GG insbesondere das steigende Bildungsbedürfnis in der Bevölkerung, welches beträchtliche Investitionen in die Kapazitäten der Hochschulen erforderlich machte. So ist die Anzahl der Studierenden mit derzeit etwa 2,9 Mio.4 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In den letzten 19 Jahren ist die Studierendenanzahl um ca. 37 % gestiegen.5 Doppelte Abiturjahrgänge6 und die ←19 | 20→Aussetzung der Wehrpflicht sowie des Wehrersatzdienstes7 sorgten zudem in den letzten Jahren für einen zusätzlichen Anstieg der Studienanfängerinnen- und Studienanfängerzahlen. So zählt das Studienjahr 2018 nach ersten vorläufigen Ergebnissen 508.828 neue Studienanfängerinnen und -anfänger.8 Gegenüber dem Studienjahr 2000 ist hier ein Zuwachs von etwa 38 % zu verzeichnen.9 Auch für das Studienjahr 2020 werden nach Schätzungen noch 443.300 Studienanfängerinnen und -anfänger erwartet.10 Ferner stieg auch die Studienanfängerinnen- und Studienanfängerquote11 auf zuletzt rund 56 % im Studienjahr 2018.12 Damit die Länder dennoch ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Studienangebot schaffen konnten, unterstützte sie der Bund im Rahmen des Hochschulpaktes 202013 in den letzten Jahren ←20 | 21→mit milliardenschweren befristeten Fördermitteln. Die Hochschulen waren zur Finanzierung ihrer ständigen Aufgaben angesichts der unzureichenden Grundfinanzierung durch ihre Träger zunehmend auf diese befristeten Projektmittel des Bundes angewiesen und so wurde der Ruf nach einer systematischeren Beteiligung des Bundes an der Hochschulfinanzierung in jüngerer Zeit immer lauter.14 Die Fördermittel des Hochschulpaktes laufen Ende 2020 mit seiner letzten Programmphase aus. Die Studiennachfrage in Deutschland ist hingegen weiter anhaltend hoch,15 sodass die Bundesregierung eine Fortsetzung des Hochschulpaktes als unverzichtbar ansah.16 Mit dem Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“17 haben Bund und Länder am 6. Juni 2019 nunmehr ein Nachfolgeprogramm für den Hochschulpakt 2020 abgeschlossen. Im Rahmen dieses Zukunftsvertrages wird der Bund die Länder bei der Hochschulfinanzierung ab 2021 unbefristet unterstützen. Die jährlichen Fördermittel des Bundes werden hierbei zunächst etwa 1,88 Mrd. Euro betragen. Ab dem Jahr 2024 belaufen sich die Bundesmittel sodann auf ca. 2,05 Mrd. Euro pro Jahr. Mit dem Zukunftsvertrag steigt der Bund somit dauerhaft in die Finanzierung der Hochschulen ein. Dies ist angesichts der grundsätzlichen Finanzierungskompetenz der Länder im Wissenschaftsbereich bemerkenswert und es ist fraglich, auf welche Kompetenzen der Bund seine umfangreichen Fördertätigkeiten auch über den Zukunftsvertrag hinaus stützt. Ferner erstaunen Bund-Länder-Mischfinanzierungen im deutschen Bundesstaat als solche im Hinblick auf ←21 | 22→den Grundsatz der getrennten Aufgaben- und Ausgabenwahrnehmung in Art. 104a I GG, wonach entweder die Länder oder der Bund für eine Aufgabe sowie für deren Finanzierung zuständig sind bzw. ist. Die bundesstaatliche Kompetenzverteilung im Wissenschaftsbereich ist jedoch ein Paradebeispiel für zahlreiche Politik- und Finanzverflechtungen, die diesen Grundsatz der getrennten Aufgaben- und Ausgabenwahrnehmung durchbrechen und von einem kooperativen Föderalismusverständnis zeugen.
Die Ausgestaltung der Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskompetenzen im Wissenschaftsbereich war dabei seit 1949 immer wieder Gegenstand von Diskussionen und Reformen. Insbesondere die Finanzreform von 196918 und die Föderalismusreform I im Jahr 200619 führten zu erheblichen Umgestaltungen der für die Wissenschaftsfinanzierung relevanten Grundgesetznormen. Zuletzt geriet schließlich Art. 91b GG in den Fokus des rechtspolitischen Diskurses. Einstimmig stimmte der Bundesrat im Dezember 2014 dem Gesetzentwurf der Bundesregierung20 zur Änderung von Art. 91b GG zu,21 den der Bundestag zuvor mit Zweidrittelmehrheit beschlossen hatte. Anschließend wurde die Grundgesetzänderung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet.22 Die novellierte Fassung von Art. 91b GG trat sodann mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft. Diese Verfassungsänderung stellt eine der neuesten und bedeutendsten Entwicklungen des Jahrzehnte lang andauernden Streits zwischen Bund und Ländern um die Zuständigkeiten im Wissenschaftsbereich dar. Die im Zuge dieser Reform novellierte Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung in Art. 91b GG ist zugleich die zentrale Norm für das umfassende Zusammenwirken von Bund und Ländern im Wissenschaftsbereich. Bereits das Finanzvolumen der auf Art. 91b GG gestützten Fördermaßnahmen zeugt von der überragenden Bedeutung der Norm für die Wissenschaftsfinanzierung. Allein im Rahmen der am 6. Juni 2019 zeitgleich abgeschlossenen Vereinbarungen ←22 | 23→des Zukunftsvertrages, der „Innovation in der Hochschullehre“23 und des Pakts für Forschung und Innovation IV24 fließen im Zeitraum von 2021 bis 2030 insgesamt 58,5 Mrd. Euro von Bund und Ländern zusammen in die Hochschulen, in die Forschungsförderungseinrichtung der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie in die vier großen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund wird der Frage nachgegangen, welche Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskompetenzen der Bund im Wissenschaftsbereich hat. Dabei wird insbesondere untersucht, welche Möglichkeiten und Grenzen der reformierte Art. 91b GG für die gemeinsame Wissenschaftsfinanzierung im deutschen Bundesstaat bietet. Damit dies gelingen kann, ist insbesondere auf die grundsätzlichen Defizite bundesstaatlicher Aufgaben- und Finanzverflechtung einzugehen. Zwar bestehen gegen Mischfinanzierungen in der rechtswissenschaftlichen Literatur weitgehend übereinstimmende verfassungspolitische Bedenken.25 Welche verfassungsrechtlichen Konsequenzen hieraus für die Gestaltung der bundesstaatlichen Wissenschaftsfinanzierung zu ziehen sind, wird jedoch uneinheitlich beantwortet. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend ist zu prüfen, inwiefern sich die 2014 erfolgte Ausdehnung von Art. 91b I GG angesichts des Ausnahmecharakters der Vorschrift im Grundgesetz sowie der verfassungsrechtlich grundsätzlich gebotenen bundesstaatlichen Entflechtung von Aufgaben- und Finanzierungszuständigkeiten rechtfertigen lässt.
Mit Blick auf den kooperativen Föderalismus in der Staatspraxis ist zu untersuchen, in welcher Form, in welchem Umfang und zu welchem Zweck Bund und Länder bislang von den Kooperationsmöglichkeiten in Art. 91b GG Gebrauch ←23 | 24→gemacht haben und inwiefern dabei die tatbestandlichen Grenzen der Verfassungsnorm eingehalten wurden. Es wird dabei festzustellen sein, dass die Beteiligung des Bundes an der Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung vor der jüngsten Reform von Art. 91b GG – so viel kann vorweggenommen werden – nicht immer ausreichend von der Verfassung gedeckt war. Gerichtlich überprüft wurde diese teils verfassungswidrige Praxis jedoch so gut wie nie,26 da letztlich alle Beteiligten mit dem Fluss der Bundesmittel grundsätzlich zufrieden waren. Zu untersuchen ist in diesem Kontext zudem, inwieweit die Kooperationspraxis von Bund und Ländern seit der Reform von Art. 91b I GG nun verfassungsrechtlich abgedeckt ist. Vor dem Hintergrund des Grundsatzes vom Vorbehalt des Gesetzes ist darüber hinaus zu analysieren, inwieweit das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip in Art. 20 I, II GG bzw. die Kompetenzen der Parlamente von Bund und Ländern im Rahmen des bundesstaatlichen Zusammenwirkens auf der Grundlage von Art. 91b I GG im Hochschul- und Wissenschaftsbereich beschnitten werden. Ferner gilt es zu klären, ob die vom verfassungsändernden Gesetzgeber bezweckte Stärkung der Grundfinanzierung der Hochschulen sowie Schaffung verlässlicher Perspektiven und Planungssicherheit für die Hochschulen27 mit der Reform von Art. 91b GG erreicht wurden. Abschließend ist der Frage nachzugehen, ob weiterhin Reformbedarf hinsichtlich der bundesstaatlichen Wissenschaftsfinanzierung besteht und welche Reformperspektiven sich gegebenenfalls anbieten.
←24 | 25→II. Forschungsstand
Der Stand der Forschung zu der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung in Art. 91b GG ist differenziert zu bewerten. Einerseits existiert durchaus umfangreiche Kommentarliteratur zum neuen Art. 91b GG, andererseits findet sich zur dieser Norm seit ihrer letzten Reform jedoch nur wenig umfangreicher rechtswissenschaftlicher Diskurs. Eine eingehende rechtswissenschaftliche Diskussion zu den Gemeinschaftsaufgaben allgemein bestand hingegen vor allem zur Zeit ihrer Einfügung in das Grundgesetz durch die Finanzreform von 1969. Im Zuge der Kodifizierung der Gemeinschaftsaufgaben entstand hier eine Fülle von Publikationen.28 Mit einiger zeitlicher Zäsur setzt sich überdies die 1991 erschienene Monografie „Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern im Hochschulbereich – Texte mit Einführungen und Hinweisen“29 zusammengestellt von Klaus Faber, Ludwig Gieseke, Christof ←25 | 26→Gramm und Mechthild Wesseler mit den Gemeinschaftsaufgaben explizit im Hochschulbereich auseinander, die im Jahr 1998 neu bearbeitet bereits in der dritten Auflage30 von Wolfgang Mönikes, Klaus Faber und Ludwig Gieseke herausgegeben wurde und Vereinbarungen und Abkommen zusammenfasst, die die Grundlage für das hochschulpolitische Zusammenwirken von Bund und Ländern in der Bundesrepublik Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990 bilden.
Im Zuge der Föderalismusreform I im Jahr 2006 flammte die rechtswissenschaftliche Diskussion über die Gemeinschaftsaufgaben erneut auf und es entstand unter anderem die im Jahr 2010 von Margrit Seckelmann, Stefan Lange und Thomas Horstmann herausgegebene Monografie „Die Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern in der Wissenschafts- und Bildungspolitik: Analysen und Erfahrungen“31, die die Gemeinschaftsaufgaben im Wissenschaftsbereich zum Inhalt hat und einen umfassenden Überblick zu diesem Thema gibt. Aufgrund der zeitlichen Diskrepanz wird die jüngste Reform von Art. 91b GG aus dem Jahr 2014 allerdings nicht behandelt. Rechtswissenschaftlich umfassend untersucht darüber hinaus die Dissertation „Wissenschaftsförderung nach der Reform des Föderalismus“32 von Oliver Jauch aus dem Jahr 2013 die Auswirkungen der Föderalismusreform I auf den Bereich des Wissenschafts- und Hochschulrechts. Aufgrund des zeitlichen Abstands setzt sie sich jedoch ebenfalls nicht mit der 2014 reformierten Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung auseinander und berücksichtigt dementsprechend auch nicht die neuesten Entwicklungen des kooperativen Föderalismus in der Staatspraxis seit 2015.
Die 2015 erschienene Dissertation „Die Exzellenzinitiative von Bund und Ländern auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand. Zuständigkeiten, Grundrechte und Rechtsschutz“33 von Christian Marzlin thematisiert eingehend die von Bund und Ländern auf der Grundlage von Art. 91b GG abgeschlossene Exzellenzinitiative. Dabei konzentriert sich die Arbeit mit der verfassungsrechtlichen Untersuchung der Exzellenzinitiative allerdings ausschließlich auf ein ←26 | 27→Einzelvorhaben aus dem weiten Bereich der gemeinsamen Wissenschaftsförderung. Überdies beschäftigt sie sich aufgrund der zeitlichen Diskrepanz nicht mit der auf der Grundlage des 2014 reformierten Art. 91b GG abgeschlossenen Exzellenzstrategie. Als umfängliche Monografie erschien 2016 die Dissertation „Der deutsche Wissenschaftsföderalismus auf dem Prüfstand – der neue Art. 91b Abs. 1 GG“34 von Guido Speiser, die sich erstmals detailliert mit dem neuen Art. 91b GG in Form einer klassischen Normexegese beschäftigt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine rechtswissenschaftliche, sondern eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung, die schwerpunktmäßig darauf abzielt, ein Erklärungsmuster für die vielfachen Normänderungen von Art. 91b GG zu identifizieren. Eine ausführliche Betrachtung und verfassungsrechtliche Würdigung der kooperativen Wissenschaftsförderung in der Staatspraxis vor und nach der jüngsten Reform von Art. 91b GG unterbleibt dabei allerdings. Ferner findet keine Auseinandersetzung mit der zentralen Problematik der Anforderungen des allgemeinen Grundsatzes des Vorbehalts des Gesetzes an die gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern statt. Überdies finden aufgrund des zeitlichen Abstands die neuesten verfassungsrechtlichen Schöpfungen im Bildungsbereich sowie die jüngsten Entwicklungen der kooperativen Wissenschaftsförderung in der Staatspraxis keinerlei Berücksichtigung. Hinsichtlich möglicher Reformperspektiven der bundesstaatlichen Wissenschaftsfinanzierung bleibt der Autor im Übrigen äußerst vage.
In der zweiten Auflage erschien im Jahr 2019 ferner die Monografie „Aufgaben und Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen ab 2020“35 von Hans-Günter Henneke, welche sich eingehend mit den finanzverfassungsrechtlichen Reformen aus den Jahren 2017 und 2019 kritisch befasst und diese in das Gesamtsystem der Finanzverfassung einordnet. Dabei setzt sie sich zudem mit der jüngsten Reform von Art. 91b GG sowie der bundesstaatlichen Mischverwaltung im Allgemeinen auseinander. Im Jahr 2020 erschien weiterhin die politikwissenschaftliche Dissertation „Kooperative Wissenschaftspolitik – Verhandlungen und Einfluss in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern“36 von Patrick Hintze, die die wissenschaftspolitischen Akteure und Verhandlungsprozesse von Bund, Ländern und Wissenschaft behandelt.
←27 | 28→Darüber hinaus sind seit 1970 mehrere rechtswissenschaftliche Beiträge zu den Gemeinschaftsaufgaben37 und ihrer Verflechtungsproblematik38 einerseits sowie zu dem reformierten Art. 91b GG39 andererseits erschienen.
III. Wissenschaft und Wissenschaftsfinanzierung
„Wissenschaft“ und „Wissenschaftsfinanzierung“ sind zentrale Begriffe dieser Untersuchung und stehen in enger Beziehung zu den Begriffen „Forschung“ und „Lehre“ sowie „Hochschulfinanzierung“. Sie werden in der rechtswissenschaftlichen Literatur häufig gemeinsam oder synonym verwendet.40 Nachfolgend ist daher der Bedeutungsgehalt der in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Begrifflichkeiten zu bestimmen.
1. Wissenschaft
Der Rechtsbegriff der Wissenschaft findet sich in der Verfassung in Art. 5 III 1 Alt. 2 GG, Art. 74 I Nr. 13 Alt. 2 GG sowie im 2014 neu gefassten Art. 91b I 1 GG. Er bildet hier jeweils den Oberbegriff für die Begriffe der Forschung und Lehre und grenzt diese näher ein.41 Im verfassungsrechtlichen Sinne ist der Begriff der Wissenschaft nicht unumstritten. Was Wissenschaft ist, wird maßgeblich außerrechtlich bestimmt und stellt einen eigengesetzlich ←28 | 29→bestimmten Lebenssachverhalt dar.42 Dennoch besteht kein Definitionsverbot, sondern ein Definitionsgebot.43 Die Definition von Wissenschaft muss aber aufgrund der Offenheit und Unabgeschlossenheit des Lebenssachverhalts auch selbst weitgehend offen bleiben.44 Ob die Drittanerkennung durch andere Wissenschaftler bei der Begriffsbestimmung eine Rolle spielt, ist umstritten,45 sie ist aber jedenfalls nicht ohne jede Bedeutung.46 Das bloße Behaupten, man betreibe Wissenschaft, ist keinesfalls ausreichend.47
Ausschlaggebend für die Definition des Wissenschaftsbegriffs ist das Wort „Wissen“. In der Wissenschaft steht die Erkenntnis der Beziehungen, in denen Natur- und Sozialerscheinungen zueinander stehen, im Mittelpunkt. Eine solche Erkenntnis lässt sich nur phänomenologisch mithilfe der angewandten Methoden und im Hinblick auf mögliche Inhalte beschreiben. Die angewandten Methoden sowie die Inhalte sind in der Wissenschaft hierbei grundsätzlich offen (Wissenschaftspluralismus). Maßgeblich für die Wissenschaft ist die rationale Bestätigung und Einordnung in ein größeres Ganzes, wobei das planmäßige Bemühen kennzeichnend ist.48
Folglich definierte schon 1927 Rudolf Smend Wissenschaft wie folgt: „Was sich als ernsthafter Versuch zur Ermittlung oder zur Lehre der wissenschaftlichen Wahrheit darstellt, ist Forschung und Lehre“.49 Heute definiert das Bundesverfassungsgericht die Wissenschaft als „alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist“.50 Es bleibt im Folgenden zu bestimmen, was unter wissenschaftlicher Forschung und wissenschaftlicher Lehre zu verstehen ist.
←29 | 30→a) Forschung
Der Forschungsbegriff findet sich in der Verfassung in Art. 5 III 1 Alt. 2 GG und Art. 74 I Nr. 13 Alt. 2 GG sowie darüber hinaus auch in der für die Wissenschaftsförderung zentralen Norm des Art. 91b I 1 GG. Unter wissenschaftlicher Forschung versteht man „die geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen“.51 Die wissenschaftliche Forschung umfasst mithin die Entscheidungen über die Fragestellung, die angewandte Methode, die gesamte praktische Durchführung eines Forschungsvorhabens, die Bewertung und Verbreitung des Forschungsergebnisses, gegebenenfalls auch des Forschungsvorgangs.52 Maßgeblich ist hierbei die planmäßige methodengesteuerte eigenverantwortliche Suche, Bestätigung oder Falsifikation von Erkenntnissen.53 Vom Begriff der wissenschaftlichen Forschung erfasst ist auch die gemeinsame Forschungsarbeit mehrerer Wissenschaftler sowie Zweck- und Auftragsforschung, sofern wissenschaftliche Methoden angewandt werden.54 Das Vorliegen von wissenschaftlicher Forschung ist nicht an die Institution der Universität gebunden, sondern kann auch an privaten Einrichtungen sowie bei der Erstellung von Privatgutachten existieren.55
b) Lehre
Unter wissenschaftlicher Lehre ist die Vermittlung des selbst oder von anderen Erforschten zu verstehen, wobei diese selbstständig und weisungsfrei erfolgt.56 Der Begriff der Lehre befand sich in der Verfassung zunächst ausschließlich in Art. 5 III 1 Alt. 2 GG.57 Mit der Grundgesetzänderung im Jahr 2014 fand der Begriff jedoch auch Einzug in Art. 91b I 1 GG.
←30 | 31→Maßgeblich für die Bedeutung der Lehre ist wie beim Forschungsbegriff die Wissenschaftlichkeit, die voraussetzt, dass den Studierenden vermittelt wird, die Rationalitätsstandards ihres Faches zu beherrschen und sich wissenschaftlich-kritisch mit Positionen auseinanderzusetzen.58 Zwischen der wissenschaftlichen Lehre und der wissenschaftlichen Forschung der oder des Lehrenden muss überdies ein Zusammenhang bestehen, wenngleich auch die Mitteilung der Ergebnisse anderer Forscherinnen und Forscher von der wissenschaftlichen Lehre erfasst ist.59 In der Lehre über die eigenen Forschungsergebnisse liegt zugleich eine Anregung zur weiteren Forschung, sodass auch hier ein Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre besteht. Diese Zusammenhänge bilden die Grundlage des Prinzips der Einheit von Forschung und Lehre.60 Das Vorliegen von wissenschaftlicher Lehre ist ebenso wie bei der wissenschaftlichen Forschung nicht an die Institution der Universität gebunden, sondern findet auch außerhalb statt.61 Unterricht in allgemeinbildenden Schulen ist hingegen keine wissenschaftliche Lehre i.S.d. Art. 5 III 1 Alt. 2 GG und Art. 91b I 1 GG, selbst wenn sie im Zusammenhang mit eigener wissenschaftlicher Forschung der Schullehrerinnen und Schullehrer steht.62
2. Wissenschaftsfinanzierung
Der Terminus Wissenschaftsfinanzierung nimmt Bezug auf den Rechtsbegriff der Wissenschaft und umfasst dementsprechend zunächst die Finanzierung der wissenschaftlichen Forschung, die sowohl an den Hochschulen, den Ressortforschungseinrichtungen des Bundes und der Länder als auch an den anderen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen betrieben wird. Darüber hinaus ist auch die Finanzierung der wissenschaftlichen Lehre an den Hochschulen vom Begriff der Wissenschaftsfinanzierung erfasst.
←31 | 32→Ebenfalls vom Terminus der Wissenschaftsfinanzierung umfasst ist der nachfolgend ebenfalls häufig verwendete Begriff der Hochschulfinanzierung, der sich im Folgenden ausschließlich auf die Finanzierung der Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft bezieht. Die Finanzierung von Hochschulen in privater63 und kirchlicher Trägerschaft unterscheidet sich in ihrer Struktur erheblich von der Finanzierung der Hochschulen in öffentlicher Trägerschaft und bleibt daher bei der Verwendung des Begriffes in dieser Arbeit außer Betracht. Zwar erhalten die privaten und kirchlichen Hochschulen auch staatliche Zuschüsse, sie finanzieren sich jedoch weit überwiegend selbst aus den Beiträgen ihrer Studierenden, Drittmitteln und Zuwendungen ihrer Träger. Die Hochschulfinanzierung umfasst sowohl die Finanzierung der wissenschaftlichen Forschung als auch der wissenschaftlichen Lehre an den Hochschulen. Die Länder, welche bis auf wenige Ausnahmen64 die Träger der öffentlichen Hochschulen sind, stellen mangels ausdrücklicher Kompetenz des Bundes gem. Art. 30, 104a I GG die Grundfinanzierung ihrer Hochschulen sicher.65 Diese umfasst die „laufenden Ausgaben (Grundmittel)“66, welche an den öffentlichen Hochschulen im Jahr 2016 insgesamt 16,4 Mrd. Euro67 betrugen und mit 71,1 %68 den größten Anteil der gesamten Finanzmittel der Hochschulen bildeten. Über diese Grundfinanzierung hinaus erhalten die Hochschulen zudem weitere öffentliche Finanzmittel in Form von Drittmitteln, die sie im Rahmen von Sonderprogrammen erhalten ←32 | 33→(sog. Programmmittel). Neben der Finanzierung durch die öffentliche Hand hinaus verfügen die Hochschulen im Übrigen über Drittmittel aus dem privaten Bereich, der Europäischen Union und dem Ausland sowie Entgelte und Erträge des hochschuleigenen Vermögens. Die Finanzierung der öffentlichen Hochschulen durch diese öffentlichen und privaten Drittmittel sowie durch Entgelte und Erträge des hochschuleigenen Vermögens fällt ebenfalls unter den Begriff der Hochschulfinanzierung, zählt jedoch nicht mehr zu deren Grundfinanzierung.
IV. Ausgangspunkt und Gang der Untersuchung
1. Ausgangspunkt der Untersuchung
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Reform der Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern im Wissenschaftsbereich durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b) vom 23. Dezember 2014, welche von einer Neuregelung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)69 flankiert wurde. Der Reform vorausgegangen war massive Kritik an den Änderungen der Kooperationsmöglichkeiten von Bund und Ländern im Wissenschaftsbereich durch die Föderalismusreform I im Jahr 2006. Übergeordnetes Ziel der ersten Etappe der Föderalismusreform war der Abbau der zahlreichen Verflechtungen zwischen den Kompetenzen von Bund und Ländern. Im Zuge der Umgestaltung der bundesstaatlichen Kompetenzordnung gerieten insbesondere die Gemeinschaftsaufgaben als Hort der Mischfinanzierung und „Politikverflechtung“70 auf den Prüfstand. Die obligatorische Gemeinschaftsaufgabe des Hochschulbaus entfiel und wurde zur fakultativen Mitwirkung umgestaltet. Darüber hinaus wurde die gemeinsame Bildungsplanung von Bund und Ländern abgeschafft. Die gemeinsame Forschungsförderung in Art. 91b GG unterlag umfassender Differenzierung und Präzisierung. An den Hochschulen war die gemeinsame Forschungsförderung anders als in der außeruniversitären Forschung nur noch thematisch und zeitlich begrenzt möglich. Parallel wurden die Bundesfinanzhilfen in Art. 104a IV GG (i.d.F. v. 1969) gestrichen und in den neuen Art. 104b GG (i.d.F. v. 2006) überführt. Dabei wurden die Möglichkeiten zur Gewährung von Finanzhilfen zugleich auf die Bereiche beschränkt, in denen der Bund auch über ←33 | 34→Gesetzgebungskompetenzen verfügt. Da der Bund nach der Föderalismusreform I jedoch kaum mehr über Gesetzgebungskompetenzen im Bildungsbereich verfügte,71 kam dies einem Ende der Kooperation im Bildungsbereich gleich.72
Sowohl die Einengung der Gemeinschaftsaufgaben auf die „Vorhaben“förderung an den Hochschulen als auch die Beschränkung der Bundesfinanzhilfen im neuen Art. 104b GG wurde in der öffentlichen Diskussion als „Kooperationsverbot“ im Hochschul- bzw. Bildungsbereich bezeichnet. Dieses „Kooperationsverbot“ wurde im Vorfeld der Verfassungsänderung von Art. 91b GG im Jahr 2014 vielfach stark kritisiert. Die Einführung des „Kooperationsverbotes“ wurde mitunter als „dümmste politische Weichenstellung […] der letzten Zeit“73 bewertet. Im Bemühen der „Verflechtungsfalle“74 durch die Föderalismusreform I zu entkommen, sei der Gesetzgeber in die „Entflechtungsfalle“75 getappt.76 Die Bezeichnung „Kooperationsverbot“ in Bezug auf Art. 104b I GG (i.d.F. v. 2006) erweist sich dabei jedoch streng genommen als inkorrekt. Nach Art. 104b I GG (i.d.F. v. 2006) konnte der Bund, soweit ihm Gesetzgebungsbefugnisse zustanden, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen gewähren, welche „zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich“ waren. Die Regelung des Art. 104b I GG (i.d.F. v. 2006) bildet somit gerade eine Ausnahme des grundsätzlich nach Art. 104a I GG bestehenden „Kooperationsverbotes“. Es handelt sich bei Art. 104b I GG (i.d.F. v. 2006) daher eher um eine „Kooperationserlaubnis“.77 Inkriminiert wurde eigentlich „nur“ die durch die Föderalismusreform I erfolgte Verengung der Ausnahme des Art. 104b I GG (i.d.F. v. 2006) gegenüber der vorherigen Fassung in Art. 104a IV GG (i.d.F. v. 1969).78
←34 | 35→Durch die Verfassungsänderung von Art. 91b GG im Jahr 2014 wurden die Kooperationsmöglichkeiten von Bund und Ländern im Wissenschaftsbereich nunmehr erheblich erweitert, sodass der Bund die Hochschulen dauerhaft institutionell fördern kann. Die Reform wurde daher vielfach als Aufhebung oder jedenfalls Lockerung des „Kooperationsverbotes“ im Hochschulbereich bezeichnet.79 Im Zuge der Neufassung von Art. 91b GG übernahm der Bund im Übrigen durch das 25. BAföG-Änderungsgesetz vom 19. Dezember 2014 nahezu gleichzeitig die vollständige Finanzierungszuständigkeit für Geldleistungen nach dem BAföG ab dem 1. Januar 2015, um die Landeshaushalte zu entlasten.80 Die Bundesfinanzhilfen in Art. 104b GG sind hingegen grundsätzlich weiterhin auf die Gebiete beschränkt, in denen der Bund auch über Gesetzgebungskompetenzen verfügt.
2. Gang der Untersuchung
Angesichts der Residualkompetenz der Länder im Wissenschaftsbereich ist in Abschnitt B. zu untersuchen, welche Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskompetenzen dem Bund für seine Einflussnahme und (Mit-)Finanzierungstätigkeiten in diesem Gebiet zur Verfügung stehen. Hierbei erfolgt zunächst eine kurze Darstellung der Grundlagen föderaler Zuständigkeitsverteilung im deutschen Bundesstaat nach Art. 30, 70 I, 83, 92, 104a I GG. Sodann werden die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes im Wissenschaftsbereich erläutert, welche untrennbar mit der Wissenschaftsfinanzierung verbunden sind. Hierbei werden insbesondere die konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für die Ausbildungsbeihilfen und die Forschungsförderung in Art. 72, 74 I Nr. 13 GG sowie für die Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse in Art. 72, 74 I Nr. 33 GG einschließlich ihrer Entstehungsgeschichte dargestellt. Es schließt sich eine Ausführung der Verwaltungskompetenzen des Bundes im Wissenschaftsbereich an, in deren Verlauf die gesetzesakzessorische sowie die sog. gesetzesfreie Verwaltung analysiert werden. Im Anschluss erfolgt die Untersuchung der Finanzierungskompetenzen des Bundes im Wissenschaftsbereich, die mit einer Darstellung der bundesstaatlichen Verteilung ←35 | 36→der Ausgabenverantwortung nach Art. 104a I GG beginnt. Ferner werden nach einer kurzen Erläuterung des Begriffs der Gemeinschaftsaufgaben deren Geschichte und Entwicklung bis zum Jahr 2015 aufgezeigt. Den ersten Schwerpunkt der Untersuchung bildet sodann die kritische Würdigung der im Jahr 2014 reformierten Gemeinschaftsaufgabe von Art. 91b GG, die mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft trat. Im Anschluss wird auf die grundsätzliche Problematik der bundesstaatlichen Verflechtung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben im Wissenschaftsbereich eingegangen. Im weiteren Verlauf werden die besonderen Finanzierungskompetenzen des Bundes für Geldleistungsgesetze nach Art. 104a III GG im Hinblick auf das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)81 erläutert. Nachfolgend werden die Finanzhilfen des Bundes sowie deren Geschichte und Entwicklung beschrieben, bevor schließlich die ungeschriebenen Finanzierungskompetenzen des Bundes im Wissenschaftsbereich untersucht werden.
Abschnitt C. widmet sich der kooperativen Wissenschaftsförderung in der Staatspraxis und stellt zunächst mit dem Wissenschaftsrat (WR) und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) die wichtigsten Bund-Länder-Kooperationsgremien im Wissenschaftsbereich vor. Einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die verfassungsrechtliche Untersuchung der gemeinsamen Förderung von Hochschulen sowie von außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen durch Bund und Länder.
Abschnitt D. gibt einen Überblick über den Status quo der derzeitigen verfassungsrechtlichen Reformoptionen des Bundes und der Länder hinsichtlich der öffentlichen Wissenschaftsfinanzierung. Anschließend werden verfassungsrechtliche Reformperspektiven der bundesstaatlichen Wissenschaftsfinanzierung de constitutione ferenda unter Berücksichtigung der bisher gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt.
Die Untersuchung endet mit einem Fazit und Ausblick in Abschnitt E.
1 „Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“, Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD v. 7.2.2018, S. 28.
2 Thieme, Deutsches Hochschulrecht, Rn. 562.
3 Haug, OdW 2016, 85 (85).
4 Statistisches Bundesamt, Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen – vorläufige Ergebnisse – Wintersemester 2018/2019, S. 4.
5 Die Berechnung basiert auf den vorläufigen Schnellmeldungsergebnissen der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen zum Wintersemester 2018/2019 des Statistischen Bundesamtes, S. 11.
6 Bedingt durch die Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre zeitversetzt in allen Bundesländern. Die Umstellung auf das achtjährige Gymnasium (sog. G8) erfolgte 2007 in Sachsen-Anhalt, 2008 in Mecklenburg-Vorpommern, 2009 im Saarland, 2010 in Hamburg, 2011 in Bayern und Niedersachsen, 2012 in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Bremen sowie 2013 in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2016 erfolgt die Umstellung in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, hier aber nur in Form eines Modellversuches an 19 Ganztagsschulen. In Sachsen und Thüringen besteht die achtjährige Gymnasialzeit bereits seit 1949.
7 Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher Vorschriften 2011 (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 – WehrRÄndG 2011) v. 28.4.2011, BGBl. 2011 I S. 678.
8 Statistisches Bundesamt, Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen – vorläufige Ergebnisse – Wintersemester 2018/2019, S. 10.
9 Die Berechnung basiert auf den vorläufigen Schnellmeldungsergebnissen der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen zum Wintersemester 2018/2019 des Statistischen Bundesamtes, S. 11.
10 Statistisches Bundesamt, Bildungsfinanzbericht 2015, S. 64.
11 Anteil der Studienanfängerinnen und -anfänger an der Bevölkerung des entsprechenden Geburtsjahres. Für die einzelnen Geburtsjahrgänge werden Quoten berechnet und anschließend im sog. Quotensummenverfahren aufsummiert.
12 Statistisches Bundesamt, Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen – vorläufige Ergebnisse – Wintersemester 2018/2019, S. 11.
13 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt 2020 v. 20.8.2007, BAnz 2007 S. 7480; Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 (zweite Programmphase) v. 24.6.2009, BAnz 2009 S. 2419, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern v. 13.6.2013, BAnz AT 11.03.2014 B5; Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020 v. 11.12.2014, BAnz 2015 S. 2646. S. dazu auch unten C. II. 2. a)–c).
14 Gaehtgens, Die Exzellenzinitiative im Kontext Bund/Länderfinanzierter Forschungsförderprogramme, Wissenschaftspolitik im Dialog 1/2012, S. 16; Möller, in: Hartmer/Detmer, Hochschulrecht, Kap. 15 Rn. 51.
15 Laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung wird die Entwicklung der Studiennachfrage in Deutschland bis 2050 dauerhaft über dem Niveau des Jahres 2005 bleiben. Je nach Berechnungsmodell sind danach für das Studienjahr 2050 70.000 bis 130.000 zusätzliche Studienanfänger gegenüber dem Jahr 2005 zu erwarten, CHE, Auf dem Hochplateau der Studiennachfrage: Kein Tal in Sicht! Modellrechnungen zur Entwicklung der Studienanfängerzahlen bis zum Jahr 2050, Arbeitspapier Nr. 203, Dezember 2017, S. 10.
16 „Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“, Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD v. 7.2.2018, S. 32.
17 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken gemäß dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern v. 6.6.2019 (ZV), BAnz AT 04.09.2019 B3, s. dazu auch unten C. II. 2. d).
18 Einundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Finanzreformgesetz) v. 12.5.1969, BGBl. 1969 I S. 359.
19 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c) v. 28.8.2006, BGBl. 2006 I S. 2034.
20 BT-Drs. 18/2710.
21 BR-Drs. 570/14(B).
22 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b) v. 23.12.2014, BGBl. 2014 I S. 2438.
23 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über Innovation in der Hochschullehre gemäß dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern v. 6.6.2019 (IidH), BAnz AT 28.08.2019 B4; s. dazu auch unten C. II. 6. b).
24 Pakt für Forschung und Innovation IV in den Jahren 2021–2030 (PFI IV) v. 3.5.2019; s. dazu auch unten C. III. 9. d).
25 Vgl. F. Kirchhof, Gutachten D für den 61. DJT, 1996, S. D53 ff.; Huber, Gutachten D für den 65. DJT, 2004, S. D 32 ff.; Huber, in: Blanke/Schwanengel, Zustand und Perspektiven des deutschen Bundesstaats, S. 22 ff.; Schmidt-Jortzig, ZG 20 (2005), 16 (26 f.); Häde, JZ 2006, 930 (934 f.); Waldhoff, VVDStRL 66 (2007), 216, (231 ff.); Waldhoff, KritV 2008, 213 (224 ff.); Glaser, in: Kahl/Waldhoff/Walter, BK-GG, Vorbem. z. Art. 91a-e [Stand: 8/2016], Rn. 44 ff.; s. hierzu auch ausführlich unten B. IV. 4.
Details
- Seiten
- 474
- Jahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631859339
- ISBN (ePUB)
- 9783631859346
- ISBN (MOBI)
- 9783631859353
- ISBN (Paperback)
- 9783631853542
- DOI
- 10.3726/b19335
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Dezember)
- Schlagworte
- Verflechtung Mischfinanzierung Kooperation Foderalismus Forschungsforderung Gesetzesvorbehalt Gemeinschaftsaufgabe
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 474 S., 4 s/w Abb.