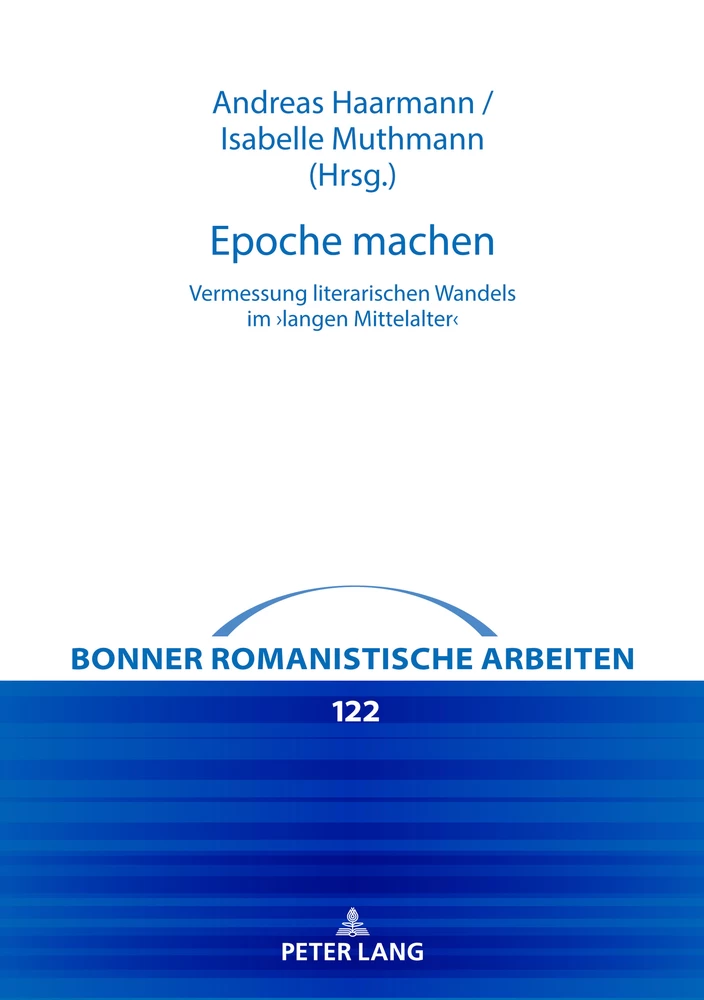Epoche machen
Vermessung literarischen Wandels im ›langen Mittelalter‹
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhalt
- Vorwort und Dank
- Einleitung – Literatur, Geschichte, Verstehen (Andreas Haarmann)
- Kontinuitäten und Diskontinuitäten einer orientalischen Fabelsammlung: Calila e Dimna (1251) und Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (1493) (Mechthild Albert)
- Jean Lemaire de Belges et Clément Marot : Une Renaissance en douceur avant la Pléiade (Frank Lestringant)
- L’historiographie léonardienne de l’art renaissant : un antihumanisme ? (Olivier Chiquet)
- Das Abenteuer als Kontingenzgenerator Zur Geschichte eines Erzählschemas zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (Manuel Mühlbacher)
- Literarischer Wandel, Verwilderung und Kontinuität in Luigi Pulcis Morgante (Sabine Narr-Leute)
- Darstellungen sinnlichen Begehrens im portugiesischen Mittelalter und Renaissance-Humanismus (Dina Diercks)
- Zwei Epochen „machen“, gleichzeitig? Überlegungen zur entangled history von Aufklärung und Klassizismus in Frankreich (Roman Kuhn)
- Zur Textgestalt
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Reihenübersicht
Vorwort und Dank
Seit der vorbereitenden Diskussion der hier veröffentlichten Beiträge auf dem XXXVI. Romanistentag im September und Oktober 2019 ist oft von einem epochalen Einschnitt die Rede gewesen. Das CoronaLogBuch der Gerda-Henkel-Stiftung bündelt seit Ausbruch des Erregers geisteswissenschaftliche Stimmen zur Pandemie und ließ gar über eine „Epochenwende reloaded“ nachdenken, ohne dass dem Anspruch des weit ausgreifenden Titels freilich hätte entsprochen werden können.1 Solcher Spekulation auf maximale Aufmerksamkeit steht das andere Extrem entgegen, das die Existenz abrupter Veränderung schlechthin verneint. So geht der Historiker Volker Reinhardt in der Neuen Zürcher Zeitung mit sämtlichen „Epochierungen“ hart ins Gericht, wenn er am Beispiel der mittlerweile beinah sprichwörtlich gewordenen „Erfindung des Mittelalters“ ausbuchstabiert, wie beliebig die Identifizierung bahnbrechender Ereignisse verfährt und wie eingeschränkt deren Geltungsbereich für einzelne gesellschaftliche Teilsysteme ist.2
Der vorliegende Band gerät dieserart auf überraschende und gewissermaßen auch makabre Weise in das Spannungsfeld einer Debatte von höchster Aktualität. Dass die Wahrnehmung und Einordnung von Ereignissen durch die sie miterlebende Gesellschaft geschichtlich bedeutsam sein kann, zeigt folgendes Beispiel ebenso wie das genaue Gegenteil: Für das Spätmittelalter nämlich macht František Graus im Ausbruch der Pest das einzige Ereignis aus, das an ein gewisses Epochenbewusstsein der Zeitgenossen gerührt, dieses vielleicht überhaupt erst geweckt habe. Kein anderes Vorkommnis habe in vergleichbarer Weise den Eindruck eines tiefgreifenden Wandels hinterlassen, doch bemerkt Graus sogleich: „Schon nach wenigen Jahrzehnten fand das erste Auftauchen ←7 | 8→der Pest nur mehr geringe Aufmerksamkeit, wurde von anderen zeitgenössischen Ereignissen verdrängt.“3
Wie tief die Zäsur tatsächlich ist, die die Entwicklungen der letzten Monate aus historischer Sicht hinterlassen haben, kann sich wohl erst im Rückblick erweisen. Sicher ist hingegen, dass die Autorinnen und Autoren unter ungekannten Ausnahmebedingungen zum ungewöhnlich raschen Erscheinen dieses Bandes beigetragen haben, wofür ihnen der herzliche Dank der Herausgeber gebührt. Unser Dank gilt außerdem Paul Geyer und dem Deutschen Romanistenverband, ohne deren großzügige Unterstützung wir auf die Mitwirkung der französischen Gäste in Kassel hätten verzichten müssen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch dem Collège de France danken, das seinerseits für einen Teil der Reise- und Aufenthaltskosten aufzukommen bereit war. Die Veröffentlichung dieses Buches schließlich wäre ohne die Hilfe des Institut français Bonn unter der Leitung von Landry Charrier sowie die besondere Förderung von Michael Bernsen und Paul Geyer nicht möglich gewesen. Ihnen sind wir zu großem Dank verpflichtet.
Die Kasseler Tagung gab zudem auf ganz unverhoffte Weise Anlass zu Dankbarkeit. Gespräche, zufällige Begegnungen und neue Bekanntschaften am Rande der eigentlichen Sektionsarbeit bekommen aus heutiger Sicht, da all dies noch in weiter Ferne zu liegen scheint, einen besonders hohen Stellenwert. So bleibt zu hoffen, dass der wissenschaftliche Austausch schon bald wieder von einem lebendigen Austausch zwischen Wissenschaftlern begleitet werden kann.
Bonn im September 2020
Die Herausgeber
1Vgl. „Coronakrise: Epochenwende reloaded“, ein Gespräch mit Mahret Ifeoma Kupka und Andreas Rödder vom 02.06.2020: https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/logbuch_corona_2juni2020 (zuletzt aufgerufen am 28.09.2020).
2Vgl. Volker Reinhardt: „Hat Corona alles verändert? Nein, die Welt wird nicht plötzlich völlig anders. Und überhaupt: Geschichte vollzieht sich nicht in Umbrüchen“, https://www.nzz.ch/feuilleton/mittelalter-ja-das-wurde-auch-erfunden-wie-epochen-ueberhaupt-ld.1574156 (zuletzt aufgerufen am 28.09.2020).
3František Graus: „Epochenbewusstsein im Spätmittelalter und Probleme der Periodisierung“ in Reinhart Herzog und Reinhart Koselleck (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewusstsein, München: Fink, 1987, S. 153–166, hier S. 159.
Andreas Haarmann (Bonn)
Einleitung – Literatur, Geschichte, Verstehen
Der literarische Text ist bekanntlich ein historischer Gegenstand; sich zu ihm in ein verstehendes Verhältnis zu setzen ist die Aufgabe des Literaturwissenschaftlers. Als störend für den Aufbau dieses Verhältnisses erweisen sich im weitesten Sinne ‚materielle‘ Faktoren wie Sprachstand und Typographie, aber auch meist größere ‚ideelle‘ Hemmnisse, die sich dem Verständnis entgegenstellen und einen ästhetischen oder intellektuellen Zugriff blockieren. Grundsätzlich rücken Lebensweisen und -bedingungen, Weltanschauung, Wissensstand, Gesellschaftsordnung weit zurückliegender Zeiten den in ihnen entstandenen und von ihnen handelnden Text gegenüber dem Leser in eine Beziehung mal mehr, mal weniger stark ausgeprägter Fremdheit, um deren weitgehende Aufhebung es der klassischen Hermeneutik zu tun ist. Den tatsächlichen oder zumindest wahrscheinlichen Sitz im Leben eines historisch gewordenen Textes zu bestimmen und zu vermitteln, erweist sich inzwischen schon bei jüngerer Literatur als immer schwieriger: heutige Studentinnen und Studenten sind in eine Welt geboren worden, aus der Smartphones nicht wegzudenken sind, während alle Beiträgerinnen und Beiträger dieses Bandes sich gut an ein Leben ohne Internet zurückerinnern dürften.1 Wie viel schwerer ist es da, die Tragweite solch epochaler Neuerungen wie der des Buchdrucks begreiflich zu machen, wenn sogar über kurze Zeitspannen die Analogie versagt, weil sich das Rad der Zeit schon ein gutes Stück weitergedreht hat. Das Fremde aber, so zeigt es sich hier, ist nicht fremd an sich, sondern zuallererst fremd für uns.
Ein geschärftes historisches Bewusstsein und humanistische Gelehrsamkeit können andererseits auch die Gefahr bergen, den Prozess des Verstehens zu erschweren, wenn ihr Gegenstand jenseits des an ihn herangetragenen Erwartungshorizontes liegt, wie Hans Robert Jauss in einem seiner bekanntesten ←9 | 10→Aufsätze am Beispiel von Brunetto Latinis Tesoretto ausführt, dessen eigene, aber durchaus zeittypische Ästhetik den maßgeblichen Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts in ihrer spezifischen Voreingenommenheit schlicht nicht zugänglich gewesen sei.2 Das Wissen um den Text und seinen geschichtlichen Ort muss folglich begleitet werden von einer beständigen Reflexion des jeweiligen Standortes; die „Kanalarbeit“, die der Literaturwissenschaftler als „Textdienstleister“ verrichtet, um den Informationsfluss zwischen Text und Rezipienten zu ermöglichen, bringt es mit sich, dass der Arbeiter selbst knietief im trüben Wasser steht.3 Die Standortabhängigkeit hermeneutischer Erkenntnis fordert dem Interpreten eines literarischen Textes folglich eine dauerhafte, prüfende Betrachtung der eigenen Erkenntnisvoraussetzungen ab, zu denen auch seine Vor-Urteile gehören. Dabei besteht die größte Schwierigkeit vielleicht gar nicht so sehr darin, sich in eine Form von Alterität hineinzudenken, als vielmehr darin, eine kritische Beziehung zur Ipseität herzustellen, welche bestimmte Deutungsmuster als allzu naheliegend erscheinen lassen kann.
Mit dem vorliegenden Band wird ein weiteres Mal der Versuch unternommen, eines der prägendsten und zugleich selbstverständlichsten Vorurteile zu hinterfragen, das die Begegnung mit dem Text lenkt: seine Epochenzugehörigkeit. Das unverzichtbare Vorverständnis, mit dem der Leser gemeinhin an den Text herantritt, kann blind machen für all jene Aspekte, die das Vorverständnis übersteigen oder es schlicht verfehlen, wie es bei Latinis Tesoretto der Fall gewesen sein soll. Da Epochengrenzen in aller Regel nachträglich gezogen werden – der Begriff „Mittelalter“ macht dies besonders deutlich, weil er etwas Vorgängiges und Nachfolgendes voraussetzt, um überhaupt etwas bezeichnen zu können – und sie selbst, wie alles Begriffliche, einem geschichtlichen Wandel unterliegen, gehört auch ihre gelegentliche, wenn nicht gar beständige Prüfung zu den Aufgaben der Literaturwissenschaft.
Epoche ‚machen‘
Es ist kaum verwunderlich, dass die sogenannte Postmoderne, also jene Epoche, in der sich die zähfließende Gegenwart in eitler Selbsthistorisierung wiedererkennen möchte, gewohnheitsmäßig auf die Künstlichkeit, Beliebigkeit und damit auch die Verzichtbarkeit von Epochengrenzen abhebt. So beklagt Hans Ulrich Gumbrecht Mitte der 1980er Jahre in einem „Gespräch über Epochen“ ←10 | 11→gegenüber seinen Mitdiskutanten die Unergiebigkeit des Austauschs über Epochengrenzen, denen er nur mehr den funktionalen Status einer Plot-Struktur zuerkennt, über die der (Literatur-)Historiker ähnlich frei wie ein Romanautor verfüge.4 Bleibt diese Analogie auch nicht unwidersprochen, so klingt das Wort von der Unergiebigkeit doch noch in einem wenig später von Reinhart Herzog und Reinhart Koselleck besorgten Sammelband zum gleichen Thema nach. Die Herausgeber halten den Beiträgen ihres Bandes im Vorwort zugute, die Klippen der Objektivierbarkeit historischen Wandels von vornherein umschifft und den Schwerpunkt auf Aspekte des Epochenbewusstseins gelegt zu haben, und damit auf die Ebene individueller oder kollektiver Wahrnehmung.5 Auch der vorliegende Band signalisiert schon im Titel das zugrundeliegende Bewusstsein für die Künstlichkeit, für die ‚Machbarkeit‘ geschichtlicher Periodisierung. Die dem Französischen entlehnte Formulierung „Epoche machen“ verweist abseits der hier gebrauchten spielerischen Umdeutung auf einen ungenannten Aktanten, der als Auslöser für einen Wandlungsprozess dingfest gemacht werden kann. Besonders folgenreiche Ereignisse, scheinbar übermenschliche Persönlichkeiten, herausragende Entdeckungen und Erfindungen werden meist als ein solcher Auslöser begriffen, der eine Kette von Reaktionen in einem weit ausgedehnten Einflussbereich hervorruft, deren Ineinandergreifen mit gewissem Abstand ein zusammenhängendes Muster ergibt, das nach einem Namen verlangt. Diese durchaus vertraute Vorstellung eines einschneidenden Urmoments ist umso bemerkenswerter, als ein Blick auf die frühe Begriffsgeschichte der „Epoche“ verrät, dass die Dauer ihr Hauptmerkmal darstellt und sie nicht als etwas Punktuelles erfasst wird (agr.: epéchein = anhalten, festhalten). Ironischerweise allerdings teilt sich die Epoche als andauerndes Zeitintervall ihr Etymon ausgerechnet mit der Hektik, jenem Zustand unkontrollierter, fieberhafter Bewegung, der kein Innehalten zulässt. Beständigkeit und Unrast sind dem Begriff somit von Anfang an eingeschrieben, warum ihn also auf eine einzige Dimension verengen?
Das mit den hier versammelten Beiträgen angestrengte Gedankenexperiment versucht beiden Bedeutungsbereichen gerecht zu werden, indem ein für literaturgeschichtliche Verhältnisse recht langer Zeitraum von etwa einem halben Jahrtausend betrachtet und auf die in ihm wirksamen, bisweilen sprunghaften Veränderungsprozesse hin untersucht wird. Denkanstoß für diese Betrachtungen ist der posthum erschienene Essay Faut-il vraiment découper ←11 | 12→l’histoire en tranches6 des großen französischen Mediävisten Jacques Le Goff, in dem er sich für die Verabschiedung gleich mehrerer Epochen zugunsten eines „long Moyen Âge“ ausspricht, das für ihn erst mit der Französischen Revolution als dem wirklichen Beginn einer neuen Zeitrechnung endet. Vorangegangene Umwälzungen wie beispielsweise die Entdeckung neuer Kontinente sind Le Goff zufolge vergleichsweise folgenlos geblieben, erst mit dem Sturz eines mehrere Jahrhunderte intakten Gesellschaftsgefüges durch den plötzlichen Aufstieg des Bürgertums treten Entwicklungen ein, die sich vom bislang Dagewesenen deutlich genug abheben, um als ‚epochal‘ gelten zu dürfen. Die bewusst provokanten Postulate Le Goffs regen zum Nachdenken an, beschränken sich aber zumeist auf Aspekte der Ereignis- und Wirtschaftsgeschichte und vernachlässigen weitgehend den Bereich der Kultur. Nachdem Le Goffs Impuls schnell von namhaften Historikern aufgenommen wurde und zu einem von dem Münsteraner Islamwissenschaftler Thomas Bauer angeführten öffentlichen Schlagabtausch um Sinn und Unsinn geschicht(-swissenschaft-)licher Periodisierung und ihre Methoden geführt hat,7 sollen hier einige Stimmen versammelt werden, die sich aus einer dezidiert literaturwissenschaftlichen Warte derselben Problemstellung widmen und die von Berufslesern naturgemäß als solche empfundene Lücke in den Überlegungen Le Goffs schließen helfen.
Hektik und Dialektik
Nach Odo Marquard ist es nicht zuletzt der eingangs erwähnten Postmoderne zu verdanken, dass die Bedeutung der Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit, um die es ja auch Le Goff und den Beiträgen dieses Bandes geht, überhaupt verhandelbar geworden ist.8 Voraussetzung dafür nämlich sei eine Umverteilung der erheblichen geistesgeschichtlichen Last, die diesem (Um-) Bruch aufgebürdet wurde, zugunsten – oder zuungunsten – eines für die Zukunft erwarteten Bruchs: Erst als sich das Hauptaugenmerk im Zuge einer „Zäsurwanderung“ auf das Ende der Gegenwart zu richten beginnt, wird es zulässig, den Anfang derselben unbefangen zu hinterfragen; erst die Aufladung des Kommenden mit Bedeutsamkeit nimmt dem Vergangenen die Spannung, gibt es frei für Neuauslegungen und die Wahrnehmung von Kontinuitäten. Marquards „Überlegungen zur Renaissance“ machen damit zwar erneut die Standortabhängigkeit und ‚Machbarkeit‘ von Epochengrenzen deutlich, sie ←12 | 13→erteilen der Ausweisung distinkter Epochen aber keineswegs eine Absage. Die Beschreibung der Renaissance mit der Formel „Innovationskultur als Kontinuitätskultur“ unterstreicht einerseits die Plastizität dieses Epochenkonzepts im Speziellen, das sich Marquard zufolge mit der Pflege kulturellen Altbestands für das strapaziöse Wagnis radikaler Innovation entschädigt, und besteht andererseits auf der Notwendigkeit solcher „Kompensation“ für kulturgeschichtliche Entwicklung schlechthin.
Je rascher geschichtlicher Wandel sich vollzieht, desto größer wird der Drang, ihn beherrschbar machen oder zumindest erscheinen lassen zu wollen. Die Literaturgeschichtsschreibung zeigt, dass ausgerechnet ab dem Moment, in dem Hegel die Entwicklung der Kunst an ihrem Endpunkt angelangt sieht, wie zum Gegenbeweis immer neue Epochen in immer kürzeren Abständen aufeinanderfolgen. Dieses hektische Nach- und Nebeneinander verschiedener Strömungen mit nicht selten epochenbildendem Anspruch muss man nicht als Beleg für ein Ende der Geschichte sehen, in der alles schon dagewesen ist und nur noch durch Abwandlung neu arrangiert werden kann; es ließe sich auch begreifen als polyzentrisches Reaktionsmuster, mit dem der durch ihren gefühlt schnelleren Fluss formlos gewordenen Zeit begegnet werden soll, die man derart wenigstens begrifflich einzuholen, zu modellieren sich imstande fühlt. So gesehen ließe sich der dialektische Doppelcharakter des Epochenbegriffs erhalten, den die Sprachgeschichte verdeckt und der auch Marquards Renaissance-Bild innewohnt: Epoche wäre dann kein monolithischer Block, sondern das, was unabhängig von seiner tatsächlichen Dauer als Reaktion auf überfordernde Beschleunigungserscheinungen eine kompensatorische Beständigkeit zu erzeugen sucht.
Details
- Pages
- 194
- Publication Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631859117
- ISBN (ePUB)
- 9783631859124
- ISBN (MOBI)
- 9783631859131
- ISBN (Hardcover)
- 9783631844830
- DOI
- 10.3726/b18647
- Language
- German
- Publication date
- 2021 (August)
- Keywords
- Aufklärung Renaissance Neuzeit langes Mittelalter Epochenumbruch literarischer Wandel Epochengrenzen Literaturgeschichte
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 194 S., 4 s/w Abb.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG