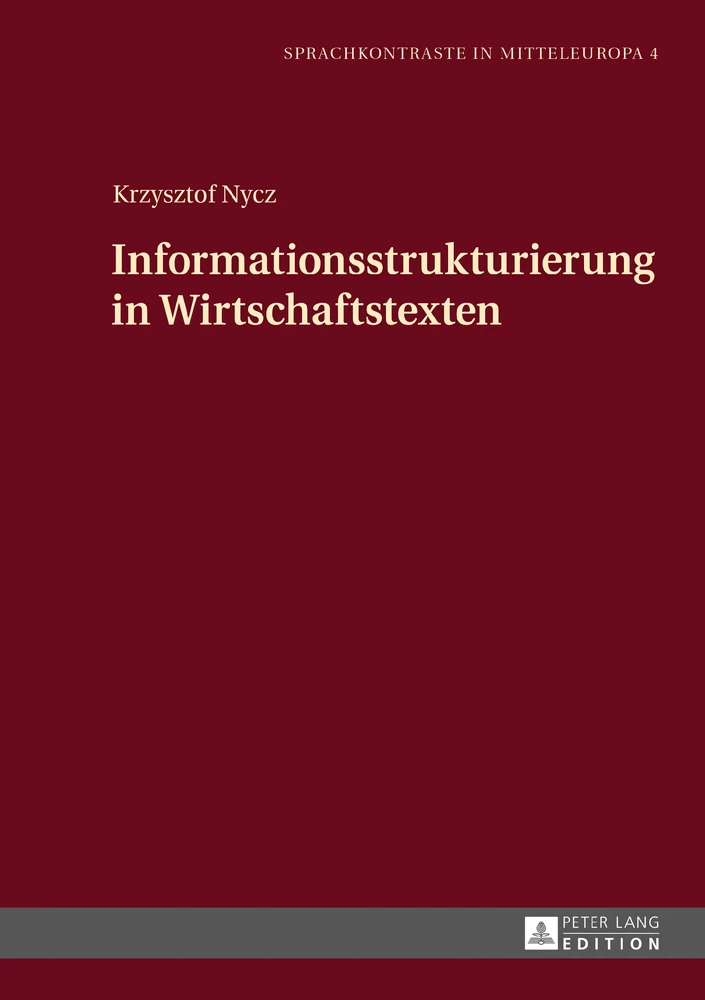Informationsstrukturierung in Wirtschaftstexten
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 0.1. Gegenstand der Arbeit
- 0.2. Struktur der Arbeit
- 1. Zur Komplexität des Textbegriffs
- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Der transphrastische Ansatz
- 1.3. Der semantische Ansatz
- 1.4. Der kommunikativ-pragmatische Ansatz
- 1.5. Der kognitive Ansatz
- 1.6. Neuere Ansätze
- 2. Informationsstrukturierung in Texten
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Zum Konzept der Thema-Rhema-Gliederung
- 2.3. Zur Topik-Kommentar-Gliederung
- 2.3.1. Theoretische Ansätze zum Satztopik
- 2.3.1.1. Topik als given/known-Information
- 2.3.1.2. Aboutness-Topik
- 2.3.1.3. Topik als Ausgangspunkt des Satzes
- 2.3.2. Rahmensetzung
- 2.3.3. Topik und Satzposition
- 2.4. Zur Fokus-Hintergrund-Gliederung
- 3. Text, Informationsstrukturierung und Quaestio
- 3.1. Zur Komplexität des Themabegriffs
- 3.1.1. Thema als Makroproposition bzw. Informationskern
- 3.1.2. Thema als Kern des Textinhalts
- 3.1.3. Thema als etwas Fragliches
- 3.2. Quaestio und Textstruktur
- 3.2.1. Zum Begriff der Quaestio
- 3.2.2. Vorgaben der Quaestio
- 3.2.2.1. Inhaltsbezogene Vorgaben
- 3.2.2.2. Strukturelle Vorgaben
- 3.2.2.2.1. Haupt- und Nebenstruktur
- 3.2.2.2.2. Topik und Fokus
- 3.2.3. Referentielle Besetzung
- 3.2.4. Referentielle Bewegung
- 3.2.5. Exkurs: Zum Phänomen des Referierens
- 3.2.6. Zum Stand der quaestio-orientierten Forschung
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1. Das methodische Herangehen an die Untersuchung
- 4.1.1. Textsorteneingrenzung
- 4.1.2. Analysematerial
- 4.1.3. Vorgehensweise und Methode
- 4.2. Exemplarische Analysen
- 4.2.1. Fachtexte des Deutschen
- 4.2.1.1. Analysebeispiel 1: Aktien Tokio
- 4.2.1.1.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.1.1.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.1.1.3. Sprachliche Form
- 4.2.1.2. Analysebeispiel 2: Aktien China
- 4.2.1.2.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.1.2.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.1.2.3. Sprachliche Form
- 4.2.1.2.4. Charakteristik der Nebenstruktur
- 4.2.1.3. Analysebeispiel 3: Aktien Asien
- 4.2.1.3.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.1.3.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.1.3.3. Sprachliche Form
- 4.2.1.3.4. Charakteristik der Nebenstruktur
- 4.2.2. Fachtexte des Polnischen
- 4.2.2.1. Analysebeispiel 4
- 4.2.2.1.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.2.1.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.2.1.3. Sprachliche Form
- 4.2.2.2. Analysebeispiel 5
- 4.2.2.2.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.2.2.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.2.2.3. Sprachliche Form
- 4.2.2.3. Analysebeispiel 6
- 4.2.2.3.1. Quaestio und referentielle Besetzung
- 4.2.2.3.2. Referentielle Bewegung
- 4.2.2.3.3. Sprachliche Form
- 4.2.2.4. Nebenstrukturen in Fachtexten des Polnischen
- 5. Ergebnisse der kontrastiven Analysen
- 5.1. Konzeptdomäne PERSON/OBJEKT
- 5.1.1. Erhalt
- 5.1.2. Einschränkung/Eingrenzung
- 5.1.3. Neueinführung
- 5.1.4. Determination und Komplexität von Nominalphrasen
- 5.2. Konzeptdomäne SITUATION
- 5.3. Konzeptdomäne ZEIT
- 5.4. Konzeptdomäne RAUM
- 5.5. Konzeptdomäne UMSTAND
- 5.6. Konzeptdomäne MODALITÄT
- 5.7. Wortstellung und Informationsstrukturierung
- 6. Schlusswort und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
- Reihenübersicht
Krzysztof Nycz
Informationsstrukturierung in Wirtschaftstexten
![]()
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gutachter: Prof. Dr. phil. habil. Klaus-Dieter Baumann
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung von der Universität Rzeszów.
ISSN 2366-732X
ISBN 978-3-631-72443-9 (Print)
E-ISBN 978-3-631-72444-6 (E-Book)
E-ISBN 978-3-631-72445-3 (EPUB)
E-ISBN 978-3-631-72446-0 (MOBI)
DOI 10.3726/b11214
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
Autorenangaben
Krzysztof Nycz ist Oberassistent am Institut für Germanistik der Universität Rzeszów (Polen). Seine Forschungsbereiche umfassen Fachkommunikation, Fachsprachenlinguistik, Kontrastive Linguistik, Phonetik und Phonologie des Deutschen.
Über das Buch
Das Buch untersucht das Phänomen der Informationsstrukturierung in Wirtschaftstexten. Der Autor richtet sein Augenmerk auf die informationsstrukturelle Analyse von deutsch- und polnischsprachigen Marktberichten und –kommentaren und legt der Untersuchung den Quaestio-Ansatz von Wolfgang Klein und Christiane von Stutterheim zugrunde. Die materialintensiven empirisch orientierten Analysen geben Aufschluss über relevante Aspekte der Informationsentfaltung, Formen der Referenzen und der daraus resultierenden Textstrukturierung. Auf Grund des zweisprachigen Textkorpus bietet sich eine kontrastive Betrachtung deutscher und polnischer Fachtexte im Hinblick auf deren Informationsstruktur sowie Prinzipien der Fokussierung einzelner Informationseinheiten an.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Zur Komplexität des Textbegriffs
1.2. Der transphrastische Ansatz
1.4. Der kommunikativ-pragmatische Ansatz
2. Informationsstrukturierung in Texten
2.2. Zum Konzept der Thema-Rhema-Gliederung
2.3. Zur Topik-Kommentar-Gliederung
2.3.1. Theoretische Ansätze zum Satztopik
2.3.1.1. Topik als given/known-Information
2.3.1.3. Topik als Ausgangspunkt des Satzes
2.4. Zur Fokus-Hintergrund-Gliederung
3. Text, Informationsstrukturierung und Quaestio
3.1. Zur Komplexität des Themabegriffs
3.1.1. Thema als Makroproposition bzw. Informationskern
3.1.2. Thema als Kern des Textinhalts
3.1.3. Thema als etwas Fragliches
3.2. Quaestio und Textstruktur←5 | 6→
3.2.1. Zum Begriff der Quaestio
3.2.2.1. Inhaltsbezogene Vorgaben
3.2.2.2. Strukturelle Vorgaben
3.2.2.2.1. Haupt- und Nebenstruktur
3.2.3. Referentielle Besetzung
3.2.5. Exkurs: Zum Phänomen des Referierens
3.2.6. Zum Stand der quaestio-orientierten Forschung
4.1. Das methodische Herangehen an die Untersuchung
4.1.3. Vorgehensweise und Methode
4.2.1. Fachtexte des Deutschen
4.2.1.1. Analysebeispiel 1: Aktien Tokio
4.2.1.1.1. Quaestio und referentielle Besetzung
4.2.1.1.2. Referentielle Bewegung
4.2.1.2. Analysebeispiel 2: Aktien China
4.2.1.2.1. Quaestio und referentielle Besetzung
4.2.1.2.2. Referentielle Bewegung
4.2.1.2.4. Charakteristik der Nebenstruktur
4.2.1.3. Analysebeispiel 3: Aktien Asien
4.2.1.3.1. Quaestio und referentielle Besetzung
4.2.1.3.2. Referentielle Bewegung
4.2.1.3.4. Charakteristik der Nebenstruktur
4.2.2. Fachtexte des Polnischen
4.2.2.1.1. Quaestio und referentielle Besetzung
4.2.2.1.2. Referentielle Bewegung
4.2.2.2.1. Quaestio und referentielle Besetzung←6 | 7→
4.2.2.2.2. Referentielle Bewegung
4.2.2.3.1. Quaestio und referentielle Besetzung
4.2.2.3.2. Referentielle Bewegung
4.2.2.4. Nebenstrukturen in Fachtexten des Polnischen
5. Ergebnisse der kontrastiven Analysen
5.1. Konzeptdomäne PERSON/OBJEKT
Details
- Pages
- 292
- Publication Year
- 2017
- ISBN (PDF)
- 9783631724446
- ISBN (ePUB)
- 9783631724453
- ISBN (MOBI)
- 9783631724460
- ISBN (Hardcover)
- 9783631724439
- DOI
- 10.3726/b11214
- Language
- German
- Publication date
- 2017 (December)
- Keywords
- Informationsstruktur Wirtschaftstexte Börsenkommunikation Quaestio-Ansatz Polnisch
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 292 S., 8 s/w Abb., 30 s/w Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG