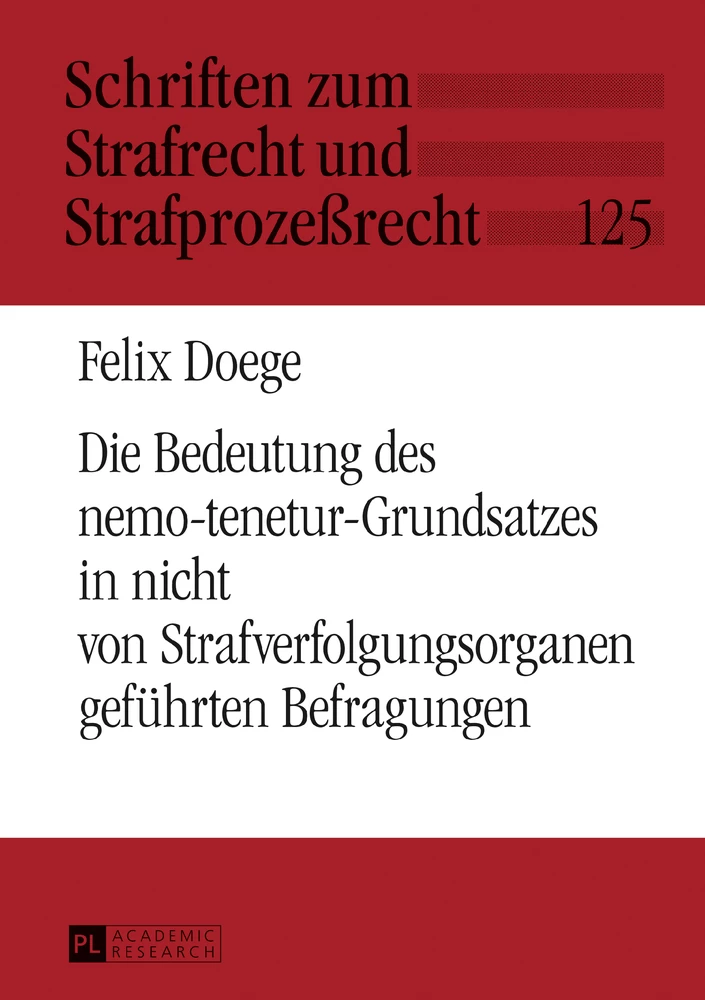Die Bedeutung des nemo-tenetur-Grundsatzes in nicht von Strafverfolgungsorganen geführten Befragungen
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- A. Einleitung
- B. Hintergrund des nemo-tenetur-Grundsatzes
- I. Historie
- 1. Vorbemerkung
- 2. Geschichtlicher Abriss
- a. Römisches Recht
- b. Talmud
- c. Altdeutscher Rechtsgang
- d. Kanonisches Recht
- e. Der Inquisitionsprozess des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit
- f. Common Law
- g. Deutsches Recht
- 3. Erkenntnisse aus der Historie
- II. Der nemo-tenetur-Grundsatz im prozessualen Gesamtgefüge
- 1. Verhältnis zu den Prozesszielen
- 2. Nemo-tenetur-Grundsatz und Geständnis
- 3. Nemo-tenetur-Grundsatz und Akkusationsmaxime
- 4. Nemo-tenetur-Grundsatz und die Stellung des Beschuldigten als Prozesssubjekt
- 5. Nemo-tenetur-Grundsatz und Staatsverständnis
- 6. Fazit
- III. Gesetzliche Grundlagen
- 1. Einfachgesetzliche Vorschriften
- a. § 136 Abs. 1 S. 2 StPO
- b. § 136a StPO
- c. § 55 StPO
- d. Art. 6 EMRK
- aa. Nemo tenetur und fair trial
- bb. Der nemo-tenetur-Grundsatz in der Rechtsprechung des EGMR
- e. Art. 14 Abs. 3 lit. g. IPBPR
- 2. Verfassungsrechtliche Verankerung
- a. Persönlichkeitsrecht
- b. Informationsbeherrschungsrecht
- c. Justizgrundrecht
- IV. Fazit: Der Schutzzweck der prozessualen Autonomie
- C. Vorläufige Schutzbereichsbestimmung auf Grundlage der gefundenen Ergebnisse
- I. Absolutheit des Schutzes
- II. Die Berechtigung der Differenzierung zwischen aktiver Mitwirkung und passiver Duldung
- III. Nonverbale Mitwirkungsakte
- IV. Verbot der Würdigung des Schweigens
- V. Anforderung an das Zwangselement
- D. Der nemo-tenetur-Grundsatz in der Beweisverbotsdogmatik
- I. Grundlagen der Beweisverbotsdogmatik
- II. Nemo-tenetur-Grundsatz und Beweisverbotsdogmatik
- III. Die Fernwirkung
- IV. Die sog. Widerspruchslösung
- V. Die Fortwirkung und die Pflicht zur qualifizierten Belehrung
- E. Außerstrafprozessuale Auskunftspflichten
- I. Der „Gemeinschuldner-Beschluss“ des BVerfG
- 1. Zentrale Aussagen
- 2. Die nemo-tenetur-Dogmatik des Gemeinschuldner-Beschlusses
- 3. Die (angebliche) Geltung des nemo-tenetur-Grundsatzes außerhalb des Strafverfahrens
- 4. Der „Gemeinschuldner-Mechanismus“
- II. Unzulässiger Aussagezwang
- 1. Auskunftsanspruch der Haftpflichtversicherung
- 2. § 25 Abs. 1 AsylG
- 3. Stellungnahme
- a. Anforderungen an das Zwangselement
- b. Pflicht zur Selbstbelastung gegenüber einer Privatperson
- c. Fazit
- III. Ausschlussmechanismen
- 1. Verzicht auf Aussagezwang
- a. Auskunftsverweigerungsrechte
- aa. Belehrungspflicht
- bb. Keine Erstreckung auf sonstige Mitwirkungspflichten
- (i) Dokumentationspflichten
- (ii) Vorlagepflichten
- α) Kombination aus Dokumentations- und Vorlagepflichten
- β) Eigenständige Herausgabepflichten
- (iii) Mitteilungsplichten
- (iv) Anzeigepflichten
- cc. Fazit
- b. Zwangsmittelverzicht
- aa. Grundlegendes
- bb. § 393 Abs. 1 S. 2 AO
- (i) Der nemo-tenetur-Grundsatz im Steuerrecht
- (ii) Das Zwangsmittelverbot des § 393 Abs. 1 S. 2 AO
- (iii) § 370 AO
- α) Lösung der Rechtsprechung
- αα) Identische Steuersachverhalte
- ββ) Verschiedene Steuersachverhalte
- χχ) Berichtigungspflicht gem. § 153 Abs. 1 Nr. 1 AO
- β) Würdigung
- c. Verfahrensaussetzung
- aa. Grundlegendes
- bb. § 138 ZPO, § 149 ZPO
- 2. Ausschluss der strafprozessualen Nutzung
- a. Verwertungs- und Verwendungsverbote
- aa. Grundlegendes
- bb. Hauptbeispiele
- (i) § 97 Abs. 1 S. 3 InsO
- α) Tatbestand
- αα) In Erfüllung der Auskunftspflicht
- ββ) Auskunftsberechtigte
- χχ) Auskünfte im Insolvenzantrag
- δδ) Vorlage von Unterlagen
- β) Rechtsfolge
- αα) Verwertungsverbot
- ββ) Fernwirkung
- χχ) Frühwirkung
- χ) Fazit
- (ii) § 802c ZPO
- (iii) § 393 Abs. 2 AO
- (iv) § 630c Abs. 2 S. 3 BGB
- cc. Reichweite des Verwertungsverbots
- b. Offenbarungsverbote
- c. Beschlagnahmeverbote
- d. Strafbarkeitsausschluss
- aa. Grundlegendes
- bb. Die strafbefreiende Selbstanzeige im Steuerrecht, § 371 AO
- (i) Selbstanzeige und nemo-tenetur-Grundsatz
- (ii) Verhältnis der strafbefreienden Selbstanzeige (§ 371 AO) zu den übrigen Schutzmechanismen
- α) Zwangsmittelverbot, § 393 Abs. 1 S. 2 AO
- β) Verwertungsverbot, § 393 Abs. 2 AO
- χ) Suspendierung der materiellen Strafbewehrung
- (iii) Abschließende Betrachtung
- IV. Fazit
- F. Relevanz des Nemo-tenetur-Grundsatzes in Befragungen durch Privatpersonen
- I. Die Grundsätze privater Beweiserlangung
- 1. Zentrale Weichenstellung: Staatliche Zurechnung
- 2. Selbstständige Beweisverwertungsverbote bei materiell privater Beweiserlangung
- a. Das Meinungsspektrum
- aa. Fallgruppen der h.M.
- bb. Analogie zu § 136a StPO
- cc. Materielle Strafrechtswidrigkeit als Anknüpfungspunkt, sog. Einheitsthese
- b. Der eigene Standpunkt
- 3. Drittwirkung des nemo-tenetur-Satzes?
- II. Staatlich initiierte Befragung
- 1. Verdeckte Befragung
- a. Die sog. Hörfalle
- aa. Hintergrund
- bb. Die Entscheidung des Großen Senats (BGH GS NStZ 1996, 502)
- b. Lösungsansätze
- aa. Unvereinbarkeit mit § 136 StPO
- (i) Lösung über den Vernehmungsbegriff
- (ii) Umgehung der Belehrungspflicht des § 136 Abs. 1 S. 2 StPO
- (iii) Grundsatz der Offenheit der staatlichen Befragung
- bb. Verstoß gegen den nemo-tenetur-Grundsatz
- (i) Enges versus weites nemo-tenetur-Verständnis
- (ii) Vermittelnde Ansätze
- (iii) Stellungnahme
- cc. Lösung über das Täuschungsverbot des § 136a StPO
- (i) Verhältnis zur Selbstbelastungsfreiheit
- (ii) Anwendbarkeit
- α) Planwidrige Regelungslücke
- β) Vergleichbare Interessenlage
- αα) Zurechnung
- (1) Ausgangspunkt
- (2) Konkretisierung durch materiell-strafrechtliche Anleihen
- (3) Konkretisierung durch öffentlich-rechtliche Anleihen
- (4) „Agent of the state“ – die Rechtsprechung des EGMR
- (5) Kasuistische Präzisierung
- (6) Exzess
- (7) Fazit
- ββ) „Vernehmungsähnliche Situation“
- χχ) Fazit
- (iii) Täuschungsqualität
- α) Bloßes Ausnutzen eines Irrtums?
- β) Beeinträchtigung der Willensentschließungsfreiheit
- (iv) Folgerung für die verdeckte Befragung durch Privatpersonen
- α) De lege lata
- β) De lege ferenda
- 2. Besondere Modalitäten der verdeckten Befragung
- a. Entwicklung der Rechtsprechung
- aa. Übersicht
- (i) BGH (3. Senat) NJW 2007, 3138
- (ii) BGH (4. Senat) NStZ 2009, 343
- (iii) BGH (5. Senat) NJW 2010, 3670
- (iv) BGH (3. Senat) StV 2012, 129
- bb. Entwicklungstendenzen
- cc. Kriterien
- (i) Ausübung des Schweigerechts
- (ii) Vernehmungsähnliche Befragungen
- α) Anforderungen an das Vorliegen einer vernehmungsähnlichen Befragung
- β) Rechtfertigung des Kriteriums aus dem Gedanken der Risikoverteilung
- b. Konkretisierung des Kriteriums der Risikoverteilung
- aa. Anerkannte Fallgruppen
- (i) Der „Romeo“-Fall
- (ii) Der „Priester“-Fall
- (iii) Untersuchungshaft-Fälle
- bb. Lösung der Fälle der Rechtsprechung
- cc. Verbleibende Fälle
- (i) Körperlich-seelische Defizite des Beschuldigten
- (ii) Täuschungen außerhalb von Befragungen
- (iii) Stimmfalle
- (iv) Verdeckte Befragung zeugnisverweigerungsberechtigter Zeugen
- 3. Zusammenfassung
- III. Eigeninitiativ ermittelnde Privatpersonen
- 1. Bisherige Erscheinungsformen
- a. Die grundsätzliche Zulässigkeit privater Ermittlungen
- b. Die Grenzen der Zulässigkeit privater Ermittlungen
- c. Die Rolle von Befragungen und ihre grundsätzliche Irrelevanz unter dem Aspekt der Selbstbezichtigungsfreiheit
- 2. Internal investigations
- a. Das Phänomen
- b. Die Zulässigkeit
- c. Einordnung in die Systematik privater Beweiserlangung: Staatliche Zurechnung
- d. Die sog. „Interviews“
- aa. Ablauf in der Praxis
- bb. Die Thesen der Bundesrechtsanwaltskammer
- e. Nemo-tenetur-relevante Zwangssituation in den Interviews
- aa. Auskunftspflicht
- (i) Bestehen einer arbeitsvertraglichen Auskunftspflicht
- α) Unmittelbarer Arbeitsbereich
- β) Allgemeiner Auskunftsanspruch, §§ 242, 241 Abs. 2 BGB
- χ) Ergebnis
- (ii) Auskunftspflicht gegenüber den Ermittlern
- bb. Hinreichender Zwangscharakter
- (i) Privatvertragliche Auskunftspflicht
- (ii) Freiverantwortliche Übernahme einer Selbstbelastungspflicht
- cc. Faktisch-wirtschaftliche Zwangslage
- f. Übertragung der Gemeinschuldner-Grundsätze: Beweisverwertungsverbot oder Auskunftsverweigerungsrecht?
- g. Einzelheiten des Verwertungsverbots
- aa. Fernwirkung
- bb. Verwertbarkeit der übrigen Ermittlungsergebnisse
- cc. Keine Geltung gegenüber Dritten
- dd. Widerspruchslösung
- ee. Qualifizierte Belehrung
- h. Verwertbarkeit bei nicht bestehender Aussagepflicht
- i. Abweichende Lösung bei cross border investigations
- j. Beschlagnahmefähigkeit der Interview-Protokolle
- aa. § 97 StPO
- bb. § 160a Abs. 1 StPO
- cc. LG Hamburg
- dd. LG Mannheim
- ee. Lösung
- (i) Verteidigungsunterlagen
- (ii) Kein Nebenbeteiligter
- α) Gewahrsam des Rechtsanwalts
- β) Gewahrsam des Unternehmens
- (iii) Ergebnis
- ff. Zusammenfassung
- G. Abschließende Schutzbereichsbestimmung
- H. Resümee
- Literatur
Inhaltsverzeichnis
B. Hintergrund des nemo-tenetur-Grundsatzes
e. Der Inquisitionsprozess des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit
3. Erkenntnisse aus der Historie
II. Der nemo-tenetur-Grundsatz im prozessualen Gesamtgefüge
1. Verhältnis zu den Prozesszielen
2. Nemo-tenetur-Grundsatz und Geständnis
3. Nemo-tenetur-Grundsatz und Akkusationsmaxime
4. Nemo-tenetur-Grundsatz und die Stellung des Beschuldigten als Prozesssubjekt
5. Nemo-tenetur-Grundsatz und Staatsverständnis
1. Einfachgesetzliche Vorschriften
aa. Nemo tenetur und fair trial
bb. Der nemo-tenetur-Grundsatz in der Rechtsprechung des EGMR
e. Art. 14 Abs. 3 lit. g. IPBPR
2. Verfassungsrechtliche Verankerung
b. Informationsbeherrschungsrecht
IV. Fazit: Der Schutzzweck der prozessualen Autonomie
C. Vorläufige Schutzbereichsbestimmung auf Grundlage der gefundenen Ergebnisse
II. Die Berechtigung der Differenzierung zwischen aktiver Mitwirkung und passiver Duldung
III. Nonverbale Mitwirkungsakte
IV. Verbot der Würdigung des Schweigens
V. Anforderung an das Zwangselement
D. Der nemo-tenetur-Grundsatz in der Beweisverbotsdogmatik
I. Grundlagen der Beweisverbotsdogmatik
II. Nemo-tenetur-Grundsatz und Beweisverbotsdogmatik
IV. Die sog. Widerspruchslösung
V. Die Fortwirkung und die Pflicht zur qualifizierten Belehrung
E. Außerstrafprozessuale Auskunftspflichten
I. Der „Gemeinschuldner-Beschluss“ des BVerfG
2. Die nemo-tenetur-Dogmatik des Gemeinschuldner-Beschlusses
3. Die (angebliche) Geltung des nemo-tenetur-Grundsatzes außerhalb des Strafverfahrens
4. Der „Gemeinschuldner-Mechanismus“
1. Auskunftsanspruch der Haftpflichtversicherung
a. Anforderungen an das Zwangselement
b. Pflicht zur Selbstbelastung gegenüber einer Privatperson
a. Auskunftsverweigerungsrechte
bb. Keine Erstreckung auf sonstige Mitwirkungspflichten
α) Kombination aus Dokumentations- und Vorlagepflichten
β) Eigenständige Herausgabepflichten
(i) Der nemo-tenetur-Grundsatz im Steuerrecht
(ii) Das Zwangsmittelverbot des § 393 Abs. 1 S. 2 AO
αα) Identische Steuersachverhalte
ββ) Verschiedene Steuersachverhalte
χχ) Berichtigungspflicht gem. § 153 Abs. 1 Nr. 1 AO
2. Ausschluss der strafprozessualen Nutzung
a. Verwertungs- und Verwendungsverbote
αα) In Erfüllung der Auskunftspflicht
χχ) Auskünfte im Insolvenzantrag
cc. Reichweite des Verwertungsverbots
bb. Die strafbefreiende Selbstanzeige im Steuerrecht, § 371 AO
(i) Selbstanzeige und nemo-tenetur-Grundsatz
(ii) Verhältnis der strafbefreienden Selbstanzeige (§ 371 AO) zu den übrigen Schutzmechanismen
α) Zwangsmittelverbot, § 393 Abs. 1 S. 2 AO
β) Verwertungsverbot, § 393 Abs. 2 AO
χ) Suspendierung der materiellen Strafbewehrung
(iii) Abschließende Betrachtung
F. Relevanz des Nemo-tenetur-Grundsatzes in Befragungen durch Privatpersonen
I. Die Grundsätze privater Beweiserlangung
1. Zentrale Weichenstellung: Staatliche Zurechnung
2. Selbstständige Beweisverwertungsverbote bei materiell privater Beweiserlangung
cc. Materielle Strafrechtswidrigkeit als Anknüpfungspunkt, sog. Einheitsthese
3. Drittwirkung des nemo-tenetur-Satzes?
II. Staatlich initiierte Befragung
bb. Die Entscheidung des Großen Senats (BGH GS NStZ 1996, 502)
aa. Unvereinbarkeit mit § 136 StPO
(i) Lösung über den Vernehmungsbegriff
(ii) Umgehung der Belehrungspflicht des § 136 Abs. 1 S. 2 StPO
(iii) Grundsatz der Offenheit der staatlichen Befragung
bb. Verstoß gegen den nemo-tenetur-Grundsatz
(i) Enges versus weites nemo-tenetur-Verständnis
cc. Lösung über das Täuschungsverbot des § 136a StPO
(i) Verhältnis zur Selbstbelastungsfreiheit
β) Vergleichbare Interessenlage
(2) Konkretisierung durch materiell-strafrechtliche Anleihen
(3) Konkretisierung durch öffentlich-rechtliche Anleihen
(4) „Agent of the state“ – die Rechtsprechung des EGMR
ββ) „Vernehmungsähnliche Situation“
α) Bloßes Ausnutzen eines Irrtums?
β) Beeinträchtigung der Willensentschließungsfreiheit
(iv) Folgerung für die verdeckte Befragung durch Privatpersonen
2. Besondere Modalitäten der verdeckten Befragung
a. Entwicklung der Rechtsprechung
(i) BGH (3. Senat) NJW 2007, 3138
(ii) BGH (4. Senat) NStZ 2009, 343
(iii) BGH (5. Senat) NJW 2010, 3670
(iv) BGH (3. Senat) StV 2012, 129
(i) Ausübung des Schweigerechts
(ii) Vernehmungsähnliche Befragungen
α) Anforderungen an das Vorliegen einer vernehmungsähnlichen Befragung
β) Rechtfertigung des Kriteriums aus dem Gedanken der Risikoverteilung
b. Konkretisierung des Kriteriums der Risikoverteilung
bb. Lösung der Fälle der Rechtsprechung
(i) Körperlich-seelische Defizite des Beschuldigten
(ii) Täuschungen außerhalb von Befragungen
(iv) Verdeckte Befragung zeugnisverweigerungsberechtigter Zeugen
III. Eigeninitiativ ermittelnde Privatpersonen
1. Bisherige Erscheinungsformen
a. Die grundsätzliche Zulässigkeit privater Ermittlungen
b. Die Grenzen der Zulässigkeit privater Ermittlungen
c. Einordnung in die Systematik privater Beweiserlangung: Staatliche Zurechnung
bb. Die Thesen der Bundesrechtsanwaltskammer
e. Nemo-tenetur-relevante Zwangssituation in den Interviews
(i) Bestehen einer arbeitsvertraglichen Auskunftspflicht
α) Unmittelbarer Arbeitsbereich
β) Allgemeiner Auskunftsanspruch, §§ 242, 241 Abs. 2 BGB
(ii) Auskunftspflicht gegenüber den Ermittlern
bb. Hinreichender Zwangscharakter
(i) Privatvertragliche Auskunftspflicht
(ii) Freiverantwortliche Übernahme einer Selbstbelastungspflicht
cc. Faktisch-wirtschaftliche Zwangslage
g. Einzelheiten des Verwertungsverbots
bb. Verwertbarkeit der übrigen Ermittlungsergebnisse
cc. Keine Geltung gegenüber Dritten
h. Verwertbarkeit bei nicht bestehender Aussagepflicht
i. Abweichende Lösung bei cross border investigations
j. Beschlagnahmefähigkeit der Interview-Protokolle
α) Gewahrsam des Rechtsanwalts
G. Abschließende Schutzbereichsbestimmung
Details
- Pages
- 539
- Publication Year
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783631694848
- ISBN (ePUB)
- 9783631694855
- ISBN (MOBI)
- 9783631694862
- ISBN (Hardcover)
- 9783631693520
- DOI
- 10.3726/978-3-631-69484-8
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (August)
- Keywords
- Selbstbelastungsfreiheit Private Ermittlungen Internal Investigations Auskunftspflicht Verdeckte Befragung V-Mann
- Published
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2016. 546 S.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG