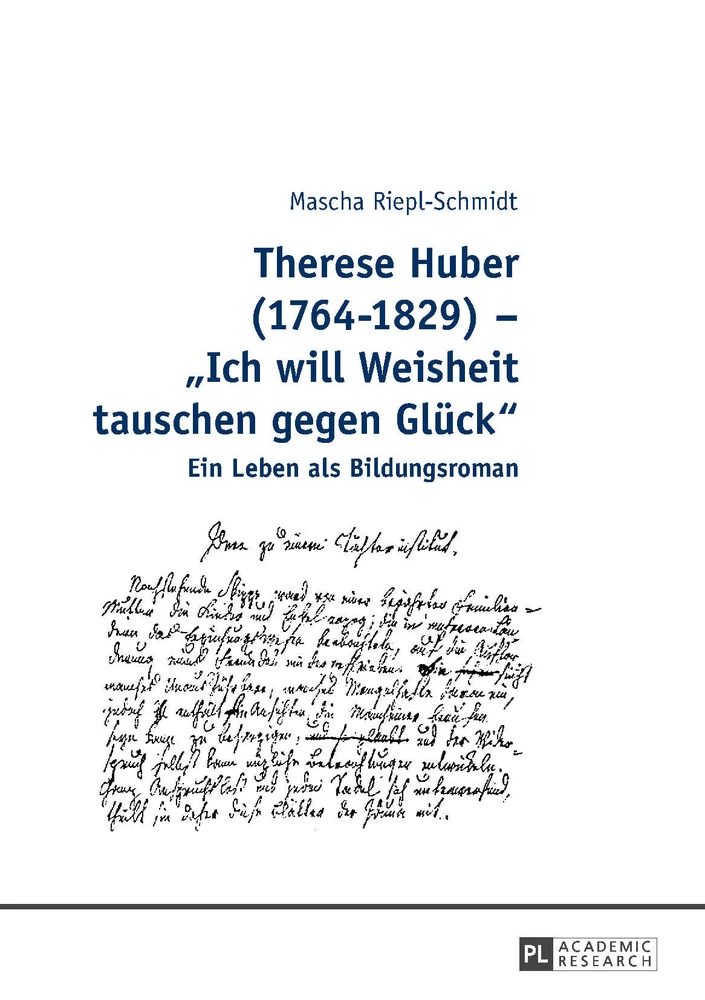Therese Huber (1764–1829) – «Ich will Weisheit tauschen gegen Glück»
Ein Leben als Bildungsroman
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- 1 Ein Leben als Bildungsroman
- 1.1 Bildungserwerb als Sinn des Lebens
- 1.2 Chronologie eines Lebens im Licht seiner Prägungen durch Bildung
- 1.3 Stuttgart – Residenzstadt des Königreichs Württemberg (Therese Hubers Stationen in Stuttgart 1798–1805 und 1816–1823) Die Bildungsbürgerin und „citoyenne“
- 1.4 Das „Morgenblatt für gebildete Stände“
- 1.5 Die Redakteurin
- 2 Therese Huber: Die Person und das Werk im Echo der Rezeption bis heute – eine exemplarische Auswahl
- 3 „Ich schuf, ich erbaute mein eigenes Selbst“
- 3.1 Therese Heyne-Forster-Huber in der Diskussion und ihre lebenslange Rivalität mit Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling
- 3.2 Die Ehevorstellungen und die sogenannte „ménage à trois“ Therese Forster-Hubers – Georg Forster und Ludwig Ferdinand Huber im Vergleich
- 4 Therese Huber als Erzieherin im zeitgenössischen Bildungszusammenhang und das handschriftliche Konzept ihrer „Ideen zu einem Töchterinstitut“ 1817/18
- 4.1 Ideen zu einem Töchterinstitut – Biographischer und historischer Kontext: Eine vergebliche Vorarbeit zur geplanten Gründung des Königin-Katharina-Stifts in Stuttgart 1818?
- 4.2 Die „Ideen“ – Entwicklung und Gedankengang des Konzepts
- 4.3 Ideen zu einem Töchterinstitut
- 5 Die Mitarbeit am Morgenblatt: Enzyklopädisches Gerüst und Summe des Lebens
- Epilog
- Kurzbiographien der wichtigsten Personen im Umfeld Therese Hubers
- Bibliographie der Primärliteratur: Erstausgaben und Übersetzungen (Therese und Ludwig Ferdinand Huber, Georg Forster)
- Bibliographie der Sekundärbibliographie zu Therese Huber-Forster-Heyne
- Bildnachweis
- Siglen der benutzten Archive und Handschriftensäle (Im Zusammenhang der Recherche der Originalbriefe und Manuskripte)
Prolog
„Ich will Weisheit tauschen gegen Glück“1
Mit Bedacht habe ich dies aufbegehrend stolze Briefzitat Therese Hubers zum Titel dieser Arbeit erwählt: Der resignativ anmutenden Aussage über den Glücksverlust, wohnt als Hoffnung zugleich eine von der Weisheit erwartete Tröstung inne. Trotz ihrer Verzweiflung zeigt die nicht vom Schicksal verwöhnte Schreiberin jedoch kein geschmälertes Selbstbewusstsein: Wenn ich schon das Glück nicht mehr bekommen kann, dann widme ich mich der Weisheit – sie könnte die Krönung meines bisherigen Bildungsbemühens sein…
Am Abend des Weihnachtstages 1804 – er ist der Todestag ihres erst vierzigjährigen Gatten Ludwig Ferdinand Huber, 1764–1804, – schreibt sie aus Ulm, ihrem damaligen Wohnsitz, ins holsteinische Bramstedt an ihren Jugendfreund Wilhelm Meyer, mit dem sie einst während ihrer ersten Ehe mit Georg Forster, 1754–1794, in einer schwärmerischen Liebschaft verbunden gewesen war. Der zitierte Satz steht am Ende des Briefes – wie eine zur Tapferkeit aufmunternde Quintessenz: In großer Trauer und Erschöpfung kommt die Sehnsucht nach Weisheit zum Ausdruck, in der sie Trost vermutet. Von ihr erhofft sie die Rettung aus einer Situation voller Verzweiflung und Resignation. Durch sie erstrebt sie Menschlichkeit und Güte und doch vielleicht auch wieder ein anderes Glück?
Die 1764 in Göttingen in einen Professorenhaushalt hineingeborene Therese Heyne macht es der textinterpretatorischen und biographischen Deutung schwer: Ihre eigenen Widersprüche sind gewaltig und werden von ihr in ihren Briefen und ihren schriftstellerischen Arbeiten immer wieder in stilisierten Inszenierungen – so scheint es – dargeboten. Dazuhin haben viele der Therese Huber gewidmeten zeitgenössischen Kommentare, die sie oft sehr harsch kritisierten, eine Patina über sie gelegt, die sie in Vergessenheit oder ins Abseits geraten ließen.
Dass sie aber eine überaus wahrheitsliebende Frau war, wird in zahlreichen Briefen und schriftstellerischen Arbeiten deutlich: mit „einem Wahrheitsinn, wie er ihm sonst noch nicht vorgekommen“, hatte Forster einmal von ihr ← 9 | 10 → gesagt.2 Und sie selbst schrieb 1815: „[…] ich bin […] mit einem Muthigen Bewußtsein nie etwas Unedles gewollt zu haben durchs Leben gegangen; die mich am innigsten kannten, Männer und Freundinnen beide in geringer Zahl aber gewichtige Menschen an Menschenwerth, liebten mich bis im Tod um einer Wahrheit und Güte willen.“3
Ihr, der an der „Aufklärung“ sich abarbeitenden Frau auf der Schwelle vom 18. ins 19. Jahrhundert, mit einem guten Wahrheitsbegriff zu begegnen, ist mein Anspruch, obwohl das Werk und die Briefschaften des unfertigen, sich selbst suchenden Mädchens, der jungen Ehefrau aus Wilna, der frankophilen Mainzer Jakobinerin, der entwurzelten Basler und in Neuchâtel als Witwe wiederverheirateten Emigrantin und der ersten deutschen Redakteurin einer Stuttgarter Tageszeitung – dem „Morgenblatt für gebildete Stände“, – der fast vergessenen Schriftstellerin, Übersetzerin und selbsternannten pädagogischen Theoretikerin Therese Huber, geb. Heyne, verwitwete Forster immens ist. Da der Nachlass ihres Schreibkompendiums bisher nicht in allen Bereichen intensiver erforscht worden ist, soll hier in einer interdisziplinär angelegten wissenschaftlichen Vertiefung und im genderorientierten Ansatz umkreist, beschrieben und interpretiert werden, welche Rolle das Streben nach Bildung im Leben und Schreiben der Aufklärerin spielte und welche Resultate daraus erwuchsen:
So soll die Bewertung des Huberschen Werkes und ihrer Person aus der zumeist negativen Rezeptionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts herausgelöst werden. So soll aber auch mit unvoreingenommenen Blick das Zusammenspiel ihres familiären und gesellschaftlichen Wirkens begutachtet werden, um den wie auch immer gearteten zeitgenössischen und posthumen Wirkungsgrad dieser ganz unzeitgemäß erwerbstätigen und familiär spektakulär agierenden Frau zu definieren.
Ihre hauptsächlichen Aktionsbereiche als Redakteurin und Autorin des „Morgenblatts für gebildete Stände“, als immense Briefschreiberin, als engagierte Pädagogin und als Autorin von Erzählungen, die hier aber nicht im Zentrum der Betrachtungen steht, habe ich anhand der überlieferten Fakten und Quellen erforscht. Im Durchleuchten ihrer eigenen Sichtweise und der einiger Zeitgenossen und -genossinnen wurden diese Quellen mit einer heutigen, durch neue Erkenntnisse pointierten Lesart kontrapunktiert. Eine größtmögliche inhaltliche Bestandsaufnahme ihrer journalistischen Arbeiten für das „Morgenblatt“ wurde erstellt, die ihres Werkes war in dem genannten schwerpunktorientierten Rahmen ← 10 | 11 → jedoch fast nur in einem weitgesteckten bibliographischen Raster möglich. Der zuletzt genannte Fundus wird mit ausführlichen Primär- und Sekundärbibliographien im Anhang dokumentiert.
Therese Hubers literarischer Nachlass umfasst im ganzen drei Quellenblöcke: Die in Stuttgart edierte Cottasche Tageszeitung „Morgenblatt für gebildete Stände“ und einige Journaleditionen, an denen sie beteiligt war, dann ihre in deutsch und französisch abgefassten Briefe und handschriftlichen Entwürfe und nicht zuletzt ihre Erzählungen und Romane.
Im Bereich ihrer redaktionellen Tätigkeit, ihrer journalistischen Mitarbeit, ihrer Übersetzungstätigkeit und als Schreiberin von Fortsetzungsromanen war Therese Hubers publizistische Arbeit anhand ihrer thematischen Schwerpunkte im „Morgenblatt“ zu sichten. Es ist sinnvoll und wichtig, die Auflistung ihrer anonym erschienenen Beiträge zu dokumentieren. Das war im Cotta-Archiv in Marbach anhand der Redaktionsbücher „ihrer“ 22 Jahrgänge des „Morgenblatts für gebildete Stände“ möglich. Die Themen ihrer Mitarbeit und ihrer Lebensumstände sind hier als biographisch-chronologische Morgenblattauflistung – auch mit Regesten ihrer Erzählungen in Fortsetzungen – in Kapitel fünf dokumentiert.
Dagegen bergen Therese Hubers Briefe und Entwürfe, die in Archiven in fast ganz Europa verstreut sind, einen kulturpolitischen Schatz, der in toto die Themenstellung einer Dissertation weit überschreitet. Die auf meinen Archivreisen gefundenen Briefe und deren akribische Transkription habe ich in bezug auf die Analyse und Interpretation der von mir beabsichtigten Themenwahl und den damit verknüpften Fragestellungen ausgewertet. Ein Abgleich der nicht immer gut leserlichen Handschrift der Protagonistin war mir durch die in den letzten Jahren erschienene, allerdings noch nicht abgeschlossene Edition der Huberschen Briefe von Magdalene Heuser4 (Universität Osnabrück), meistens möglich. Die autobiographische Wucht der Briefe konnte ich durch das Auffinden eines handschriftlich niedergelegten, bisher nicht publizierten Erziehungskonzepts ergänzen, das die Ambivalenz der Huberschen Pädagogikvorstellungen deutlich macht. Diese „Ideen zu einem Töchterinstitut“5 hatte die Familienmutter – wie sie sich nannte – um 1817 für die damalige württembergische Königin Katharina im Vorfeld der Gründung des späteren Stuttgarter Katharinastiftes entworfen. Ihr Entwurf ist allerdings im Zuge der Schulgründung des Instituts für höhere Töchter wohl ← 11 | 12 → wegen der zu progressiven oder idealistischen Inhalte nicht verwirklicht worden. Dieses Hubersche Konzept für eine andere Mädchenausbildung und -bildung soll hier ebenfalls historisch vernetzt vorgestellt und interpretiert werden.
Für die Romane und Erzählungen aber liegt bis heute noch keine vollständige Erfassung vor.6 Die rund 60 Werke, die im Anhang als Primärbibliographie aufgeführt sind, habe ich auf autobiographische Hinweise und Inhalte durchgesehen. Die Textanalyse und inhaltliche Bewertungen werden hier jedoch nur in der autobiographischen Zuspitzung behandelt.
Im Laufe ihres Lebens hat die Autorin mit Selbstdeutungen, Selbststilisierungen und Fiktionalisierungen nicht gespart. Diese selbstreflektorische Attitüde ihrer eigenen Person, ihres privaten und auch beruflichen Umfeldes ist der Kern des dritten Kapitels, das auch meine Auseinandersetzungen mit Therese Huber in seiner dichten Komplexität vorstellen soll.
Eine Arbeit, die sich mit den genannten Forschungsdesideraten biographisch und historisch vorwiegend an Hubers Lebenszeit in der württembergisch königlichen Residenzstadt Stuttgart orientiert, soll aber auch vermitteln, dass es im deutschen Südwesten Frauen durchaus möglich war – wenn auch mit zumeist schicklich verbrämten Höflichkeitshaltungen – Menschen- und Bürgerinnenrechte einzufordern. Mit diesen durch die französische Revolution legitimierten Vorstellungen, sollte nicht nur die Hausarbeit und die Erfordernisse einer bürgerlich orientierten Hauskultur höher bewertet, sondern auch für bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen plädiert werden, um damit die Erkenntnis zu unterstützen, dass „Weiber“ auch ohne Ehestand ebenso wertvoll wie Männer sind. Und dafür schienen weibliche Berufe für Therese Huber auch außerhalb der Familie und eine darauf vorbereitende Ausbildung für ihre Geschlechtsgenossinnen wichtig und notwendig zu sein. Die Autorin hat zudem gewusst, dass Autorenschaft Autorität bedeutet: Diese mögliche Einflussnahme hat sie als Redakteurin und Autorin auf unterschiedliche Weise genutzt und hat damit die ihrem Geschlecht zugeordnete Unrechtserfahrung gemindert und öffentlich gemacht.
Während der langen Entstehungsgeschichte dieser Arbeit haben sich immer wieder ungeahnte Hindernisse aufgetürmt, aber auch unterstützende Wegbegleiterinnen und -begleiter eingefunden. Stipendien des „Buntstiftes“ Göttingen (heute: Heinrich-Böll-Stiftung), des Deutschen Literaturarchivs Marbach und des ← 12 | 13 → Erich-Schairer-Journalistenfonds auf Anregung von Frau Agathe Kunze-Schairer haben Existenzsorgen gemildert. Meine Kolleginnen und Freundinnen des Netzwerkes Frauen&Geschichte Baden-Württemberg e. V. – vor allem Dr. Gesa Ingendahl, Babette Lang, Dr. Sybille Oßwald-Bargende, Dr. Sylvia Paletschek und Dr. Sylvia Schraut – haben mit Nachhaken Sorge dafür getragen, das Thema nicht loszulassen. Zu ihnen zählt auch Corinna Schneider, die bei der Buchherstellung außerdem als Expertin zupackend hilfreich wirkte. Und last but not least standen mir im Endspurt der maschinellen Manuskripterstellung Dr. Reinhold Weber von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Stuttgart zusammen mit meiner Tochter Nele Ana Riepl mit ihrem gemeinsamen „know-how“ der Datenverarbeitung verständnisvoll zugeneigt zur Seite.
In einem zeitlich kurz bemessenen Auftakt hat das „Umzingeln“ von Therese Huber bei Professorin Dr. Helga Grubitzsch, Professorin für Literaturwissenschaft an der damaligen Gesamthochschule Paderborn begonnen. Durch ein Forschungscolloquium von Dr. Claudia Opitz-Belakhal, Professorin im Historischen Institut Basel konnte ich am Thema bleiben. Und last but not least ermöglichte es mir Dr. Christel Köhle-Hezinger, Professorin für Volkskunde und Empirische Kulturwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im interdisziplinären Austausch das Thema zu vertiefen und Konzepte zu entwickeln. Im Zusammenhang mit den nicht immer zufriedenstellenden „Archivreisen“ zu den Handschriftenabteilungen der für „die Huber“ einschlägigen deutschen und polnischen Archive, möchte ich hier besonders zwei Anlaufstellen dankend hervorheben: Im Cotta-Archiv des Deutschen Literaturarchivs in Marbach begleiteten mich im Dunkel der Räume selbstverständlich zuarbeitend dessen Leiter Dr. Bernhard Fischer und seine Mitarbeiterin Ursula Weigl und überließen mir zur Einsicht die dort lagernden Morgenblattbände, Folianten und Quarthefte. In der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart war es der Leiter der Handschriftenabteilung Dr. Felix Heinzer, der großes Interesse zeigte und mir Sachkenntnisse vermittelte. Für detaillierte Anregungen und eine unkomplizierte Zuarbeit bin ich auch der Georg-Forster-Gesellschaft an der Universität Kassel und dessen langjährigem Leiter und Mitherausgeber vieler Bände der dort edierten „Georg-Forster-Studien“ Prof. Dr. Horst Dippel sehr dankbar. Auch wollte es der „Zufall“, dass sich in Göttingen mein Weg mit Franz Grass kreuzte, der ein direkter Nachfahre Therese und Georg Forsters ist – er sieht seinem Urahn täuschend ähnlich. Er stellte mir eine Kopie seines bis heute vervollständigten, wunderbar aufbereiteten gigantischen Stammbaums zur Verfügung. Im Peter Lang-Verlag war es Udo Fedderies, der auf mein Manuskript wartend langen Atem bewies. Im Familienverband akzeptierten die Töchter Claudia Miriam und ← 13 | 14 → Nele Ana selbstverständlich und anerkennend die Priorität meines literarischen und kulturgeschichtlichen Rechercheinteresses. Mein Mann Stefan Tümpel sah es mir nach, mit Therese Huber „verheiratet“ zu sein und begleitete mich unter anderem von Stuttgart aus selbstlos zu vielen Bibliotheken und Archiven, in denen Hubersche Quellen lagern – zum Beispiel auch bis nach Krakau – und zu vielen Orten ihres Lebens: von Göttingen über Vilnius (Wilna), Günzburg und Ulm bis zum Friedhof in Augsburg, wo ihr Grab leider nicht mehr auffindbar ist.
Ihnen allen – auch den hier nicht genannten und verlorengegangenen – gilt mein aufrichtiger Dank. Ein Dank, den die frankophile Therese Huber mit mir zusammen Professor Dr. Wolfgang Dahmen, Professor für Rumänische Sprach- und Literaturwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena schuldet. Ein Dank, der aber vor allem meiner Doktormutter Dr. Christel Köhle-Hezinger gebührt, die mich nun bis zur Zielgeraden dieses Projekts zuversichtlich, mit Wertschätzung stützend, begleitet hat. ← 14 | 15 →
1Therese Huber in Ulm an den Jugendfreund Wilhelm Meyer, 1759–1840, genannt Assad in Bramstedt, am Todestag von Ludwig Ferdinand Huber, 24.12.1804, Göttingen SUB, cod. Ms. Th. Huber 8; vgl. auch Heuser, Magdalene et al, (Hg.), Therese Huber, Briefe, Bd. 2, S. 134.
2Zitiert nach Geiger, Ludwig, Dichter und Frauen, Vorträge und Abhandlungen, Bd. 2, 1896, S. 101.
3Therese Huber, Günzburg, an Johann Reinhold in Genua, 22.5.1815, vgl. Heuser, Magdalene et al, (Hg.), Therese Huber, Briefe Bd. 5, S. 545.
4Therese Huber, Briefe, Heuser, Magdalene et al, (Hg.), Bd. 1, 1774–1803, Bd. 2, 1804–Juni 1807, Bd. 4, 1810–1811, Bd. 5, 1812–Juni 1815, 1999–2005, Bd. 6.1 u. 6.2, Juli 1815–September 1818, 2011.
5Therese Huber, Manuskriptfragment um 1817, Ideen zu einem Töchterinstitut, Varnhagen Sammlung, Kraków BJ.
6Siehe auch Therese Hubers zusammen mit ihrer Tochter Therese Forster eigenhändig erstellte Liste: „Was von mir an Original Aufsätzen gedruckt ist“, die ihre Werke und den Ort der Veröffentlichung bis 1819 nicht immer korrekt verzeichnet. Göttingen SUB, cod. Ms. Th. Huber 4, Blätter 151–162 und die Primärbibliographie im Anhang.
„[…] aber jemehr ich von den lieben Deutschland höre, und von der neuen Art Aufklärung besonders welche der Irrstern in Osten so absolut, und SELON SA CAPRICE will bewerckstelligen, je mehr find ich daß wir lieben Norddeutschen, etwas phlegmatisch u. in aller Stille, doch um ein stück weiter hervorgerückt sind, in den goldnen Grundsaz, zu leben und leben zu laßen.“1
Bildung und Freiheit waren die Leitmotive der schon als ganz junge Frau für eine Aufklärung der Bürger und Bürgerinnen werbenden Therese Forster-Huber. Für sich selbst hatte sie spätestens im besten Frauenalter durch Schreiben und Publizieren einen Weg finden können, ihre kulturpolitischen und bildungsorientierten Ziele, enzyklopädisch vertieft und subjektiv ausgewählt zu verbreiten und gezielt einzusetzen. Ihr durch einen „Brodberuf“ gesichertes Leben gab ihr die Möglichkeit, auch als Frau in ihrem auf geistiger Ebene fast rein männlich besetzten Jahrhundert am intellektuellen Überbau der Nation teilzuhaben.
Dass die deutsche Nation, eingebunden in die europäische, politische, wirtschaftliche und kulturelle Gemengelage, sich nicht in einem vernunftbetonten Sinne veränderte und zu sich fand, erzürnte sie. Die im historischen Rückblick als zentral erscheinende Aufgabe des 19. Jahrhunderts: das deutsche Bürgertum zu „bilden“, war ihr Ansporn und ihr persönliches Lebens- und Bildungsprogramm. Nicht nur die Deutschen hatten leiblich und geistig bis zum Zeitalter der Aufklärung in einem Untertanenverhältnis gestanden, in dem absolutistisch regierte Staaten zusammen mit der Aristokratie und der Kirche die „Herr“schaft inne hatten. Die Aufklärungsbewegung hatte das geistige Band gelöst, das leibliche aber blieb im 18. Jahrhundert festgezurrt. In diesem Spannungsverhältnis offenbarte sich die Heimat der Menschen in der Humanität, die idealistisch, wissenschaftlich und sozialgesellschaftlich eingebunden und verstanden, mit Hilfe der Bildungsbürger (bourgeois cultivés) und Staatsbürger (citoyens) ihr Bestes in den Aufbruch des 19. Jahrhunderts einspeisen wollte und dies trotz der immer wieder behindernden Rückschläge durch die Obrigkeit und trotz der Niederlage der „Freyheit“, die für Therese Huber durch die Revolution „in Frankreich ent ← 15 | 16 → blühte“ und die jetzt dahin sei: „O ich sah Wittwen, Gattinnen, Greise die alle Opfer waren mit der Glorie der Märtirer Krone das Wort Liberté! Sprechen – Freiheit – wo rief man Freiheit? Nun – sie ist hin! O Gott sie ist hin! Aber weil ich einmal Freiheit zu erblicken glaubte, und Deutschland sie mordete und England – ja Deutschlands Kriegsknechte und England Gold – beweißt mir daß ohne sie Frankreich nicht hätte können den schönen Kampf vollenden.“2
Georg Wilhelm Hegel,3 für den der im Aufstieg begriffene Napoleon,4 der die Epoche von 1799 bis 18155 prägte, den „Weltgeist zu Pferde“ verkörperte und Therese Forster – Huber, die in ihrer Weltsicht als Jakobinerin in Napoleon ein Werkzeug der Befreiung sah, waren in diesem Punkte zuerst wohl ähnlicher Ansicht. Nach der Rheinbundkonsolidierung des Imperators kritisierte Therese Huber für sie folgerichtig den deutschen und europäischen Widerstand6 gegen Napoleons Herrschaft. Er war für sie der Garant ihrer freiheitlichen Vorstellungen geblieben. Preußen und die deutschen Fürsten hatten zwar im Kampf gegen Napoleon die Unterdrückung der Bürger gelockert, verfolgten aber nach den Karlsbader Beschlüssen7 erneut alle freiheitlichen Regungen. Das Ziel des Bürgertums, ein einiges Deutschland ohne Zoll- und Geistesschranken und ohne Pressezensur zu schaffen, konnte so nicht realisiert werden. Therese Huber scheint diese dialektische Unverträglichkeit gesehen zu haben und hat in der Kompensation des kulturellen Austausches – im Gegensatz zur verweigerten politischen Partizipation – vielleicht eine Chance gesehen, den Staat zumindest in einem Kulturgehäuse anzusiedeln und zu begründen. Bürger und Bürgerinnen hätten so nicht als Untertanen in politischer Unmündigkeit, aber trotzdem als Kulturträger ihren Einfluss geltend machen können. Dieses Ziel konnten sie aber nur teilweise innerhalb des bestehenden Zeitgeists erreichen. ← 16 | 17 →
Immanuel Kant8 hat diesen kulturell intellektuellen Beitrag als den Herrschaftsanspruch der Kritik über den Staat bezeichnet. 1781 hat er in der Vorrede zu seiner „Kritik der reinen Vernunft“9 folgende Sätze vermerkt, die nach dem Tod Friedrich des Großen 1787 nicht mehr in der Druckfassung erschienen: „Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.“10
Preußen war politisch und in seiner beanspruchten geistigen Vorreiterrolle für Deutschland bestimmend. Heinz Gollwitzer11 konstatiert, dass Preußen die Zeitgenossen nicht nur durch seine militärischen und politischen Energien aufgeregt habe: „Preußen war mehr. Es war Symbol einer gemeineuropäischen, aber hier im Norden, mit besonderer Schärfe ausgeprägten Geistesverfassung, Sinnbild unbedingter Rationalität, Ordnung und Zweckhaftigkeit, eines „polizierten“ Lebensstils aufgeklärter Gesinnung und Gesittung. Fritzischer Ruhm und heroische Erinnerungen verklärten Preußenstaat und Preußengeist. Aber die wachsten Köpfe täuschten sich nicht darüber hinweg, daß die beherrschende Geisteshaltung und Lebensform Preußens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in eine Sackgasse geraten waren. Überwindung der Aufklärung – so hieß die Aufgabe, den damals den schöpferischen unter den hellhörigen Zeitgenossen gestellt war.[…] um die die Begrenztheit platt rationalistischen Dankens in eine freiere, reichere und lichtere Sphäre emporzuführen.“12 Therese Forster-Huber hat die Neigung zu diesem freieren, geistigen „goldnen Grundsaz, zu leben und leben zu laßen,“13 im vorangestellten Motto dieses Kapitels sogar für Norddeutsche konstatiert.
Der als Entwicklungsroman im Stufenmodell konzipierte Bildungsroman ist als literarisches Genre in Deutschland gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden und thematisiert die Entwicklung einer jungen (männlichen) Hauptfigur, die ← 17 | 18 → sich in chronologisch anwachsenden Reifestufen mit seinem Lebensumfeld auseinandersetzt. Das bildungsromanhafte Leben Therese Hubers lässt sich jedoch nicht in den Prototyp des klassischen Bildungsromans und dessen Dreiteilung – Jugendjahre – Wanderjahre – Meisterjahre – einsortieren, schon deshalb nicht, weil für sie als Frau nicht die von staatlichen und gesellschaftlichen Normen befreite individuelle Entwicklung zu einem höheren Ziel vorgesehen war. Frauen hatten einen anders definierten gesellschaftlichen Status. Ihnen gebührte im Bildungsroman keine Hauptrolle.
Mit dem Bildungsbegriff der Aufklärung, der sich in der Bildung des Verstandes und der Vernunft und in der Bildung des Nationalcharakters ausweist, hat sie sich aber lebenslang auseinander gesetzt. Sie hat sich selbst dabei als maßgebendes Sprachrohr der auch von ihr als Frau eingeforderten Inhalte verstanden.
Einen Bildungsroman im eigentlichen Sinne, dessen Erzähler seinen eigenen Bildungsvorsprung gegenüber seinem Protagonisten und seiner Leserschaft auslebt, hat sie nicht verfasst. Ihre weiblichen Beispiele einer menschlichen Weiterentwicklung werden als Protagonistinnen einer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt beschrieben, die in einem schwierigen und undurchschaubaren Schicksal befangen sind.
In diesem Sinne habe ich mich während der Bemühungen um eine klare und weitgefächerte Interpretation des Huberschen Lebens und ihrer beruflichen Tätigkeiten dazu inspirieren lassen, mir ihr Leben als Bildungsroman vorzustellen. Aber nicht als einen durchgängig geglückten topos – wie ich es später bei Heinz Gollwitzer für Wilhelm von Humboldt anschaulich begriffen entdeckte: „Wir wollen die Grundlagen nicht gering schätzen, die gelegt wurden, ehe Humboldt begann, seinen eigenen Bildungsroman zu erleben. […] Der flügge Humboldt wollte seine Geisteskräfte nicht auf der Bahn des Regelhaften und Vorgezeichneten tummeln.“14 – sondern im Spiegel ihrer eigenen Bildungs- und Erziehungskonzepte und im Widerstand gegen ihr weiblich bestimmtes und vorausbestimmtes Lebensumfeld.
Therese Hubers Bildungsarbeit halte ich für ein bewusstes, ästhetisches Lebenskonzept. Ihr Bildungsbemühen und ihre Bildungsvorstellungen strukturierten ihr Leben. Und Bildung könnte auch die Überschrift für ihr verästeltes Lebensgerüst sein. In ihren Briefen zeichnet sie das Lebensbild ihres Alltags, in dem aber wiederum Romane als überhöhte, stilisierte Lebensabbilder enthalten sein können – oder eben auch nicht: „Wie ich meinen Mann heirathete, hatte ich keinen Romanenbegriff von dem Glück in der Ehe.“15 ← 18 | 19 →
In ihren Erzählungen folgt sie dem gleichen Prinzip. Hier aber mit dem Anspruch, in allgemeinen menschlichen Zusammenhängen, Richtlinien für das Leben zu vermitteln und trotz negativer Bedingungen des Umfeldes sich zum Besseren entwickelnde Vorbilder zu beschreiben.
Ihr, der unbändig engagierten Lebenskünstlerin möchte ich gerecht werden. Sie hat versucht, ihr Leben, so meine ich, trotz aller missglückten Ansätze und später selbst eingestandenen Fehler würdig zu gestalten und hat es – wie sie es in ihren Briefen schildert und auch indirekt mit hohem moralischem Anspruch einfordert – romanhaft überhöht bestanden: Ihr Leben soll hier – auch um ihr gerecht zu werden – als für ihre Zeit untypischen Bildungsroman in den chronologisch aufeinander folgenden Etappen Göttingen, Hannover, Gotha, Wilna, Mainz, Neuchâtel, Bôle, Tübingen, Stuttgart, Stoffenried, Günzburg, dann wiederum Stuttgart und schließlich Augsburg vorgestellt werden.
Ein Leben, von dem sie meint, das es den geistigen „Spielraum zur Vervollkomnung“ in sich trägt: „Wenn ich Ihnen sage: Behalten Sie Mut! – so ist das so drocken! Liebe S[imanowiz] wägen Sie Gutes gegen Böses ab – Kampf ist Leben, Leben ist unser Spielraum zur Vervollkommnung – der Körper kämpft gegen Uebel, der Geist gegen Kummer allein der Sieg des lezten zeigt uns Vortheile die an kein Wohlsein jenes zu denken mehr Zeit laßen. Ich habe unendlich gelitten und doch schäme ich mich von meinen Leiden zu sprechen wenn ich andrer Thränen sehe.“16
1.1 Bildungserwerb als Sinn des Leben
„In dieser Schickung liegt die ganze Bestimmung meines Lebens.“17
Es ist fast unmöglich, sich der so detailbesessenen Therese Huber, geborenen Heyne, verwitweten Forster, in zweiter Ehe verheirateten Huber interpretierend zu nähern oder ihr uneingeschränkt gerecht zu werden. Sie, die Aufklärerin, die sich in ihren vielschichtigen Arbeitspflichten – als Hausfrau, Mutter, Autorin und journalistisch Tätige – behaupten musste, war in ihrer Zeit zwar eine um Bildung und gesellschaftliche Anerkennung bemühte Ausnahmefrau, ihre Stra ← 19 | 20 → tegien sich anzupassen oder ihre Berufung – diese „Schickung“ – auch zu leben, waren jedoch nicht immer in der erwarteten positiven Auswirkung erfolgreich. Dies hängt sicher mit den sie umgebenden gesellschaftlichen Zwängen zusammen, mag aber auch einem anderen charakterlichen Zug ihres Wesens geschuldet sein, den sie mit Beharrlichkeit zu verdeckten suchte. Sie täuschte damit wohl eine ihr immanente Ruhe vor, die nicht wesensbestimmend war. Den aufbrausenden Zug ihres Charakters versuchte sie zu verbergen. Freunden gegenüber hat sie sich aber als „Feuerwesen“18 preis gegeben und hat damit nicht nur für sich selbst einen bunten Strauß wild blühender Deutungsblüten aus einem stacheligen Distelfeld geflochten: Doch unbestreitbar waren die Widersprüche ihres freiheitlichen Strebens und ihrer Fähigkeit des fatalistisch duldenden Ertragens fast bis zur Selbstaufgabe – so scheint es – die Qualitäten dieser Frau, die durch ihre Intelligenz, ihre schnelle Auffassungsgabe und ihre lebendig erzählerische Präsenz auch im wirklichen Leben bestach, die sich aber auch durch ihre Schärfe und Hartnäckigkeit Feinde machte. Ihre Werke zeugen von einer eigensinnigen Autorinnenschaft und gleichzeitig von einer demütig strengen Arbeitsauffassung. Romanhafte Verklärung und harter Wirklichkeitssinn sind dabei die beiden gegenüber liegenden Pole auch ihrer literarischen Welt.
Dass sie im geistigen Deutschland Anfang des 19. Jahrhunderts – nicht nur im Königreich Württemberg – eine der einflussreichsten, der bestgehassten und innigst geliebten Frauen war und eine der ersten deutschen Redakteurinnen, wenn nicht gar die erste eines fast geschlechtsunspezifischen Bildungsblattes, hätte sie, die gebürtige Göttingerin, mit einer sehr gut erlernten schwäbischen Bescheidenheit weit von sich gewiesen und mit einem kurzen Verweis auf eine unstatthafte Übertreibung unterlaufen. Aber sie muss gewusst haben, dass diese ihre Karriere in einer Zeit, die sie sehr bewusst miterlebte und analysierte, ungewöhnlich war.
Die in Göttingen19 1764 in einen ungeordneten Professorenhaushalt hineingeborene Therese Heyne macht es der biographischen Deutung aber nicht nur wegen ihrer eigenen Widersprüche schwer. Viele der überlieferten zeitgenössischen, ← 20 | 21 → oft sehr harsch kritisierenden Tiraden haben eine Patina über sie gelegt, die sie in Vergessenheit oder ins Abseits geraten ließen. Ist sie deshalb – auch wegen ihres hohen Anspruchs auf Bildung und Bildungserweiterung20 nicht nur aller Frauen, sondern beider Geschlechter – nur ein Desiderat der Frauengeschichte? Nein, ganz sicher nicht. Denn obwohl diese Protagonistin ein gutes Beispiel für die Wissenschaftsvorstellungen einer männlich tradierten Geschichtsüberlieferung ist, die Frauen marginalisiert, füllt sie mit der Beschreibung ihrer eigenen Lebenspraxis und deren Umweltbedingungen, mit ihren Interessen, ihren Gedanken und gesellschaftlichen Bewertungen viele Leerstellen einer einseitigen Überlieferung. Sie dokumentiert das weibliche Leben inmitten ihrer eigenen politischen und kulturellen Umwelt.
Sie lebte in einer Zeit, die in der Frauengeschichtsforschung als erste historische Etappe gilt, in der Frauen in Europa – egal welchen Standes – die ihrem Geschlecht zugeordnete Unrechtserfahrung öffentlich gemacht und leise taktierend, aber auch lauthals provozierend ihre Stimmen gegen Bevormundung, Unterdrückung und fast rechtlosen Status erhoben.
In diesen politischen Aufbruchszeiten haben auch Frauen ihre Menschen- und Bürgerinnenrechte eingeklagt, deren Pflichten sie ja doch stets zu erfüllen hatten. In Therese Hubers Lebenszeit war es die Französische Revolution, deren freiheitsdurstige Regungen gegen regierende Despoten in den deutschen absolutistisch, patriarchalisch regierten Kleinstaaten auch im deutschen Südwesten zu spüren waren. Therese Huber hat diese Zeit auf deutschem Boden im revolutionären, mit Frankreich verbündeten Mainz in den letzten Jahren ihrer Ehe mit Georg Forster21 miterlebt. Ihre damals vertretene, jakobinisch beeinflusste revolutionäre Haltung hat sie trotz der dadurch bedingten Wechselschläge in ihrem Leben nie bedauert: Ihr politisch kultureller Standpunkt war frankophil. In der Familie wurde noch in der ersten Stuttgarter Zeit französisch gesprochen. Die Briefe an die älteste Tochter Therese Forster22 sind französisch geschrieben. Sie war Süddeutsche aus Neigung und spätestens seit der „Befreiung“ der Mainzer Republik im Juli 1793 antipreußisch eingestellt. Nach einer nur neunmonatigen Zugehörigkeit zum französischen Nationalkonvent war Mainz, die kurfürstliche Residenzstadt mit Erzbischofssitz, nach der preußischen Belagerung und dem Ab ← 21 | 22 → zug der Franzosen wieder in die Regierungshoheit des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Erthal23 geraten. Den napoleonischen Kriegen und den französischen Koalitionsverträgen mit den süddeutschen Staaten – dem Rheinbund – stand die „citoyenne“ und „Demokratinn“24 positiv gegenüber. Zwar hielt sie die neuerworbenen Königswürde des damaligen württembergischen Regenten Friedrich25 als erklärte Republikanerin für unwichtig, ihr Urteil über dessen Nachfolger König Wilhelm I.,26 dem sie in ihrer zweiten Stuttgarter Zeit auf Hofgesellschaften begegnete, fiel dagegen botmäßig gnädig und von ihm angetan aus, verglichen mit dem spitzen Zungenschlag ihrer Kritiken, die sie für ihr nicht genehme Dichter und Denker parat hatte.
Aufgeklärte und emanzipierte Frauen kämpften auch in der Folge für eine gesellschaftlich akzeptierte, auch für sie legalisierte Emanzipation. Sie kämpften mit besonderen Frauenlisten und -aktionen für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und für die Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit. Hier ist an die Bewertung der Hausarbeit und die Erfordernisse einer bürgerlich orientierten Hauskultur zu denken, an die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und die Arbeiterinnenbewegung – hier ist aber auch an die Inhalte einer eher bürgerlich orientierten Frauenbewegung zu erinnern, die vor allem für bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten stritt – besonders auch im akademischen Bereich, zu dem Frauen erst in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts in Deutschland zugelassen werden sollten. In diesem Bildungsfeld und -umfeld ist das innovative Wirken Therese Hubers zu sehen.
In der ersten Zeit ihrer Ehe mit Forster, der im damals russischen Wilna27 eine Professur innehatte, beginnt sie zu schreiben. In einem Brief an ihre ← 22 | 23 → geliebte Stiefmutter Georgine Heyne28 nach Göttingen werden ihre Bemühungen deutlich. In der ihr eigenen barocken Form deutscher Orthographie – nur die ihr wichtigen Substantive schreibt sie groß, Sätze reiht sie fast ohne Punkt und Komma aneinander – beschreibt sie ihr Tun: „Wenn meine Zeit und Gesundheit am meisten aber die unabläßige Abwechslung meiner Ideen mir zulies mehr aufzuzeichnen, über die dinge über die ich nachdenke, meine Freunde würden einst eine eigne kühne – aber sicher sehr ungelehrte nur gefühlte Philosophie in meinem Papieren finden. Forster bittet mich oft zu schreiben, aber die Lebendigkeit meiner Ideen erseufzt bei der Langsamkeit meiner Federzüge – ich habe ganze bände im Kopf und nur eine Zeile auf dem Papier.“29
Hier scheint sie noch ganz das junge verspielte Mädchen zu sein, das sich bildungswütig zumeist an seinem männlichen Vorbild orientiert. Erst Jahre später, als das Schreiben längst ihr Brotberuf geworden ist, weil sie als – zweifache – Witwe für ihre Familie zu sorgen hatte, wird sie dieses Schreiben nicht mehr als Spielerei, sondern als bitteren Ernst betrachten: „Endlich im Jahre 9430 sah ich eben daß wir nicht ausreichen würden. Ich versuchte einen französischen Roman zu übersezen. Es ging elend. Vater Huber31 strich mir Seitenweise durch – Ich verzweifelte fast. Da war dann endlich die Übersezung fertig, die hieß: ‚Die nothwendige Ehescheidung‘ das Ende davon mißfiel mir; ich sagte zum Vater: ‚Da irrt der Verfaßer, diese Menschen werden nicht glücklich sein in der Zukunft.‘ Das beweise Du einmal, sagte der Vater. Ich sezte den Roman fort und spann das Schicksal der Helden nach psychologischen Folgerungen ab. Der Vater war ganz erstaunt über die Leichtigkeit meines Erzählens und Erfindens. Von da an habe ich meine Erfahrungen alle in meine kleinen Romane niedergelegt. Es ist deren keiner der nicht lauter Abstraktion der Erfahrung und der Selbstbeobachtung wär, ← 23 | 24 → viele sind aus lauter wahren Zügen zusammengesezt. Ich verdiente also die Hälfte unsers Einkommens ohne je ein Hausgeschäft zu versäumen.“32
Sie konnte, wollte oder musste also für ihre Zeit ganz frauenuntypisch außerhalb ihrer Familienarbeit einem intellektuellen „Broderwerb“ nachgehen und hat damit ein von der französischen Revolution angefachtes neues Bewusstsein der politischen und gesellschaftlichen weiblichen Bestimmung umgesetzt. Und obwohl sich das nicht für ihre Zeit nicht ziemte, stellte sie diese neue Schau der Dinge in ihren Büchern, ihren Romanen und Erzählungen, in ihrer erzieherischen und in ihrer redaktionellen Arbeit – zwar oft recht vorsichtig und mit vielen vordergründigen Höflichkeitsfloskeln versehen – ganz öffentlich zur Schau. Ganz zu klären wird es wohl kaum zu sein, ob Therese Huber nur widerwillig Schriftstellerin und Redakteurin wurde, ob sie ihre Berufswahl als die ihr bestimmte Aufgabe sah oder ob sie vor allem Mutter aus Berufung und Passion sein wollte: „Ich soll die Redaktion vom Morgenblatt und dazu gehörigen Kunstblatte größtentheils übernehmen. Dazu gehört nun eine große Korrespondenz und Lesen aller Beiträge; zugleich die Auswahl der täglichen Artikel. Daneben muß ich manches selbst ausarbeiten oder überarbeiten, übersezen u. dergleichen. Ich komme von meinem Beruf mit Nadel und Faden zu arbeiten, dadurch ganz ab; aber da ich keine Töchter mehr zu erziehen habe, thue ich ihnen keinen Schaden durch mein litterarisches Pfuschen. Ich hätte es freilich lieber anders. Mir ist eigentlich nur wohl beim Strickzeug, aber wenn ich nichts wie dieses zum Beruf hätte, würde es mir doch zu leer sein. Da aber Deine [Aimé] Bedürfnisse und Luisens jezige Lage meine schriftstellerische Tätigkeit fordern, so danke ich Gott daß er mir das Geschick gab dergleichen zu üben. In dieser Schickung liegt die ganze Bestimmung meines Lebens. Ohne sie hätten wir alle in Dürftigkeit untergehen müßen. Nicht dein Vater hätte seine Gesundheit durch Arbeit zerstört – was die Leute oft meinten, denn bis zu seinem Tode wußte niemand daß ich schreiben konnte. Ich wußte es kaum selbst.“33
Im Pro und Contra für oder gegen ihre lang erfüllten weiblichen Pflichten konnte sie keine eindeutige Entscheidung zwischen Beruf- und Familienarbeit fällen, weil sie im Grunde wusste, dass sie für ihr eigenes Wohlergehen beide Aufgaben wollen und ausüben musste, schon deshalb, weil sie beides konnte.
Ihre literarischen Arbeiten erschienen dann erst nach Hubers Tod nicht mehr unter seinem, sondern vorerst nur unter ihrem mit Initialen verkürzten ← 24 | 25 → Familiennamen. Nach seinem Tod hatte sie eine Zeitlang „Stillschweigen“ bewahrt, denn es war „das Lezte, was mir aus meinem rein weiblichen Schriftsteller-Verhältnis von Hubers Lebzeiten her blieb.“34 Von anderen Verlegern war sie aber als Autorin kenntlich gemacht worden und nun „war mein Incognito eine Mummerei, die eben so gegen mein weibliches Gefühl streitet, wie die Autorschaft selbst. Ich nenne mich deshalb jetzt, aus denselben Gründen, warum ich so lange ungenennt zu bleiben wünschte. Daß die Schriftstellerin eine rüstige Hausmutter seyn könne, wird dem Publikum zu glauben sehr schwer, deswegen verschwieg ich meine litterarische Beschäftigung, so lange das zu seyn, mein Beruf war. Die greisende Matrone hat nun keinen Hausstand mehr, sie kann jezt noch Mutter Pflichten erfüllen, indem sie schreibt, nicht sie vernachlässigen.“35
Ihr schriftstellerischer, künstlerischer und publizistischer Anspruch war immer auch mit einem Erziehungs- und Bildungsideal verknüpft. Ihr oft publiziertes Hochloben des Hausfrauen- und Mutterberufs, der eigentlich nicht mit einer Schriftstellerinnenrolle zu vereinbaren war, diente ihr – so scheint es – aber eher dazu, den Widerspruch öffentlich zu machen und dennoch als Vorbild zu fungieren. Eine allgemein mögliche oder gültige Lösung dieses Frauenberufsproblems präsentiert sie nicht. Wie auch, wenn es selbst in unserer heutigen Moderne eine für alle Frauen gültige Lösung dieser zwiespältigen Herausforderung immer noch nicht gibt.
Therese Huber hat ihre rund 60 Romane und Erzählungen, ihre zahllosen Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen, ihre zweiundzwanzigjährige Mitarbeit an der Cottaschen36 Tageszeitung, dem „Morgenblatt für gebildete Stände“ auch als Notwendigkeit gesehen, die in einer geglückten Umsetzung ihrer Begabung dazu beitrug ihre Familie zu ernähren. Sie hat dies, wie nur wenige Frauen ihrer Zeit aus eigener Kraft geschafft. Ein Blick auf die (bildungs)bio ← 25 | 26 → graphischen Daten Therese Hubers soll hier zumindest die Ausrichtung und die unterschiedlichen Phasen ihrer Bedingungen, ihres Verhaltens und ihres Arbeitens beschreiben.
1.2 Chronologie eines Lebens im Licht seiner Prägungen durch Bildung
„Man mag die Quelle, die man verfolgt, noch so sehr von Sand und Strauchwerk säubern, ihre erste Entstehung findet man doch nicht, und umsonst forscht man nach dem Ursprung der Thautropfen welche den Boden befeuchteten, umsonst nach den inneren Schichten des Hügels den sie durchdrangen, um hier als Quelle zu rieseln: ebenso unbefriedigend ist die Arbeit des Geschichtsschreibers, und nie kann er uns die Vergleichung mit dem gegenwärtigen Augenblik gewähren.“37
Genau so wenig wie Therese Huber es für sich selbst annahm und wusste, dass ein Leben lücken- und lebensgetreu in der Rückschau oder in der Gegenwart authentisch dargestellt werden kann, ist es möglich, hier das Zusammenspiel ihrer Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsphasen innerhalb einer durch Lebens„bildung“ bestimmten Lebensstruktur lückenlos zu definieren oder zu interpretieren. Eine dichte Beschreibung soll indes eine Annäherung an ihr bildungsromanhaftes Leben und ihren „Bildungstrieb“38 erleichtern, soll aufschlussreiche Hinweise auf eine mögliche Verbindungslinie in ihrem Lebensdiskurs aufzeigen und Interpretationsansätze liefern. Der Auftakt für die Gewichtung ihrer Kindheit und Jugend, die im Kontrast zwischen zwei Müttern, dem Vorbild des Vaters und dem fast autodidaktisch erworbenen Bildungshorizont erlebt wurde, kann ihr hier folgender Satz sein:
„Ich bin offen aus Tugend und Fehler“39
Mit dieser Charakterisierung und Einschätzung mag mein vorsichtiger biographischer Interpretationsversuch, der auf der Wiedergabe der eigenen Sicht Therese Hubers gegründet ist, Aussagekraft und Gültigkeit gewinnen: ← 26 | 27 →
Am 7. Mai 1764 war Marie Therese Wilhelmine in der wenig begüterten, jedoch sehr angesehenen Göttinger Professorenfamilie Heyne40 zur Welt gekommen: Sie war die älteste41 Tochter des später berühmten Altertumsforschers Christian Gottlob Heyne und seiner ersten Frau Theresia, geborene Weiß, die als junge Frau Unterhofmeisterin der sächsischen Prinzen gewesen war. Das häusliche Leben des Wissenschaftlers entsprach aber kaum seiner geisteswissenschaftlichen Bedeutung. Theresens Mutter soll launisch, unzufrieden und kränklich gewesen sein. Der frühe Wunsch der Tochter, so bald wie möglich aus diesem ungeregelten Haushalt fortzukommen, wurde durch den frühen Tod der Mutter gegenstandslos. Sie war jedoch durch den bildungsbürgerlichen Rahmen in ihrem Lernniveau privilegiert, in ihrem Wissensdurst zumindest nicht behindert und verdankte die Erweiterung ihrer Bildung auch der wahllosen Lektüre gelehrter und weniger seriöser Literatur der häuslichen Bibliothek und der Zusammenarbeit mit ihrem Vater, der die Aufsätze seiner Privatschüler zuerst seiner Tochter zur Korrektur übergab. Über ihre eigene Ausbildung schreibt sie ihrem Sohn Aimé‚ am 9.1.181742 nach Göttingen, wo er Medizin studieren soll: „Ich habe wenig Unterricht gehabt und mein guter Vater hat wirklich viel zu wenig auf dessen Gedeyhen gesehen, denn wir hätten doch orthographisch sollen lesen und schreiben lernen. da hatten wir aber Lehrer, die keinen Eifer hatten, und unser Vater untersuchte nie, was wir konnten. Man hat mir nie lehren einen Aufsaz machen, wie ich dann 14 Jahr alt aus der Pension kam, schwazte mein Vater mit mir wenn ich fragte, aber nie forderte er mich zum Schreiben auf. Schon damals hatte ich meinen Gespielinnen in der Pension viele briefconcepte gemacht, deren styl man bewunderte.[...] ← 27 | 28 → Aber mir fiel nie ein, dass ich talent zum schreiben hätte. So schrieb ich von 18–28 Jahr nie etwas als briefe und Übersetzungen aus dem Englischen, die aber weder corrigiert noch gedruckt wurden, sondern Forster benuzte sie zu seinen Übersetzungen. Ich habe nie gefragt: wie? So übersezte ich die ganze Cooks 3. Reise.“43
Vom Frühjahr 1777 bis Ostern 1778 war die 13 jährige Therese Heyne in eine französische Pension in Hannover geschickt worden – sie hasste sie – um das Einleben der 25 jährigen Georgine Brandes,44 der zweiten Frau des seit 1775 verwitweten Vaters zu erleichtern, der im übrigen die schriftstellerische Tätigkeit der Tochter lange Zeit nicht schätzte. Die Tochter jedoch hat ihn immer verehrt: „Ich habe mich nie in meinem Leben seiner geschämt, er war immer wie er sein sollte, milde, würdig in seinem Zorn, engelgütig, schamhaft, rein ← 28 | 29 → wie ein vernünftiges Wesen, das seinen Leib für Gottestempel hält – darum war ich ihm verwandt.“45 Als er „ihre geistvollen Schriften“46 aber endlich lobte, war sie mit großer Rührung dankbar: „Die Theilnahme, die Sie meinen Reise Phantasien schenken, gewährte mir ein sehr süße Empfindung, das gütige Urtheil welches Sie über mein Talent als Autor fällen, hat mich weinen machen, wie im achtzehnten Jahre, so voll Freude und Beschämung. Weiblicher ging wohl nie ein Weib von der, ihrem Geschlechte vorgeschriebenen, und es allein beglückenden Bahn ab; als ich.“47
Die Beziehung zu der als rätselhaft empfundenen Mutter, die sie elfjährig verloren hatte, war zwiespältig gewesen. Sie war auch der Meinung, dass ihre bedauernswerte Mutter sie nicht liebte. „Meine Häßlichkeit macht ihr keine Freude“,48 während die Schwester Marianne49 als bildschön bevorzugt wurde. Sie hatte dann aber den Abstand zur Schwester aufgeholt und scheint damit zufrieden: „Ich ward sehr spät reif ohne zu kränkeln, ward erst vom 15. Jahre an hübscher und meine Züge selbst erst nach dem zwanzigsten fest – ich wuchs noch im zwei und zwanzigsten Jahre.“50
Details
- Pages
- 628
- Publication Year
- 2016
- ISBN (PDF)
- 9783653068481
- ISBN (MOBI)
- 9783653950069
- ISBN (ePUB)
- 9783653950076
- ISBN (Softcover)
- 9783631491744
- DOI
- 10.3726/978-3-653-06848-1
- Language
- German
- Publication date
- 2016 (June)
- Keywords
- weibliche Autorenschaft unterschiedlicher Literaturbegriff für Frauen und Männer Zeitalter der Aufklärung Rezeptionsgeschichte
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. 628 S., 5 farb. Abb., 9 s/w Abb.