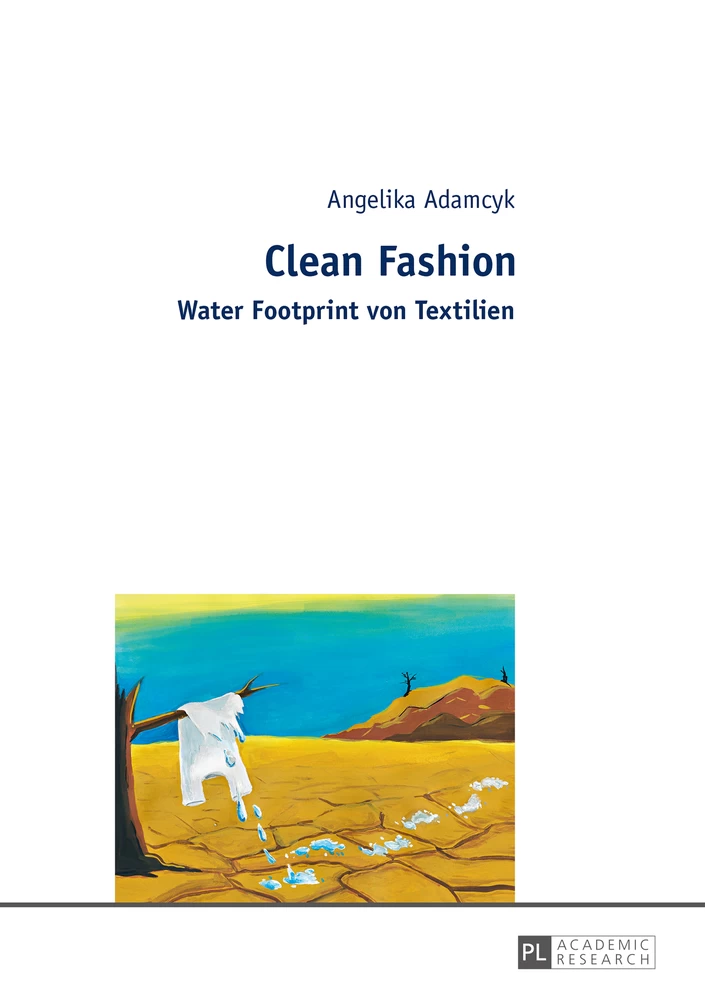Clean Fashion
Water Footprint von Textilien
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau und Zielstellung
- 1.3 Forschungsfragen
- 1.4 Methodik
- A. Theoretischer Teil
- 2. Textile Faserarten
- 2.1 Naturfasern
- 2.1.1 Pflanzliche Naturfasern
- 2.1.2 Tierische Naturfasern
- 2.2 Chemiefasern
- 2.2.1 Zellulosische Chemiefasern
- 2.2.2 Synthetische Chemiefasern
- 3. Die textile Kette
- 3.1 Rohstoffgewinnung
- 3.1.1 Ökologische Aspekte
- 3.1.2 Baumwollanbau
- 3.1.3 Baumwollernte
- 3.2 Textilerzeugung
- 3.2.1 Garnherstellung
- 3.2.2 Flächenerzeugung
- 3.2.3 Textilveredelung
- 3.2.4 Konfektion
- 3.3 Handel
- 3.4 Textilpflege
- 3.5 Entsorgung
- 4. Zertifizierung von Textilien
- 4.1 Ökosiegel
- 4.2 Soziale Standards
- 5. Messinstrumente für Umweltwirkungen
- 5.1 Ecological Footprint
- 5.2 Carbon Footprint
- 5.3 Virtuelles Wasser
- 5.4 Water Footprint
- 5.4.1 Definition
- 5.4.2 Water Footprint Assessment
- 5.4.3 Blauer Water Footprint
- 5.4.4 Grüner Water Footprint
- 5.4.5 Grauer Water Footprint
- 5.4.6 Water Footprint von Baumwolle
- B. Empirischer Teil
- 6. Methode
- 6.1 Water Footprint eines Produkts
- 6.2 Water Footprint eines Prozesses
- 6.2.1 Blauer Water Footprint
- 6.2.2 Grüner Water Footprint
- 6.2.3 Grauer Water Footprint
- 6.3 Methodik
- 7. Fallstudie
- 7.1 Textile Kette
- 7.2 Indien
- 7.3 Mauritius
- 8. Daten
- 8.1 Daten Baumwollanbau
- 8.2 Daten Textilerzeugung
- 8.3 Annahmen und Ausschlüsse
- 8.3.1 Baumwollanbau
- 8.3.2 Textilerzeugung
- 8.4 Datenqualität und Probleme
- 8.4.1 Datenqualität des Baumwollanbaus
- 8.4.2 Datenqualität der Textilerzeugung
- 9. Ergebnisse
- 9.1 Water Footprint des Baumwollanbaus
- 9.1.1 Blauer Water Footprint
- 9.1.2 Grüner Water Footprint
- 9.1.3 Grauer Water Footprint
- 9.1.4 Gesamter Water Footprint des Baumwollanbaus
- 9.2 Water Footprint der Textilerzeugung
- 9.2.1 Blauer Water Footprint
- 9.2.2 Grauer Water Footprint
- 9.2.3 Gesamter Water Footprint der Textilerzeugung
- 9.3 Gesamter Water Footprint der Fallstudie
- 10. Diskussion
- 10.1 Ergebnisse
- 10.1.1 Water Footprint des Baumwollanbaus
- 10.1.2 Water Footprint der Textilerzeugung
- 10.1.3 Water Footprint der Fallstudie
- 10.1.4 Vorschläge zur Verringerung des Water Footprints
- 10.2 Methode
- 10.2.1 Vorteile
- 10.2.2 Kritikpunkte
- 10.2.3 Verbesserungsmöglichkeiten
- 10.3 Beurteilung der Praxistauglichkeit des Water Footprints
- 10.4 Bedeutung für die Gesellschaft
- 11. Zusammenfassung und Ausblick
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Formelverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Wasser ist eine lebenswichtige, nicht ersetzbare Ressource. Nur 2,5 % der Wasserressourcen auf der Erde sind nutzbares Süßwasser, das sehr ungleich verteilt ist. Während einige Orte über ausreichende Wasserressourcen verfügen, herrscht anderswo Wassermangel (Finkbeiner und Berger, 2010, s.p.).
Der Mensch benötigt Wasser zur Erfüllung der alltäglichen Grundbedürfnisse, wie zum Trinken, Kochen und Waschen. Die hierbei verwendeten Mengen steigen zivilisationsabhängig exponentiell an (Hoekstra et al., 2011, 1f). Wasserreiche Länder (z.B. Österreich) verfügen über bedeutende Süßwasserressourcen, während viele Entwicklungs- und Schwellenländer zu den wasserarmen Ländern zählen. Diese müssen mit sehr geringen Mengen und hygienisch bedenklichem Wasser auskommen (Hahn, 2006, 199f). Wassermangel führt in den betroffenen Ländern zu Problemen wie Unterernährung durch Bewässerungsprobleme in der Landwirtschaft und Infektionskrankheiten als Folge von minderwertigem Trinkwasser. Die Umwelt leidet unter der Schädigung der Ökosysteme und dem daraus resultierenden Rückgang der Artenvielfalt (Finkbeiner und Berger, 2010, s.p.).
Wasserreiche Regionen haben vorwiegend Probleme mit der Wasserqualität. Durch den Wasserverbrauch und die daraus resultierende Kontaminierung mit Schadstoffen wird die Qualität der Grund- und Oberflächengewässer in zunehmendem Maße verschlechtert. Selbst in europäischen Ländern ist das immer minderwertigere Trinkwasser aus Uferfiltrat ein Zeichen für die zunehmenden Probleme bei der Wasserversorgung. Da Nitrat- und Pestizideinträge aus der Landwirtschaft das Grundwasser belasten, ist die Qualität des (Trink)wassers wesentlich beeinträchtigt (Gawel, 2012).
Je nach Vorkommen der Wasserressourcen unterscheidet sich auch der tägliche Verbrauch der Menschen. Der durchschnittliche Wasserverbrauch eines Subsahara Afrikaners liegt bei 5 l/Tag, der eines Inders bei 25 l/Tag, während ein Österreicher etwa 135 l/Tag und ein US-Amerikaner 382 l/Tag verbraucht (Katzmann, 2007, 103; Lebensministerium, 2012a). In Österreich werden rund 34 % des Wassers für Duschen und Baden verwendet, 22 % für die Toilettenspülung, aber nur 3 % für Grundbedürfnisse (Trinken und Kochen) (Lebensministerium, 2012b). Insgesamt wächst der Wasserbedarf im Vergleich zur Weltbevölkerung doppelt so schnell, weshalb ein nachhaltiges Management der Wasserressourcen unbedingt erforderlich ist (Finkbeiner und Berger, 2010, s.p.). ← 9 | 10 →
Ein deutlich höherer Verbrauch von Wasserressourcen fällt jedoch für die Produktion von Konsumgütern wie Nahrungsmitteln oder Textilien an. Deren Herstellungsprozesse beeinflussen die Menge an verbrauchtem und verschmutztem Wasser wesentlich, die für ein Produkt aufgewendet werden müssen (Hoekstra et al., 2011, 1f).
Für die kommenden Jahre wird eine steigende Nachfrage nach Textilien infolge des zunehmenden Bevölkerungswachstums prognostiziert. Zusätzliche Ursachen sind einerseits konjunkturelle Entwicklungen und steigende Einkommen, andererseits Faktoren wie neue Produktanwendungen und der Zeitgeist der immer kürzer werdenden Modezyklen.
Die Nutzung der Wasserressourcen zur Herstellung von Konsumgütern, wie Textilien, konkurriert also mit der Befriedigung von Grundbedürfnissen, wie der Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, was vor allem ein Versorgungsproblem in Dritte Welt Ländern darstellt. Dies verlangt einen effizienteren und bedachten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen (Engelhardt, 2012, 109).
Aus dieser Problematik heraus hat sich die Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr mit dem Wassermanagement entlang der Produktionskette beschäftigt und nach geeigneten Messinstrumenten für den Verbrauch und die Beeinträchtigung der Wasserressourcen gesucht. Mit dem sogenannten Water Footprint (dt. Wasserfußabdruck) ist ein Indikator für die Messung des bei der Produktion von Gütern entstandenen Wasserverbrauchs entwickelt worden (Hoekstra et al., 2011, 1f).
1.1 Problemstellung
Die Wertschöpfungskette der Textilindustrie ist durch eine hohe Arbeitsteilung gekennzeichnet und erstreckt sich über den gesamten Globus. Vor allem Baumwolle ist wegen der großen ökologischen und sozialen Defizite bei der Herstellung mit einem negativen Image behaftet. Die Gründe sind der hohe Wasserverbrauch beim konventionellen Anbau, der massive Einsatz von Chemikalien und die Ausbeutung von Arbeitskräften in sogenannten Billiglohnländern (Paulitsch et al., 2004, 5). Dagegen setzen Ökotextilien auf eine umweltfreundliche und sozial gerechte Herstellung sowie eine transparente Wertschöpfungskette. In Bezug auf die Zertifizierung hat dieser Sektor eine Vorreiterrolle mit Gütesiegeln wie Fairtrade oder GOTS (Global Organic Textile Standard). Die textile Produktionskette ist transparent und unterliegt ständigen Kontrollen. Auch der biologische Baumwollanbau erfolgt unter ökologischen und umweltschonenden Bedingungen (EZA, 2012). ← 10 | 11 →
Aufgrund des hohen Wasserverbrauchs bei der Herstellung von Baumwolltextilien stellt sich allerdings die Frage, ob fair und ökologisch produzierte Mode auch als wasserfreundlich beurteilt werden kann. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Studie ein Produktbeispiel aus der Ökobranche einer Water Footprint Berechnung unterzogen.
1.2 Aufbau und Zielstellung
Zielsetzung dieser Arbeit ist es, das Konzept des Water Footprints anhand der Berechnung eines Baumwollprodukts aus der Ökotextilbranche zu erklären und zu beurteilen, ob die sonst vorbildliche Herstellung auch aus der Sicht des Wasserverbrauchs als nachhaltig bezeichnet werden kann. Anhand der Ergebnisse sollen zudem Verbesserungen vorgeschlagen, eventuelle Schwachstellen der Methodik diagnostiziert und schließlich die Praxistauglichkeit des Water Footprints abgeleitet werden.
Details
- Seiten
- 138
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783653051865
- ISBN (MOBI)
- 9783653972115
- ISBN (ePUB)
- 9783653972122
- ISBN (Paperback)
- 9783631660096
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05186-5
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Januar)
- Schlagworte
- Wasserfußabdruck Wasserverschmutzung Ökomode Baumwollanbau Wasserverbrauch Textile Kette
- Erschienen
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 128 S., 17 s/w Abb., 19 Tab.
- Produktsicherheit
- Peter Lang Group AG