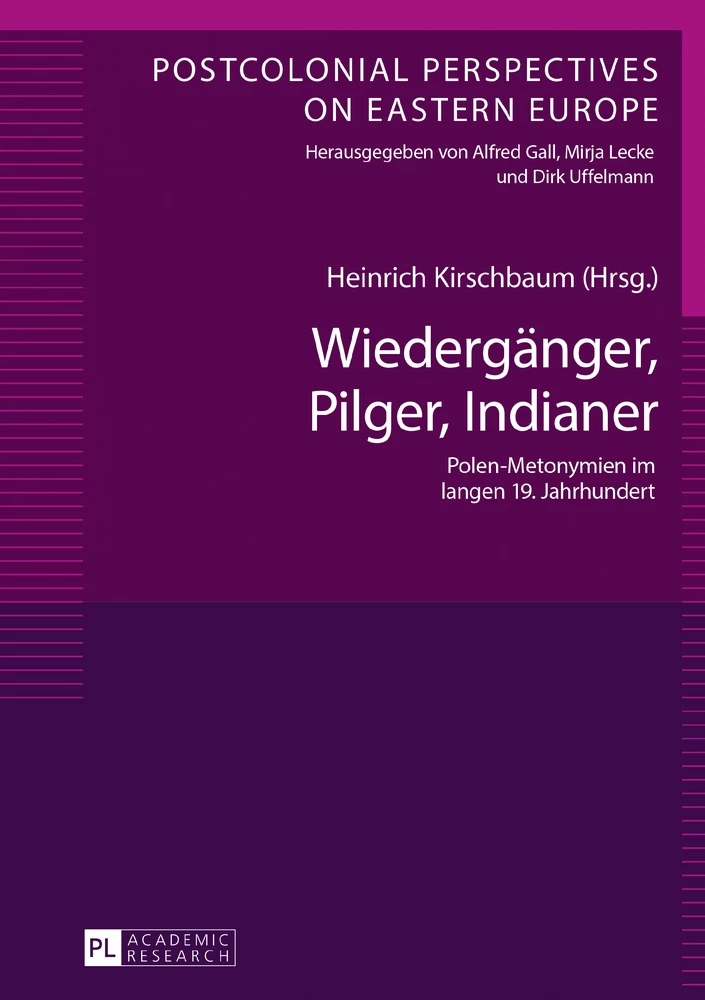Wiedergänger, Pilger, Indianer
Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitende Metonymien
- Polen-Kontiguitäten im langen 19. Jahrhundert (Heinrich Kirschbaum)
- Polen pars pro toto. Proportionen – Projektionen – Personifikationen
- Zwischen Metapher und Metonymie, Poesie und Wissenschaft. Orientbilder als Reflexionen des Selbst in der polnischen Romantik (Thomas Grob)
- Legitimitätsfigurationen von Insurgency und Counterinsurgency in Erinnerungen an den Novemberaufstand (Christoph Garstka)
- Die Begriffsperson des Pilgers in der polnischen Romantik. Text und prekäre Territorialität (Alfred Gall)
- Der neue Mensch des polnischen 18. Jahrhunderts. Ignacy Kraszewskis Entwürfe zwischen den Geschlechtern und den Nationen (German Ritz)
- Polnische Hautschrift. Aneignen – Markieren – Ins-Bild-Setzen biologischer Substanz bei Stefan Żeromski (Michał Mrugalski)
- Henryk Sienkiewicz schlägt sich durch Metonymien und Metapher der afrikanischen Wüste und Wildnis (Dirk Uffelmann)
- Tropen des Transnationalen. Kontiguitäten – Konstellationen – Kodierungen
- Ordensritter und Indianer. Kulturmissionare und ihre Wilden in deutschen und polnischen Diskursen (Izabela Surynt)
- Wessen Blut? Wessen Zähne? Vampirismus als transnationale Trope im Ostmitteleuropa des späten 19. Jahrhunderts (Alfrun Kliems)
- Ethos des Genres. Kazimierz Brodzińskis Rekursionen der Idylle (Heinrich Kirschbaum)
- Kosakentum als Kulturtrope. Michał Czajkowski und polnisch-ukrainische Identitätsverhandlungen (Alois Woldan)
- Die Geburt von Belarus aus dem Geist der polnischen ruralen Operette (Yaraslava Ananka)
- Identitätsfigurationen polnischsprachiger Schriftsteller aus Belarus-Litauen in belarussischen literaturhistorischen Diskursen (Žanna Nekraševič-Karotkaja)
- Figurationen polnisch-jüdischer Koexistenz im Streit um Adam Mickiewicz (Magdalena Marszałek)
- Biogramme
- Personen- und Werkverzeichnis
- Reihenübersicht
Danksagung
Der vorliegende Sammelband geht auf die internationale Tagung „Postkoloniale Identitätstropologie: Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert“ zurück, die am 28. und 29. März 2014 an der Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Die Idee der Konferenz entstand während meines Forschungsaufenthalts im Rahmen des Feodor-Lynen-Programms der Alexander von Humboldt-Stiftung in Wrocław. Eines der zahlreichen Gespräche mit meiner Gastgeberin, Izabela Surynt, nahm eine identitätstropologische Richtung: Es wurde beschlossen, eine kleine, aber dichte Konferenz zu diversen Figurationen und Begriffspersonen des Polen bzw. der Polin im langen 19. Jahrhundert zu organisieren. Die Förderung der Tagung übernahm die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der ich zu Dank verpflichtet bin, genauso wie der Alexander von Humboldt-Stiftung für die Gewährung des Druckkostenzuschusses zum vorliegenden Buch. Ich danke Alfred Gall für die sorgfältige Lektüre des Manuskripts. Die Arbeit am Sammelband hätte ich alleine, ohne die ständige Unterstützung von Sigrid Fundheller und Marlis Heyer, kaum gemeistert. Ihnen gilt mein großer Dank. ← 7 | 8 →
Polen-Kontiguitäten im langen 19. Jahrhundert
1. Exklusive Metonymien (Metaphern inklusive)
Nach 1795 besitzt Polen-Litauen, einst eine mächtige Hegemonialmacht, keine Eigenstaatlichkeit mehr, es ist zwischen Preußen, Österreich und Russland aufgeteilt und von der Landkarte Europas verschwunden. Die Bewusstwerdung dieser Spaltung, Ent-Territorialisierung und Provinzialisierung, und zwar in der Blütezeit der Nationsbildungsprozesse, bestimmt die Modi der Fremd- und Selbstbestimmungen des nun neu zu definierenden „Polen“. In der Situation der politischen Resignation und diskursiven Ohnmacht wird die Literatur zu einem wichtigen poetisch-rhetorischen (Ersatz‑)Raum der Identitätsverhandlungen. Die vergangene und künftige Existenz des geteilten bzw. getrennten Polen wird dabei, so die zur Diskussion stehende Arbeitsprämisse des vorliegenden Sammelbandes, durch interagierende Figurationen von Integrität, Partialität und Zugehörigkeit potenziert, bei denen, tropologisch gesehen, die entscheidende Rolle der Figur der Metonymie zukommt.
Ein wichtiger Schritt zur Erforschung der literarischen Polen-Diskurse wurde gemacht, indem man die Sujetisierungsmuster und Erzählmodi der Kategorien wie „Polen“ oder „Polentum“ problematisierte, wobei die rhetorisch-figurativen Substrukturen der jeweiligen Narrationen selbst kaum beachtet bzw. nicht zu den primären Untersuchungszwecken der entsprechenden Studien gehörten.1 Durch postkoloniale Perspektivierungen hat die Problematik der Fremd‑ und Eigenbeschreibungen erneut an Relevanz gewonnen. Dabei hat es gedauert, bis man zum einen die Apostrophierungen kritisierte, die bei der Übertragung der postkolonialen Paradigmen auf Mittel‑ und Osteuropa entstanden sind, und zum anderen die poststrukturalistische Textsorten‑ und Gattungsblindheit der primär kulturwissenschaftlich ausgerichteten Postcolonial Studies auch als ← 11 | 12 → Problem erkannte.2 Die Hinterfragung der „Literarizität“ der untersuchten (anti‑)hegemonialen Konstrukte stand nun auf der Tagesordnung, wobei die Tropizität der Identitätsverfahren wiederum praktisch unbeachtet blieb. Einige Metaphern der polnischen Identitätsdiskurse wurden zwar, wenn auch vor allem in Gegenüberstellung zu Mythen, angesprochen,3 die Figur der (anti‑)kolonialstrategisch motivierten Metonymie wurde jedoch immer noch ungenügend untersucht, und der vorliegende Sammelband soll diese Lücke zumindest partiell schließen.4
Als paradigmatisch für die produktive und zugleich pauschalisierende Dichotomisierung von Metapher und Metonymie gelten zahlreiche Studien von Roman Jakobson.5 Die Jakobson’sche Polarisierung von Metapher und Metonymie mag dabei eine bisher noch nicht problematisierte epistemologische Dissonanz zwischen Untersuchungsobjekt und Methode in Kauf nehmen: Jakobson ← 12 | 13 → (1987, 329) zählt berechtigt die vergleichende Kontrastierung zum Verfahren des Metaphorischen, benutzt sie aber selbst bei der eigenen Gegenüberstellung von Metapher und Metonymie. Dabei will Jakobson eigentlich genau letztere tropologisch rehabilitieren, unter anderem als Reaktion auf die Fixierung der Rhetorik und Ästhetik auf die Metapher.6 Der Metaphorozentrismus wird von Jakobson kritisiert, jedoch im gleichen Augenblick zusätzlich fundiert. Es fragt sich dabei allerdings, inwiefern ein anderer Weg, nämlich das Verhältnis zwischen Metonymie und Metapher als metonymisch, relatorisch-komplementär und kombinatorisch statt „metaphorisch-vergleichend“ zu beschreiben, seine epistemologischen Fallen und Tücken auch beinhaltet.
Spätestens seit Gérard Genettes Studie zu metonymischen Transpositionen bei Marcel Proust (Genette 1993, 41–63) ist im jedem Falle klar, welche Gefahren in sich die Polarisierungen von Metapher und Metonymie bergen: Genette analysiert, wie sich metonymische Verschiebungen „problemlos“ in metaphorische Prädikationen transformieren, ja sie erstmal motivieren und generieren können. Im nächsten metatropologischen Schritt markiert Paul de Man (1989, 91–117), wohl gezielt wieder anhand von Proust, klaffende Aporien zwischen metaphorisch-metonymischen Gesten des Textes: Vermeintliche Figurationen suspendieren die Logik der Figurenbildung, Tropen sabotieren ihre ihnen in der Rhetorik vorgeschriebenen Aufgaben und Zuständigkeiten und erweisen sich als Defigurationen des Lesens. Der Text (von Proust) entwirft im konfliktären Zusammenspiel von Metaphern und Metonymien bestenfalls (Meta‑)Allegorien seiner eigenen Unlesbarkeit.
Wie dem auch sei: Wenn in den folgenden Überlegungen und Summierungen der Befunde zur Metonymie (immer wieder in Bezug auf den polnischen kulturellen Kontext) doch die Rede von Metonymie und Metapher sein wird, soll das „Und“ zwischen diesen beiden Tropen, verbunden durch die immer verführerische Alliteration, sowohl metaphorisch (adversativ oder komparativ) als auch metonymisch (kopulativ oder additiv) begriffen werden, als Konjunktion und Disjunktion in (kontra‑)produktiver Wechselwirkung. Der vorliegende Sammelband trägt zwar den Untertitel „Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert“, „Metonymien“ selbst stehen aber metonymisch auch für andere Tropen‑ und Identifikationsfiguren sowie deren Misch‑ und Übergangsformen. Die rhetorischen (Irr‑)Wege der Polen-Diskurse im hier interessierenden Zeitalter sind gekennzeichnet durch kontroverse Übertragungen und Übergänge, Translationen und Kompositionen von Totalem und Partikularem. Metonymien movieren Metaphern, die ihrerseits immer wieder in Metonymien zerfallen. Der ← 13 | 14 → vorliegende Sammelband, der es sich zur Aufgabe macht, Kontiguitätsstrategien der (polnischen) Identitätskonstrukte zu problematisieren, übt indirekt Kritik am Anhaften an der Dichotomie „eigen – fremd“. Binären Systematisierungen wird hier ein Verständnis der Instabilität und Transformativität der Identitäts(de)- figurationen gegenübergestellt. Die beiden Tropen werden dabei natürlich nicht nur als „rhetorische Mittel“, sondern als kognitive (vgl. Ungerer, Schmid 2006, 154 und Schlitte 2014, 54) und narrative Muster aufgefasst.7
Beruhen Metaphern auf Similaritätsbezügen, so ist die die Semantik von Zugehörigkeit und Verhältnis transportierende Metonymie programmatisch keine Figur der Gleichheit, sondern die der Kontiguität.8 Werden metaphorische Bildungen von paradigmatisierenden Analogien, Kontrasten und Beispielen geprägt (und Beispiele würden in unserem Fall die Einzigartigkeit und Beispiellosigkeit der Identitätssituation Polens schmälern),9 treten bei der Metonymie syntagmatische Anspielungen und Anlehnungen in den Vordergrund. Metaphern provozieren und evozieren, so Paul de Man (1988, 45, 102) in Rekurrenz zu Jakobson, strikte Kohärenzen von Bedeutung und Struktur und kommunizieren diskursive Totalitäten, die bei Metonymien zwar mit reflektiert werden, jedoch nie als solche präsentiert werden. Nach Giorgio Agamben (2002, 35) werden metonymische Zugehörigkeiten via Denotation signalisiert, für Paul Ricœur (1986, 106) ist dagegen die Metapher die Denotationsfigur schlechthin. Man ist sich jedoch zumindest einig, dass die Interaktionen zwischen Metapher und Metonymie semiotische Spannungen zwischen Ikonik, Symbolik und Index offenbaren. Die indexikalische Kontiguität selbst konstituiert sich metonymisch: „the actions of indices depends upon association by contiguity“ (Peirce 1978, 172), sie ist Bezeichnen und Anzeichnen in einem. ← 14 | 15 →
Während Metaphern perfektiv, ja perfektionistisch bedeuten, deuten Metonymien erst an, was unter anderem im Schreiben unter den für den polnischen Kontext nicht unwichtigen (Selbst‑)Zensurbedingungen von Relevanz sein kann. Die schwankende, unvollständige Sinnstiftung der substitutiven und subversiven Metonymie ist für die diskursiven Gegner und Zensoren schwieriger zu kontrollieren. Martin Hähnel spricht im Kontext seiner Mereologie der Metonymie von deren „falsifizierender Funktion“ (Hähnel 2014, 152). Viele Metonymien fallen zum einen weniger auf als ostentativere Metaphern, zum anderen setzen sie ein spezifisches Wissen voraus (Müller 2012, 96). Während beim metaphorischen Verdichten („condensation“) mehrere Themenbereiche zu einem Bild zusammengefasst werden, vollziehe sich bei der Metonymie eine Verschiebung („déplacement“) des (Alp‑)Trauminhaltes von einem „verräterischen“ Objekt auf einen „unverdächtigen“ Gegenstand, der mit dem „eigentlich Gemeinten“ nur einige Merkmale teilt (Lacan 1973, 36).10 Den Metaphern kann man (der Zensor) leichter eine symbolische Äsopizität attestieren und sie als virulente Parabeln entlarven als den Metonymien, die als Morpheme des Unvollendeten auch Figurationen des „Nicht-so-Gemeinten“ sein können: Metonymien halten in dieser Hinsicht immer (selbst‑)ironische Ausreden parat.
Polnische Verhandlungen von Souveränität und Teilhabe, Integrität und Partialität – und sie schließen die Problematik der (romantischen) Fragmentarität ein – sind auf Sinnstiftungen bzw. Sinnverweigerungen angewiesen, bei denen die identitätsstrategische Unentscheidbarkeit zwischen Substanz und Akzidenz intendierte oder unerwartete, affektive Attributionen hervorbringen kann. Dabei verbleiben Metonymien als Figuren des Fetisch-Totemistischen11 nicht bei mehr oder weniger einfachen synekdochischen Operationen,12 bei denen Ganzheit und Einheitlichkeit, Zusammenhang und Zusammenhalt durch Fragmentierung und Fermentierung garantiert werden sollen (und umgekehrt). Während die Metapher ein Punkt bzw. Ausrufezeichen der vollbrachten Signifikation krönt, stehen nach ← 15 | 16 → den metonymischen Relationierungsrätseln interpretatorische Auslassungspunkte und (rhetorische) Fragezeichen.
Dabei ist die Abwehr gegen das Vorausliegend-Hegemoniale den metonymischen Reduktionen und Relativierungen verwandt, so Harald Bloom (2011, 18). Die Metonymie als Minusverfahren und Figur des protokollierenden (Ver‑)Schweigens nähert sich hier elliptisch-anakoluthischen Sinnstiftungen: Das Aufgetrennte und Entzogene, Ausgelassene und Lückenhafte provoziert zur (im polnischen Kontext oft äsopischen) Deutung seitens des impliziten, in die Verschwörung der Lektüre eingeweihten Lesers. In diesem Sinne ist die Metonymie auch eine Metonymie der Allegorie: Letztere „bedeutet genau das Nichtsein dessen, was es vorstellt“ (Benjamin 1978, 406). Im Begriffspaar Metapher – Metonymie haben wir – en miniature – viele Spannungen und Diskrepanzen, die dem anderen Paar, nämlich dem von „Symbol – Allegorie“ innewohnen.
Der (negativ‑)hermeneutische Impuls der Metonymik wird seinerseits von diversen (Denk‑)Figuren von Inklusion und Exklusion stimuliert, die die Kategorien von totum und pars immer aufs Neue definieren und den Gegensatz von innen und außen überspielen. Figurationen von Ausschließen und Ausscheiden (aus der Geschichte und politischen Geographie), Ausgrenzung bzw. Entgrenzung des Eigenen (Polens), forcieren ein Ausnahmedenken, sei es katastrophistisch oder idyllisch; beide übrigens nehmen im Polen des 19. Jahrhunderts zunehmend messianistisch-viktimistische Züge an, die erst im Positivismus umgedeutet werden. Bei der Ausnahme-Isolierung der Exklusivität geht es dabei nicht zuletzt um die Bestimmung des/eines Raumes, in dem Ordnung und Ortung überhaupt gelten kann (vgl. Agamben 2002, 28f.). Als Figur des exklusiven und extensiven Auszugs und der Ausschließung sowie zugleich der Einschließung (des Ausgestoßenen) stellt die Metonymie, so Agamben (2002, 27f.), eine Figur der Souveränität dar.
Bezeichnend ist, dass Agamben die Paradoxien und Polysemien der Ausnahme anhand der Figur des Verbannten bespricht, also, übertragen auf den polnischen Kontext, einer „Begriffsperson“ („personnage conceptuel“, Deleuze, Guattari 1991, 70–73), die für die Polen-(Selbst‑)Beschreibungen nach 1795, dann nach 1830/31 und schließlich nach 1863/64 von entscheidender Bedeutung ist.13 Nach Agamben (2002, 39) ist der Verbannte nicht einfach außerhalb des Gesetzes gestellt und von ← 16 | 17 → diesem unbeachtet gelassen, sondern von ihm verlassen, ausgestellt und ausgesetzt auf der Schwelle, wo Leben und Recht, innen und außen verschwimmen. Auch Gilles Deleuze und Félix Guattari, auf die sich Agamben stützt, besprechen das Phänomen der Souveränität im bildsemantischen Feld der „großen Gefangenschaft“ (Deleuze, Guattari 1992, 494). Somit problematisieren sie unwillkürlich den wunden Punkt der Polen-Entwürfe schlechthin. Und hier wird erneut ein weiterer Unterschied zwischen Metapher und Metonymie von Relevanz: Während die Metapher über eine Beziehung spricht, die es in der außersprachlichen Realität nicht gibt, gibt es sie bei der Metonymie (Schlitte 2014, 72). Der Bezug zwischen Wort und Welt – und entsprechend zwischen Wort und Tat, „słowo i czyn“, – ist bei der Metonymie stärker ausgeprägt als es bei der Metapher der Fall ist, die im narzisstischen (Zerr‑)Spiegel der Analogie letztendlich vor allem sich selbst reflektiert. Dagegen verweist die Metonymie – und im Verweisen manifestiert sich ihre Gestikulationsbeschaffenheit – auf referenzialisierbare Realitäten. Eine bzw. die Referenz ist im Falle des polnischen Selbstbewusstseins des 19. Jahrhunderts die (Nicht‑)Existenz Polens; und hier wird das Allegorische (im Benjamin’schen Sinne einer negativen Ontologie) der metonymischen (Fehl‑)Identifikationen wieder sichtbar.
Nicht zuletzt aus diesem Referenz‑ und Realitätsbezug resultiert die Kompetenz der Metonymik, räumlich-zeitliche „Reihen“ (Jakobson 1987, 331f.) durcheinanderzumischen und zu verschieben. Konventionelle und kanonisierte Proportionen und Hierarchien werden subvertiert: Diese Unterminierung ist nicht zuletzt für ein subalternes Sprechen/Schreiben von Relevanz. Ausschließungen des Inneren oder „Verinnerlichungen“ des Ausgestoßenen – so die metonymisch-chiastische „Logik“ dieser Figurationen – erfahren in den Polen-Konstrukten der Teilungszeit geopolitisch-topographische Konkretheit. Bei den entsprechenden Verortungen und Verordnungen Polens, bei denen Dezentralisierungsdiktionen paradox als Konsolidierungsgesten gelten können, gehen Geopoetik und Georhetorik ineinander über. Das Identitätsproblem der so sogenannten „Kresy“, der verlorenen Gebiete im Osten, stellt dabei – wiederum metonymisch – die Quintessenz der polnischen Verhandlungen von Absenz und Präsenz, Defizit und (Stell‑)Vertretung dar. Hier werden Verlust und Ersatz, Zerfall und Erfüllung zu einer – provisorischen und kompensatorischen – Einheit. Genau auf diese Kapazitäten der Metonymik ist die Mnemonik angewiesen: Die (nie) ganzen Identifikations‑ oder Trauma-Bilder werden über deren Teile und Details aktualisiert, kon‑ und restituiert. Die synekdochisch-quantitative Relation erweist sich als eine metonymisch-qualitative.
Die (sich) erinnernde, gedenkende Sammlung des Zerstreuten gehört zum Versprechen der Metonymie. Als Versprechen und Gewähr sind Kontiguitäten kommissiv: Das Unvollendete und Werdende metonymischer Semantisierungen ← 17 | 18 → suggeriert Verheißung und Erwartung, Erfüllung und Wiederherstellung (Polens): Egal, welcher Metaphern und Symbole sich der (polnische) Messianismus bedienen mag, er ist in der figurativen Grundstruktur seiner (Para‑)Eschatologie metonymisch. Die thanatopoetischen, elegisch-eschatologischen Trümmerlandschaften polnischer Identifikationen im 19. Jahrhundert – die wohl bekannteste und einflussreichste ist diejenige der „Finis Poloniae“14 – sind dabei nicht nur romantisch, sondern auch (post‑)barock geprägt: Die Anhäufung und (An‑)Sammlung verlorener Metonymien auf dem Friedhof (oder Schlachtfeld) toter Metaphern wirkt und wird allegorisch. Als Figuren der Zugehörigkeit, Weglassung, Hinzufügung und Angrenzung – u. a. Nachbarschaft und (Wahl‑)Verwandtschaft – operieren polnische Mental-Mapping-Metonymien mit (De‑)Formationen des Topographischen und Landschaftlichen: Dabei kann es oft zu dissonierenden (Ent‑)Lokalisierungen bzw. (Ent‑)Territorialisierungen des zu (er‑)findenden Originären in der Peripherie kommen, deren Provinzstatus sowohl re‑ als auch dekonstruiert wird.
Für die Komplikation polnischer Identitätssignifikationen sorgt zusätzlich die Anschlussfähigkeit der „Kresy“-Narrative und anderer geopoetischer Sujets gegenüber diversen (Mode‑)Diskursen der Zeit, wobei hier dem Orientalismus die zentrale Rolle zukommt. Antihegemoniale und zugleich nostalgisch-koloniale Gebärden der polnischen Literatur riskieren dabei diskursive Diskrepanzen zwischen (selbst‑)exotisierendem, (selbst‑)orientalisierendem Erzählen und Narrativierungen der zu (er‑)findenden Nativität. Im Gegensatz zu den Literaturen der Hegemonialländer kann sich die polnische den imperialen Luxus nicht leisten, Selbstvergewisserung durch Modellierungen einer strengen (orientalistischen) Distanz zwischen „Eigen“ und „Fremd“ zu figurieren. Daher beharrt sie auf der Durchlässigkeit, Flexibilität und Instabilität der Identitätsgrenzen, und zwar sowohl auf der Ebene der imaginierten (Un‑)Orte als auch auf derjenigen der prominenten Begriffspersonen: So sind die Transpositionen vom Wanderer zum Verbannten, vom Vampir bzw. Wiedergänger zum Pilger (und vice versa) manifest fließend, metonymisch nicht abgeschlossen: offen.
Es ist daher kein Zufall, dass die wichtigsten Vertreter der polnischen Romantik genau aus den „verlorenen Gebieten“ im Osten kommen und diesen nicht nur zum Handlungsort ihrer Texte, sondern auch zu geopoetischen Identitätsfiguren des Polentums umkodieren. „Polen“ ist demnach keine starre „Idee“, sondern eher eine immer wieder zu verhandelnde geopoetische Konstellation und Konfiguration. So imaginieren Vertreter der so genannten ← 18 | 19 → Ukrainischen Schule (Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Michał Czajkowski u. a.) das multi‑ und stellenweise slavophil-transethnisch, aber mononational konzipierte Polnische geometonymisch in der Ukraine, wobei vor allem die Figur, Metonymie und Metapher des Kosaken (meta‑)sujetbildend wird. Die Wilnaer Dichter (Jan Czeczot, Adam Mickiewicz, Edward Odyniec u. a.) sondieren und probieren dagegen Selbstverortungen im phantasmatischen Litauen. In der Zeit zwischen den Aufständen von 1830/31 und 1863/64 entstehen sogar – nach dem vertrauten Partialität=Integrität-Prinzip – neue geopoetische Territorien und Chronotopoi wie Belarus (z. B. bei Jan Barszczewski oder Wincenty Dunin-Marcinkiewicz). Es mag zur Ökonomie der Metonymie gehören, das Partielle und Supplementäre, Fraktale und Fragmentarische so zu entwerfen, dass die (romantisch ersehnte) metaphorische Totalität von Begrenztem und Unbegrenzbarem nicht direkt artikuliert und zugleich mitfiguriert wird. Dies kann unter Umständen zu einer radikalen exegetischen Ratlosigkeit führen, bei der man kaum bestimmen kann, ob z. B. das „Regionale“ das „Nationale“ konstituiert oder umgekehrt.15 Das die Tropen (vermeintlich) organisierende Verhältnis von Thema und Rhema, Tenor und Vehikel bzw. Spezifischem und Generellem gilt – zumindest im Falle der im vorliegenden Sammelband problematisierten Polen-Figurationen im langen 19. Jahrhundert – nur bedingt: Es wird immer wieder – mit einer bitteren und stellenweise erbitterten, sardonischen (Selbst‑)Ironie – dekonstruiert.
2. Polen pars pro toto
Im vorliegenden Sammelband, der die oben skizzierte Problematik der polnischen Identitäts(de)figurationen selbstkritisch aufgreift, sind Einzelstudien mit unterschiedlichen thematischen Interessen und konzeptionell-methodischen Ansätzen vertreten: Für die einen Autorinnen und Autoren sind ausgewählte polnische (Lebens‑)Texte des 19. Jahrhunderts bzw. Texte über Polen Testobjekte primär rhetorischer bzw. postkolonial-tropologischer Hinterfragung, bei anderen stellen die metafigurativen Perspektiven „nur“ zusätzliche Impulse für die Fokussierung ihrer aktuellen Forschungsprojekte dar. Der Anteil metarhetorischer Problemstellungen schwankt von Beitrag zu Beitrag, aber insgesamt ← 19 | 20 → – im imaginierten totum – entsteht ein metonymisches Mosaik‑ und Montagebild aktueller Forschungsinitiativen zur Identitätsrhetorik in und über das Polen der Teilungszeit.
Der erste thematische Block des Sammelbandes, „Polen pars pro toto: Proportionen – Projektionen – Personifikationen“, wird eröffnet mit Thomas Grobs Beitrag Zwischen Metapher und Metonymie, Poesie und Wissenschaft. Orientbilder als Reflexionen des Selbst in der polnischen Romantik, in dem der Basler Forscher den pauschalisierenden und moralisierenden Rückprojektionen der postkolonialen Ansätze eine kultur‑ und diskurstropologische Optik gegenüberstellt, die auf Nuancierungen und Differenzierungen abzielt. Versteht sich das Poetische der Romantik als Domäne primär metaphorischer Sinnstiftung, so konzipiert sich die Wissenschaft dieser Zeit in epistemologischer Metonymik. Produktiv wird dabei die Verschränkung dieser angeblich konfliktären Signifikationsgesten nicht zuletzt in Bezug auf das orientalistische Spannungsfeld zwischen Literatur und Malerei einerseits sowie Wissenschaft und Diplomatie andererseits. Zentral wird dabei, so Grobs These, die Kategorie der Distanz: Sie entscheidet darüber, ob Objekte und Subjekte metonymisch oder metaphorisch fungieren und agieren. Zum Chronotopos dieser metarhetorischen Verhandlungen der Ferne und Weite, Entfernung und Annäherung wird die Orientreise. Kontrastiv zum französischen Orientalismus entwerfen polnische (Lebens‑)Künstler (selbst‑)orientalisierende Konfigurationen, die auf spezifisch polnische Sarmatismen und Osmanismen sowie Kosakisierungen des Polentums anspielen. Dominant wird dabei das zu tradierende und zugleich zu verfremdende Reiterbild. In den sich metonymisch gestaltenden imaginierten Topographien der (land‑)imperial-peripher aufgefassten exotischen Wildheit werden durch die Selbst-Entfremdung neue metaphorische Konstellationen von Fremd und Eigen modelliert. Für die zusätzliche Komplizierung einer solchen Tropologie der identifikatorischen Alterität sorgen im Falle der polnischen „Orientalisten“ deren Lebenstexte, nicht zuletzt diejenigen, die dem Wilna der 1810–20er Jahre entspringen. Von dort kommt nach Peterburg Józef Sękowski, der rasch zu einem der führenden Orientalisten des Imperiums und später zu einem einflussreichen Literaten, Übersetzer und Herausgeber wird. Sękowski konzipiert die Orientalistik via Reisen, das fremde Kulturen von innen heraus zu begreifen ermöglichen soll; dabei kommt es zur Herausbildung interferierender geokultureller Koordinatensysteme: zwischen West und Ost (Polen, Europa vs. Russland) und zwischen Süd und Nord (Orientalia vs. negativ konnotiertes Petersburg). Ebenfalls aus dem Wilnaer musisch-wissenschaftlichen Kreis stammt der sprachlich begabte, vor allem aber literarisch interessierte Ludwik Spitznagel, in dessen Biographie der spezifische polnisch-romantische Orientalismus zu kulminieren scheint, und zwar bis zu seinem ← 20 | 21 → frühen wertheroiden Suizid, der ihn vor der Metonymisierung des metaphorischen Orients durch eine diplomatische Tätigkeit befreit. In der Wilnaer Orientalismus-Kultur ist auch Adam Mickiewicz zu kontextualisieren, in dessen Sonety krymskie (Krimsonetten) die orientalistischen Sprecherperspektiven programmatisch nicht scharf differenziert und die Identifikationen über‑ und metaräumlich sondiert werden. Das Metaphorische (Fremde, Exotische) reminisziert dabei das Heimatliche und vice versa: Eigen-Fremd-Kontiguitäten transformieren sich immer wieder zu metaphorischen Begegnungen mit dem Selbst. Die wohl brisanteste Gestalt, auf die Grobs Beitrag zu sprechen kommt, ist der aristokratische Abenteuerer Wacław Rzewuski, der diverse (Selbst‑)Exotisierungen der polnischen Ukraine als „anderes Arabien“ in seinem Lebenstext performiert. Seine (Selbst‑)Orientalisierungen schließen dabei mythische Gesten der Rebellion ein, auch wenn, z. B. bei seinen Inszenierungen orientalischer Sujets mit domestizierten Kosaken als Darstellern, immer eine imperiale und sozial-hegemoniale Haltung sichtbar wird. Mit und nach dem Novemberaufstand kommen neue tropologische Formationen: Definierte sich die romantische Identität der 1820er Jahre nicht über das Andere, sondern über die Begegnung mit ihm, ausgetragen in dynamisch-reziproken Spannungen zwischen Metapher und Metonymie, so wird nach 1831 das Fremde als Objekt und Subjekt der Begegnung zugunsten einer schlichten Projektion des Fremden auf das Eigene aufgegeben.
Eine entscheidende Zäsur in der Entwicklung der Polen-Figurationen stellt der Novemberaufstand dar. Im Beitrag Legitimitätsfigurationen von Insurgency und Counterinsurgency in Erinnerungen an den Novemberaufstand von Christoph Garstka werden polemische Interpretationen des Novemberaufstandes analysiert, die nach der Niederlage der Rebellion die europäische Publizistik zur polnischen Frage nach 1831 bestimmen. Die einzelnen Geschehnisse werden in diesen Schriften in eine Kontiguitätsrelation zum fundamentalen Gegensatz zwischen „Freiheit“ und „Tyrannei“ gesetzt. Im liberalistischen Fahrwasser werden Identitäten entworfen und verhandelt, in denen zum einen das problematische (geo‑)politische Dasein und die Zukunft des staatenlosen Polen heraufbeschworen, zugleich jedoch (stellenweise mit hegemonialen Hierarchisierungen) Gründe für das Scheitern der Erhebung im Nationalcharakter (Infantilität, Müßiggang) gefunden werden. Dabei können sich, so Garstkas Beobachtungen, hellenistische Diskurse mit Orientalismen, zivilisatorische Diktionen mit Despotismuskritik, Agitation mit Faktizität, historiosophische Denkmuster mit georhetorischen Figuren überlappen. Maurycy Mochnackis messianistische Metonymien der Einigkeit und Solidarität kulminieren im Pathos des partisanenartigen Volkskrieges, in dem nationale Rebellion und soziale Revolution synonym werden. Absagen an das (gescheiterte) Strategische ← 21 | 22 → führen seine Argumentation zu hyperbolisch-provokativen Anstiftungen zur spontanen Taktik. Als negative bzw. positive Kontrastfläche dienen dabei sowohl der Westen als auch nicht zuletzt Russland, bei dessen Beschreibungen sich antihegemoniale Gesten mit kolonialen Zuschreibungsmodellen vermischen, antiabsolutistische Invektiven mit „Kresy“-Revisionismen. Dabei wird die Retrospektive auf die Niederlage des Aufstands zu einer Prospektive umgedeutet: Katastrophistisch-parachristologische Resurrektions‑ und Insurrektionsrhetorik bestimmt Tropen von Mochnackis politischer Kulturosophie. Die Sublimierung des Teilungstraumas geschieht via synekdochisch-metonymische Partialitätsfiguren (jeder polnische Haushalt als Partikel der Nation): Sie sollen, untermauert durch familiäre Metaphorik, ein Gesamtbild eines in seiner paradoxen Einheitlichkeit einmaligen Volkes evozieren. Solche Selbstbeschreibungen plausibilisieren Konzeptionen des polnischen Teufelskreises von Rebellion und Resignation.
Den publizistischen Konzepten eines Mochnacki opponieren andere polnische romantische Selbstbeschreibungen. Zentral für Alfred Galls Artikel Die Begriffsperson des Pilgers in der polnischen Romantik. Text und prekäre Territorialität ist nicht nur das an Deleuze und Guattari anschließende Konzept der Begriffsperson, das der Mainzer Forscher an den prominenten Figuren der polnischen romantischen (Selbst‑)Beschreibungen austestet, sondern der produktive Versuch, ihre Spezifika mit der für die polnischen Identitätsstiftung nach 1831 konstituierenden Problematik der (Ent‑)Territorialisierung zu verbinden. Dabei interessieren Gall ebenfalls reziproke Transformationen der jeweiligen „Begriffspersonen“: So sind Pilger und Vampir sowohl als unterschiedlich ausgeprägte „konzeptionelle Figuren“ in einem Zusammenhang als auch funktionale Äquivalente für die Beschreibung einer in der Geschichte problematisch verorteten sowie lokalisierbaren Identität zu verstehen. Die Konnotationen und Implikationen dieser Begriffsfiguren und der sie provozierenden Identifikationssujets variieren von Autor zu Autor und zeugen von einer konfliktären und zugleich komplementären Vielfalt der Begriffsperson-Auslegung(en) im untersuchten Zeitalter. Während z. B. die Pilgerschaft bei Konstanty Gaszyński noch die Semantik einer ziellosen Mobilität und Migration produziert, wird sie bei Adam Mickiewicz teleologisiert und schließlich eschatologisch-messianistisch fundiert: Nun stehen heilsgeschichtliche Identitätsprogramme auf der Agenda. Der Pilger ist bei Mickiewicz zugleich ein Anti-Odysseus: Die Wiederkehr (zum alten Polen) ist diskursiv nicht mehr aktuell, der Pilger, der in sich genetisch auch Züge des romantischen Propheten, Wanderers, Gespenstes und Vampirs trägt, begibt sich auf den Weg zu einem erst noch zu entwerfenden Ziel. Dagegen ist der Pilger bei Stefan Witwicki bereits ein Emigrant, verloren in der postbarock anmutenden Trümmerlandschaft, in ← 22 | 23 → der die alten neuen polnischen Resignationsszenarien verhandelt werden. In der Fortschreibung der Ruinentropen wird die Degradierung des Geschichtlichen auf die prekäre geopolitische Lage Polens im 19. Jahrhundert übertragen. Im Gegensatz zur barocken Allegorie wird jedoch, so Gall, in einer romantischen Selbstreferenzialisierungsgeste, der Betrachter des Zerfalls, der Pilger zentriert. Spätere Autoren, die unter dem Einfluss Mickiewicz’ stehen, sind zwar auf der Suche nach neuen Konstellationen von Inklusion und Exklusion (wie im Falle von Michał Chodźko), können jedoch (ein Beispiel dafür ist Władysław Syrokomla) nur bedingt der traumatischen Figuration der Verbannung aus der Geschichte entkommen. Was hier aber direkt und indirekt postuliert wird, ist das romantische Subjekt des Ausweglosigkeitsbewusstseins, das als Pilger in einem Grenzzustand zwischen einem „Nicht-mehr“ und einem „Noch-nicht“ zu modifizierten Identitätsmetonymien und ‑metaphern gelangt, die durch immer neue Motiventwicklungen und Sujetkonstellationen immer allegorischer werden.
In den literarischen Diskursen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ändern sich entscheidend die Modi der Reflexion nicht nur der Gegenwart und Zukunft, sondern auch der immer wieder zu rekonstruierenden und dekonstruierenden Vergangenheit. German Ritz zeigt in seinem Beitrag Der neue Mensch des polnischen 18. Jahrhunderts. Ignacy Kraszewskis Entwürfe zwischen den Geschlechtern und den Nationen, wie Kraszewski in seinen Sachsen-Texten im 18. Jahrhundert vor allem einen noch nicht erschlossenen Raum für neue epische Imaginationen entdeckt. Der Zürcher Literaturwissenschaftler demonstriert, wie im Dreieck von Gender, Narration und Figuration die polnische Literatur in der Person von Kraszewski alternative National‑ und Schreibidentitäten sondiert. Einzelschicksale stehen bei Kraszewski im Vordergrund des Erzählens, das entgegen den automatisierten romantischen Schemata der Polenbeschreibungen in erster Linie sich selbst neu zu definieren sucht. Die auf metonymisch-mikrohistorische Nuancen ausgerichtete Narrationsfaszination gilt referenziell der galanten Welt, selbstreferenziell jedoch einer Vorführung der eigenen Erzählkunst. Die so metapoetisch aufgefasste Schönheit des Erzählens verkörpert hier (metonymisch und metaphorisch) jedoch nicht nur die schöne Frau, sondern vor allem der schöne junge Mann. Die Machtspiele und ‑intrigen eines Brühl fingieren und funktionieren metonymisch und dabei kontrastiv zu den sich eher metaphorisch entwickelnden innen‑ und außenpolitischen Diskursen von August II. Auch weibliche Gestalten der in den polnischen Nationaldiskursen marginalisierten Sachsenzeit werden zu verfremdend wirkenden Interpretinnen der tradierten sarmatischen Familienkultur. Eine Mätresse erreicht ihre Autonomie weniger über den Stand, wie in der sarmatischen Welt, als vielmehr über ihre Schönheit und ihre rokoko-raffinierte ← 23 | 24 → Eloquenz. Immer wieder rekurriert Ritz auf die metapoetische und metarhetorische Konstante von Kraszewskis Erzählintrigen und zeigt unter anderem, wie das (Leit‑)Motiv der Verführung zu einer mehrdimensionalen Figur – wiederum mal Metapher, mal Metonymie – der Selbstreferenzialität wird. Jedoch organisieren auch andere Tropen die narrativ-kompositionelle Textebene: So ist die polnische Hochzeit am Schluss fast aller seiner Romane eine selbstironische Identitätsfigur, die im Spiel‑ und Theatermotiv manifest wird. Diese Selbstironie setzt das Scheitern der Helden und den Untergang der galanten Welt mit dem Verschwinden Polens in Verbindung.
Während Kraszewski seine eigene Version und Narration des 18. Jahrhunderts entwirft, arbeiten viele seiner jüngeren Kollegen die Schlüsselerinnerungsorte polnischer historischer Identifikationen ab. Ein Beispiel dafür stellt Stefan Żeromskis Panoramaroman Popioły (In Schutt und Asche) dar, in dem das napoleonische Zeitalter als ein immer wieder zurückkehrender und zur toten Metapher gewordener Mythos des polnischen Selbstbewusstseins (selbst‑)kritisch aufgegriffen wird. Żeromskis Epopöe steht im Zentrum von Michał Mrugalskis Beitrag Polnische Hautschrift. Aneignen – Markieren – Ins-Bild-Setzen biologischer Substanz bei Stefan Żeromski. Das Echo des Mythischen und das Mythische des Echos avancieren zu grundlegenden chiastischen Metafiguren in Żeromskis Werk: Dabei werden wiederholt diverse metonymische, symbolische und allegorische (Kon‑)Figurationen und Konstellationen zwischen Bauern und Adligen (bzw. Intelligenzlern) entworfen, in denen alte (und) neue Sujets, Kollisionen und Proportionen des Polentums überprüft und getestet werden. Entscheidend wird dabei die die Bauernbeschreibungen im Roman konstituierende und zugleich verfremdende Performanz des Auspeitschens. Der Bauer als biologische und somit formlose, prä‑ bzw. post-figurative Substanz wird durch die Flagellation erst als solche markiert und appropriiert, sei es seitens der polnischen Besitzer oder der österreichischen Besatzer. Die so konzipierte Meta-Figur des Prügelns, die meta-metonymisch das Repräsentieren selbst repräsentiert, wird dabei nicht zuletzt mit Figurationen von (Massen‑)Vergewaltigungen amalgamiert. Dadurch entstehen spezifische thanato-erotische Figurationen der polnischen Identität, die auf bezeichnende Weise mit den zeitgenössischen soziologischen Perspektivierungen der Historie korrespondieren. Sadomasochistische Markierungen – und der Beitrag von Mrugalski lokalisiert Żeromskis Schreiben dezidiert in einem größeren „kakanischen“ Kontext – suggerieren ihrerseits Modellierungen des nackten Lebens und (Kultur‑)Gedächtnisses, in dem die polnischen Identitätsspannungen zwischen Geschichte und Natur figuriert ← 24 | 25 → werden. Mit dieser Hautschrift signiert Żeromski seine biopolitischen und biopoetischen Entwürfe des Polentums im Vorfeld des Weltkrieges und der Wiedererlangung der polnischen Staatlichkeit.
Details
- Pages
- 344
- Publication Year
- 2017
- ISBN (ePUB)
- 9783631704202
- ISBN (MOBI)
- 9783631704219
- ISBN (PDF)
- 9783653052831
- ISBN (Hardcover)
- 9783631659120
- DOI
- 10.3726/978-3-653-05283-1
- Language
- German
- Publication date
- 2018 (November)
- Keywords
- Rhetorik Identitätsfigurationen Selbstorientalisierung Orientalismus Romantik Nationalbildung Metapher
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 344 S.